Bulletin 54 – Weihnachten 2021
Der Leitartikel
Verehrte Leserinnen und Leser,
An einen Tornado wie den, der im Sommer Mähren heimgesucht hat, erinnern wir uns nicht. Er hatte die Stärke EF4, was auf der Skala der zweitstärkste ist. Und die Zerstörung war wirklich schrecklich. Es gibt Länder auf der Erde, wo Menschen sozusagen ganz „normal“ einem Hurrikan, Tornado oder weiteren solchen Phänomenen begegnen, wo sie das gewöhnt sind, wissen, wie man sich darauf vorbereitet, was zu machen ist. Aber in der Tschechischen Republik? Einen Hurrikan gibt es bei uns überhaupt nicht, einen Tornado hat es schon einmal gegeben, aber noch nie in so einer Stärke. Mithilfe des Internets habe ich herausgefunden, dass eine Zerstörung von solcher Intensität Prag im Jahr 1119 getroffen hat, dies wurde angeblich in der tschechischen Chronik von Kosmas festgehalten. Aber solche Schrecken sind zum Glück mit etwas Gutem, Vorbildlichem verbunden. Die finanzielle Hilfe für die verwüsteten Gemeinden erfolgte sofort und erreichte unglaubliche Ausmaße, dem Sturm selber vergleichbar. Und es freut mich, dass zur ganz wesentlichen Hilfe ausser ADRA und der Organisation „Mensch in Not“ auch die Diakonie der EKBB beigetragen hat. Große und wirksame Hilfe kam auch aus dem Ausland, besonders von deutschen Kirchen. Die genannten Organisationen sind außerordentlich wichtig, wären aber hilflos, wenn ich es nicht die Bürger- Gesellschaft gäbe. Diese riesige Geldmenge, die in diesen Institutionen gesammelt wurde, schickten normale Menschen aus unserem ganzen Land, wofür wir sehr dankbar sein müssen. Und so bleibt nur zu hoffen, dass wir in der Tschechischen Republik nicht anfangen müssen uns an Tornados zu gewöhnen.
Bulletin 54 – Weihnachten 2021
Gerne würde ich noch auf die Persönlichkeit von Svatopluk Karásek hinweisen. Um wen es da geht, erfahren Sie im entsprechenden Artikel, ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass er durch seine Persönlichkeit, sein Wirken und vor allem durch seine Lieder wirklich eine  ungeheuer große Zahl von Menschen beeinflusst hat, und bei weitem nicht nur aus christlichen Kreisen. Und das Regime hat ihn nicht gebrochen, auch wenn es sich sehr darum bemühte.
ungeheuer große Zahl von Menschen beeinflusst hat, und bei weitem nicht nur aus christlichen Kreisen. Und das Regime hat ihn nicht gebrochen, auch wenn es sich sehr darum bemühte.
Der Sommer ist schon lange vorbei, die Weihnachtszeit liegt vor uns und damit auch die Freude, die uns weder ein Tornado noch andere Widrigkeiten nehmen können. Glauben wir es.
Im Namen der Redaktion wünsche ich Ihnen Frieden Jana Plíšková
DIE EVANGELISCHE KIRCHE DER BÖHMISCHEN BRÜDER
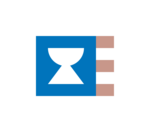 P.O. Box 466, Jungmannova 9, CZ 111 21 Praha 1, Czech Republic
P.O. Box 466, Jungmannova 9, CZ 111 21 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 224 999 215(216); Fax: (+ 420) 224 999 219
E-Mail: ekumena@e-cirkev.cz
Internet: www.e-cirkev.cz
Die Grundlagen der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) wurzeln in der Utraquistischen Kirche (1431–1620) und in der Brüderunität ((1457–1620). Die EKBB entstand in ihrer heutigen Gestalt im Jahr 1918 durch den Zusammenschluss der bis dahin selbständigen evangelischen Kirchen Augsburger und Helvetischen Bekenntnisses. Deren Existenz wurde nach dem Ende der harten Gegenreformation, die von 1620 bis zum Erlass des Toleranzpatens durch Kaiser Joself II. im Jahr 1781 dauerte, erlaubt. Die strengen Beschränkungen mussten die Evangelischen freilich auch danach beachten, bis zum Erlass des Protestantenpatentes im Jahr 1861.
In der Zeit ihrer Entstehung hatte die EKBB 250 000 Mitglieder, im Jahre 1938 waren es dann schon 325 000 Mitglieder. Heute ist die Kirche in 14 Seniorate aufgeteilt mit einer Gesamtzahl von 250 Gemeinden und ca. 80 000 Gemeindegliedern. Die Kirche wird vom sechsköpfigen Synodalrat geleitet, der auf sechs Jahre gewählt wird. Repräsentiert wird die Kirche vom Synodalsenior und vom Synodalkurator.
Auf eine Welle der Zerstörung folgt eine Welle der Solidarität
 Am Donnerstag, den 24. Juni 2021 wurden die Regionen um Hodonín und Břeclav unerwartet von einer Naturkatastrophe heimgesucht. Auf eine Serie starker Gewitter folgte ein Tornado, der durch Südmähren fegte. Neben hohen Materialschäden wurden auch Tote und viele Verletzte gemeldet. 2000 schwer beschädigte Gebäude, einschließlich Eisenbahninfrastruktur, weggerissener Dächer, hunderter umgerissener Bäume – es entstand ein in Tschechien bisher ungekannter Schaden.
Am Donnerstag, den 24. Juni 2021 wurden die Regionen um Hodonín und Břeclav unerwartet von einer Naturkatastrophe heimgesucht. Auf eine Serie starker Gewitter folgte ein Tornado, der durch Südmähren fegte. Neben hohen Materialschäden wurden auch Tote und viele Verletzte gemeldet. 2000 schwer beschädigte Gebäude, einschließlich Eisenbahninfrastruktur, weggerissener Dächer, hunderter umgerissener Bäume – es entstand ein in Tschechien bisher ungekannter Schaden.
Schon vor Mitternacht desselben Tages trafen sich in einer außerordentlichen Sitzung die Leitung der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder und der Diakonie der EKBB, um den Betroffenen schnellstmögliche Hilfe anzubieten. Aus humanitären Mitteln wurde eine Soforthilfe von 500 000 Tschechischen Kronen (ca. 20.000 EUR) gewährleistet,das Zentrum für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit organisierte eine Spendensammlung, die innerhalb von zwei Monaten weitere 26 Mio. Tschechische Kronen (ca. 10,1 Mio. EUR) einbrachte.
Gemeinsam mit fünf weiteren Organisationen, die ebenfalls Sammlungen organisiert hatten, schloss die Diakonie eine Übereinkunft über eine gemeinsam abgestimmte Hilfskation ab. So brachten es in den ersten zwei Wochen nach dem Tornado 34 Freiwillige der Diakonie auf über 1000 Arbeitsstunden in den betroffenen Gebieten.
Die sofortige Welle der Solidarität derjenigen, die zu Hilfe bereit waren und sind, war derart außergewöhnlich, dass sich das Zentrum für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit der Diakonie der EKBB dazu entschloss, einen ökumenischen Gottesdienst zur geistlichen Stärkung, zum Trost und zur Hoffnung all derjenigen zu veranstalten, die ihre Lieben oder ihre Häuser verloren hatten und natürlich auch für jene, die Hoffnung und Trost gespendet hatten, wie den Rettungskräften, Einsatzkräften der Feuerwehr, Soldatinnen und Soldaten, Freiwilligen und vielen mehr...
Der Gottesdienst fand am Montag, den 30. September um 19 Uhr in der Pfarrkirche Jakobus des Älteren in Moravská Nová Ves (Mährisch Neudorf) statt. Im Gottesdienst dienten Geistliche aus der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder, aus der Römisch- Katholischen Kirche, der Evangelisch-methodistischen Kirche, der Tschechoslowakischen Hussitischen Kirche sowie der Siebenten-Tags-Adventisten.
Drei Wochen später, Mitte Juli, verursachte eine Welle starker Gewitter und flutartigen Regens blitzartige Überflutungen im Westen Deutschlands sowie in Belgien und den Niederlanden.
Die Katastrophe forderte mehr als 200 Menschenleben und noch einen Monat nach den Ereignissen meldeten die Behörden Dutzende Vermisste. Mit diesen Ausmaßen gehört dieses Hochwasser zu den größten Naturkatastrophen Europas im letzten Vierteljahrhundert.
Der Synodalrat kontaktierte umgehend die evangelische Partnerkirche in Deutschland und drückte seine Anteilnahme aus. Gleichzeitig rief er die tschechischen Gemeinden zu Gebeten für die betroffenen Regionen auf und beschloss auf seiner Sitzung eine direkte Hilfe im Wert von 500.000 Kronen (ca. 20.000 EUR) aus Mitteln des Fonds für soziale und karitative Hilfe. Die finanzielle Unterstützung der EKBB floss direkt auf das Konto der deutschen Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, die in den betroffenen Gebieten aktiv ist.
Darüber hinaus spendeten sowohl Gemeinden als auch Einzelpersonen. Die Spendensammlung für Deutschland koordinierte die Diakonie der EKBB, auf deren transparenten Konto bis Mitte August Spenden in Höhe von fast 555.000 Kronen (ca. 22.000 EUR) eingingen.
„Danke von ganzem Herzen für eine so großzügige Geste der Unterstützung und Solidarität! Die durch das Hochwasser angerichteten Schäden sind nicht zu beziffern. Fotos von betroffenen Orten lassen uns nur erahnen, wie groß der Notstand ist. Immer wieder versetzen uns Geschichten, die uns aus der Öffentlichkeit erreichen, in Erstaunen, Geschichten voll von Hoffnung und Glauben in diesem Leid. Eine dieser Geschichten der Hoffnung ist auch Ihre Begleitung in Gedanken, Gebeten und Geldern, die uns erreichen“, so ein Dankesbrief aus Deutschland, der an die Ökumene-Abteilung der Zentralen Kirchenkanzlei adressiert war.
Wir danken allen, die gespendet und unterstützt haben, dass sie mit ihrer Solidarität über die Trauer hinweghelfen und über Staatsgrenzen hinaus Hoffnung schenken.
Jiří Hofman
Sváťa-Fest 31. 07. 2021
 Svatopluk Karásek (*1942) diente als Prediger in der EKBB, zunächst in Hvozdnici und in Nové Město pod Smrkem. Auch als das kommunistische Regime ihm seine Zustimmung entzog, wirkte er weiterhin als Prediger und überzeugter Anhänger von Jesus Christus, ob als Burgkastellan an der Burg Houska oder in seiner Zeit im Gefängnis.
Svatopluk Karásek (*1942) diente als Prediger in der EKBB, zunächst in Hvozdnici und in Nové Město pod Smrkem. Auch als das kommunistische Regime ihm seine Zustimmung entzog, wirkte er weiterhin als Prediger und überzeugter Anhänger von Jesus Christus, ob als Burgkastellan an der Burg Houska oder in seiner Zeit im Gefängnis.
Im Jahr 1980 emigrierte er in die Schweiz und diente in Bonstetten und Zürich in der Reformierten Kirche. Nach der Wende in der Tschechoslowakei 1989 kam er zurück und knüpfte zunächst in der Bethlehemskapelle in Prag, dann in Nové Město pod Smrkem an seine Pfarrtätigkeit an. Anschließend kehrte er wieder nach Pag zurück, in die Salvatorkirche.
Im Rahmen eines pandemiebedingten kleinen Abschieds in der Salvatorkirche am 23. Januar 2021, entstand die Idee ein sogenanntes „Sváťa-Fest“ (Anm. d.Ü.: Sváťa=Kosename f. Svatopluk) zu veranstalten, um es auch dem weiteren Freundes- und Zuhörerkreis zu ermöglichen, sich an sein Wirken als Prediger und Musiker zu erinnnern. Das Programm begann am 31. Juli mit einem Gottesdienst in der Prager Salvatorkirche, es schloss sich ein Musikfestival in im südlichen Prag gelegenen Lahovičky an.
Obwohl das Fest mitten im Sommer war und deshalb nicht alle kommen kommen, denen die Freundschaft, Predigten, Lieder oder einfach die Offenheit von Svatopluk Karásek am Herzen lag, waren beide Orte des Sváťa-Fests gut besucht.
In der Kirche des hl. Salvator erinnert der Pfarrer Zdeněk Bárta, Dissident und Wegbegleiter von Svatopluk Karásek aus Nordböhmen an dessen ganzheitliche Perspektive, innere Freiheit, herausragende Menschenfreundlichkeit und and dessen stetiges Ringen um die Wahrheit in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Der Pfarrer Josef D. Beneš, Svatopluks Schweizer Kollege, erinnerte an dessen spannenden Anfänge, als er erstmals auf Deutsch predigte und daran, wie er die manchmal etwas „steifen“ Reformierten Schweizer mit seinen Predigten bewegte. Insbesondere aber, so erinnerte Beneš, sprach er die Menschen dadurch an, dass die Verkündigung des Evangeliums für ihn einen tieferen, existentiellen Sinn hatte.
Auch weitere Gäste erinnerten in diesem Sinn daran, dass Svatopluks Beiträge immer sehr authentisch waren, sich damit befassten, dass ziviler Nonkonformismus in der Normalisierung keine Selbstverständlichkeit war und dass hinter dem versierten Svatopluk immer dessen tiefe Demut vor Gott stand.
Im Anschluss an den Gottesdienst fand ab 16 Uhr das Festival in Lahovičky statt. Interpretiert von Karel Vepřek und Bobeš Rössler erklangen Lieder von Svatopluk Karásek, natürlich fehlten auch nicht die Bands Oboroh und vor allem Svatopluk. Die Underground-Community, zu der manch Kirchbesucher dazustoß, vergnügte sich im Tanze, mit dem ein oder anderen Bierchen und schwelgte in alten Hits wie Ženský ty jsou fajn (etwa: Frauen, die sind klasse), Say no to the devil und weniger bekannten Liedern.
Svatopluks Lieder und Predigten zeigten zur Zeit der Normalisierung einen Weg des wahren Christentums, sie wirkten als Antitoxin gegen die Engherzigkeit der Kirche, gegen die aktuelle Verlockung des Nationalismus, der Fremdfeindlichkeit und des Konsums, der viele Christen und auch Krichenvertreter nicht immer gewappnet sind.
Das Sváťa-Fest war eine schöne Gelegenheit für viele sich für das Leben von Svatopluk Karásek zu bedanken. Wir erinnern uns mit Freude an Svatopluk als treuen Anhänger Christus, der seinen Mitmenschen trotz Einschüchterung und hoffnungsloser Umstände das Geschenk der christlichen Freiheit, Großzügigkeit und Wahrhaftigkeit vergegnwärtigen konnte.
Tomáš Trusina
Die evanglische Kirche der Böhmischen Brüder hat eine neue Leitung
 Mit einem Festgottesdienst am Samstag, dem 20. November 2021 wurde in Brünn der neue Synodalrat der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder in sein Amt eingeführt. Die Veranstaltung fand wegen der anhaltenden Corona-Pandemie unter besonderen Einschränkungen statt und wurde aus diesem Grunde auch online übertragen.
Mit einem Festgottesdienst am Samstag, dem 20. November 2021 wurde in Brünn der neue Synodalrat der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder in sein Amt eingeführt. Die Veranstaltung fand wegen der anhaltenden Corona-Pandemie unter besonderen Einschränkungen statt und wurde aus diesem Grunde auch online übertragen.
Der sechsköpfige Synodalrat ist das höchste Organ der Kirche. An der Spitze stehen Synodalsenior (ein Geistlicher) und Synodalkurator (ein Laie). Die Ratsmitglieder – drei Geistliche und drei Laien – werden aller sechs Jahre von der Synode gewählt.
Die neuernannten Mitglieder des Synodalrates übernehmen ihr Amt in einer Zeit, in der die Kirche einen Wandlungsprozess hin zur Selbstfinanzierung durchläuft. Die jahrzehntelang andauernde Finanzierung durch staatliche Mittel entspricht nicht mehr der gegenwärtigen Realität der Verteilung der Gemeinden, so dass eine Reorganisation nötig ist. Zugleich aber ist dies Gelegenheit, Dinge neu zu durchdenken sowie neue Akzente und neue Lösungen zu suchen. Eben diese Aufgabe wird in den nächsten sechs Jahren dem Synodalrat zukommen.
Der sechsköpfige Synodalrat besteht zur Hälfte aus neuen Mitgliedern. Die Pfarrer Pavel Pokorný, Ondřej Titěra und der Laie Jiří Schneider waren bereits im vorhergehenden Synodalrat vertreten. Zu ihnen gesellen sich für die kommende Amtszeit neue Gesichter: der Pfarrer Roman Mazur, der bisher Senior des Prager Seniorats war, und zwei Laien – Jana Šarounová, die Sonderpädagogik studiert hat und als Kuratorin der Kirchgemeinde Prag- Vinohrady arbeitet, und Simona Kopecká, Juristin und Prädikantin aus Schlesien.
Die neue Zusammensetzung des Synodalrats für die Amtszeit 2021 bis 2027
Pavel Pokorný, Synodalsenior
Pavel Pokorný (1960) war von 2000–2021 Pfarrer der Gemeinde Prag-Střešovice und zuvor in Trutnov (1987–1999), wo er seinen Pfarrdienst nach Studium und Grundwehrdienst begonnen hat. Während eines einjährigen Auslandsaufenthalts in den USA widmete er sich v.a. der Seelsorge. Er war ebenfalls als Krankenhausseelsorger für das mobile Hospiz „Cesta domů“ (übersetzt: „Heimweg“) tätig. Pavel Pokorný ist verheiratet und hat vier Kinder.
Jiří Schneider, Synodalkurator
Jiří Schneider (1963) ist ehemaliger Leiter des „Aspen Institute“ in Prag. Zuvor war er als Diplomat tätig. Er hat Geodäsie und Kartografie an der Tschechischen Technischen Universität in Prag und Religionistik an der University of Cambridge studiert, ist verheiratet und hat drei Kinder. Ondřej Titěra, 1. Stellvertreter des Synodalseniors Ondřej Titěra (1964) ist seit 2014 Pfarrer in Jablonec nad Nisou. Zuvor war er als Pfarrer in Miroslav (1998–2014) und in Vilémov u Golčova Jeníkova (1989–1998) tätig. Er ist verheiratet und hat vier Kinder.
Simona Kopecká, 1. Stellvertreterin des Synodalkurators
Simona Kopecká (1969) hat die Justizakademie in Kromeříž und die Evangelisch-Theologische Fakultät der Karlsuniversität in Prag, Fachrichtung Evangelische Theologie absolviert. Sie arbeitet als Anwaltsassistentin in einer Anwaltskanzlei in Ostrava, zuvor war sie als Rechtspflegerin tätig. Sie ist stellvertretende Kuratorin der Pfarrgemeinde der EKBB in Opava und Prädikantin. Simona Kopecká ist verwitwet und hat zwei erwachsene Kinder.
Roman Mazur, 2. Stellvertreter des Synodalseniors
Roman Mazur (1974) war Pfarrer in Ostrava (1996–2006) und ist seit 2006 Pfarrer der Gemeinde Prag-Libeň. Von 2009 bis 2021 wurde er zweimal zum Senior des Prager Seniorats gewählt. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.
Jana Šarounová, 2. Stellvertreterin des Synodalkurators
Jana Šarounová (1964) arbeitet als Sonderpädagogin und Logopädin, sowie als stellvertretende Direktorin einer schulischen Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche mit Sprachfehlern. Seit 2004 ist sie Kuratorin der Gemeinde Prag-Vinohrady und wirkt außerdem im kirchlichen Seelsorgerat mit. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.
Jiří Hofman
Über „Vaters Haus“ zu den Landsleuten
 In den 1990er Jahren, nach der Unabhängigkeit der Ukraine, arbeitete in Kiew ein erfolgreicher Chirurg mit akademischer Stellung, Roman Korniiko. Er konnte sich nicht damit abfinden, dass es Hunderte von obdachlosen Waisenkindern auf den Straßen der Stadt gab, also begann er, Hilfe für sie zu suchen. Er brachte Ehepaare zusammen, die bereit waren, sich um sie zu kümmern, und versuchte gleichzeitig, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Angelegenheit zu lenken. Vonseiten der Behörden stieß er auf Ablehnung. Oft ermittelte die Polizei gegen ihn, mehrmals wurde er geschlagen. Doch er gab nicht auf, scharte nach und nach einen Kreis gleichgesinnter Christen um sich und baute mit ihnen ein Haus, in dem er die Waisen zusammen mit ihren Pflegeeltern beherbergte.
In den 1990er Jahren, nach der Unabhängigkeit der Ukraine, arbeitete in Kiew ein erfolgreicher Chirurg mit akademischer Stellung, Roman Korniiko. Er konnte sich nicht damit abfinden, dass es Hunderte von obdachlosen Waisenkindern auf den Straßen der Stadt gab, also begann er, Hilfe für sie zu suchen. Er brachte Ehepaare zusammen, die bereit waren, sich um sie zu kümmern, und versuchte gleichzeitig, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Angelegenheit zu lenken. Vonseiten der Behörden stieß er auf Ablehnung. Oft ermittelte die Polizei gegen ihn, mehrmals wurde er geschlagen. Doch er gab nicht auf, scharte nach und nach einen Kreis gleichgesinnter Christen um sich und baute mit ihnen ein Haus, in dem er die Waisen zusammen mit ihren Pflegeeltern beherbergte.
Sie gaben dem Haus im Vorort von Kiew den Namen „Vaters Haus“ – also Haus des Vaters im Himmel. Und es ist nahezu unvorstellbar, wie viele hundert Kinder dort kamen und gingen und eine neue Familie fanden. Ehepartner, ob kinderlos oder mit Kindern, manchmal mit bereits erwachsenen Kindern, nahmen Waisen von der Straße in ihre Familien auf. Auch eine Schule wurde im Haus eingerichtet. Eltern aus dem Dorf bemühen sich heute darum, dass ihre Kinder in „Vaters Haus“ zur Schule gehen können. Das schöne, farbenfrohe und fröhliche Haus wurde später um ein zweites Gebäude erweitert, in dem man sich noch weitergehend um die Kinder kümmern kann. Hier arbeiten auch ein Arzt, ein Physiotherapeut und ein Psychologe.
In diese wunderbare Gemeinschaft kam ich im Sommer auf dem Weg zu unseren evangelischen Landsleuten in Bohemka und Veselinovka. Eigentlich wollte ich diese Reise gemeinsam mit Jan Dus unternehmen. Als der Krieg im Donbass begann, half Jan Dus, damals Leiter des humanitären Zentrums der Diakonie der EKBB, für „Vaters Haus“ Wohncontainer aus Zlín zu beschaffen. In diesen Häuschen wurden Flüchtlinge aus der Ostukraine untergebracht, vor allem Mütter mit Kindern aus dem Donbass, die zum Teil heute noch dort leben. Jan Dus konnte aber schließlich doch nicht mit mir in die Ukraine fahren. Er war von der Diakonie gebeten worden, nach dem Tornado den Hilfseinsatz im Dorf Hrušky zu leiten.
So fuhr ich gemeinsam mit Pavel Kalus, einem Pfarrer aus Prag-Žižkov, und seinem Sohn Jan [genannt „Honza“] in die Ukraine. Wir sagten den vereinbarten Besuch in „Vaters Haus“ nicht ab und sind bis heute gerührt von der Art und Weise, wie die Mitarbeiter uns empfangen haben. Eine der Bewohnerinnen dieser Zlín-Container gehört jetzt zum Führungsteam des Heims. Sie kümmerte sich um uns und zeigte uns an zwei Tagen alles, was „Vaters Haus“ ausmacht.
Eine Oase für Straßenkinder
Ich staunte darüber, was Roman und seinen Mitstreitern trotz des anfänglichen Widerstands gelungen war. Roman meint, dass sie das alles ohne die Hilfe von oben nicht geschafft hätten. Sie stellten ein Team von Leuten zusammen, die mit Kindern arbeiten können. Über die freundliche Atmosphäre des Hauses brauchte man nicht zu sprechen, man spürte sie hier, und es war offensichtlich, dass die Arbeit seit mehr als 20 Jahren gut funktionierte. Viele der „Kinder“, die hier einst Asyl fanden, sind heute Mitarbeiter oder Helfer des Heims und der gesamten Gemeinschaft. Roman spricht von ihnen als „Absolventen“.
Nur wenige verstanden, dass jemand seine akademische medizinische Karriere für Straßenkinder opfern konnte. Roman berichtete, dass in der Anfangszeit eine Einsatztruppe zu ihrem Haus geschickt worden sei, die das ganze Haus durchsucht habe. Am nächsten Tag kam der Leiter des Einsatzes und entschuldigte sich. Er sei beauftragt worden, Drogen als Falle in das Heim zu bringen. Doch dazu sei er nicht in der Lage gewesen.
Es gelang nach und nach, die öffentliche Meinung zu ändern. Jetzt findet man an der Wand des Büros mehrere Auszeichnungen, zum Beispiel „Held der Republik Ukraine“.
In diesem Jahr ist ein kompletter Umbau des ersten Hauses im Gange. Die Kinder sind daher auf dem Gelände der riesigen Präsidentenresidenz untergebracht. Präsident Wolodymyr Selenskyj stellte ihnen einen der älteren Pavillons zur Verfügung. Die Kinder können an den Teichen auf dem Residenzgelände sogar ein Sommerlager veranstalten. Wir wurden auch in dieses militärisch bewachte, mehrere Kilometer große Gebiet geführt. Im Hinterhof von „Vaters Haus“ wurden wir Zeugen, wie sehr die Kinder Roman lieben und wie natürlich er mit ihnen umgehen kann.
Die bewundernswerte Kraft der Persönlichkeit Roman Korniikos, die einem aufrichtigen Glauben entspringt und in schwierigen Situationen einfallsreich Hilfe vermitteln und ein vertrauensvolles Umfeld schaffen kann, erinnert mich an die Arbeit von Přemysl Pitter in Tschechien.
Wir besuchten die Gemüse- und Obstgärten, in denen die Kinder mithelfen, sowie das große Gebäude des unvollendeten Zentrums, das die Stadt mitsamt Grundstück an „Vaters Haus“ verkauft hat. Es gibt Pläne, darin in Zukunft neue Räumlichkeiten und auch eine Schule für Assistenten einzurichten. Bisher befindet sich im Untergeschoss ein Kleiderspendenlager und im Erdgeschoss eine improvisierte, eigene Kinderkirche, zu der am Sonntag bis zu 200 Menschen kommen, darunter auch Dorfbewohner. Hier wird angeblich in einer Sprache gepredigt, die Kinder verstehen.
Die Kinder schickten Jan Dus ein schönes Geschenk, einen Handyständer aus Keramik. Sie haben ihn selbst gemacht und wollen damit an die Hilfe unserer Diakonie erinnern.
Gottesdienste in der Garage
Erfüllt mit Energie aus „Vaters Haus“ eilten wir zu unseren Freunden und Landsleuten in den tschechischen Gemeinden. Zuerst in die Stadt Perwomajsk, wo mehrere Menschen wohnen, die ursprünglich aus Bohemka stammen. Wir trafen uns am Samstag in der zauberhaften Garage von Václav Jančík wieder. Mit 17 Brüdern und Schwestern feierten wir Gottesdienst und Abendmahl. Wir waren froh, uns nach anderthalb Jahren wiederzusehen. An einer gedeckten Tafel voller Leckereien unterhielten wir uns noch lange.
Am Vorabend hatten wir bereits alles mit dem Ehepaar Kučer besprochen, das uns für eine Nacht beherbergte und bewirtete. Ludvík Kučera ist Spezialist für Schiffsmotoren. Er hat auf Schiffen die ganze Welt umrundet.
Am Samstagabend begrüßte uns bereits Bohemka. Pavel Kalus sah die Kirche wieder, die Bethlehem- Kapelle, zu deren Geburtsstunde vor einem Vierteljahrhundert er zusammen mit Pfarrer Václav Hurt anwesend war. Dank seines Lehrers Petr Pirocht von der Baugewerbefachschule in Brünn konnte er dieses Bauprojekt für Bohemka in die Wege leiten.
Dank des größeren zeitlichen Abstandes von einer ganzen Generation hatte Pavel noch die begeisterten Anfänge der Erneuerung der Gemeinde vor Augen, als die Kirche gebaut wurde, und auch die vielen Menschen, die sich jahrelang in der Kirche versammelt hatten, aber heute nicht mehr unter uns sind.
Am Sonntag predigte er sehr schön und hoffnungsvoll über Jesus, den Hirten der Schafe. Das Hirtenbild ist sowohl in Bohemka als auch in Veselinovka jedem verständlich, denn täglich sieht man, wie der Hirte morgens das Vieh wegführt und abends von der Weide zurück in den Stall bringt. Auf jeden Fall, früher wie heute, in Bohemka, Veselinovka, in unserem eigenen Land und in „Vaters Haus“ können wir uns darauf verlassen, dass wir einen guten Hirten haben, der uns sicher führt, wie auch immer wir ihn uns vorstellen.
Ich war besonders froh, dass Bohemka nach den anderthalb Jahren, während derer ich wegen der Corona-Pandemie nicht in der Ukraine sein konnte, noch immer voller Leben ist. Dank dreier unverzagter Frauen konnten die Gottesdienste trotz der Schwierigkeiten, die Corona mit sich brachte, aufrechterhalten werden. Die Leute kommen gerne zu den Versammlungen, und ihre Zahl ist nicht wesentlich zurückgegangen. Nach anderthalb Jahren feierten wir wieder das Abendmahl.
Am Montagabend kam eine Gruppe von Frauen ins Pfarrhaus zum Treffen der „mittleren Generation“. Es war zu sehen, wie glücklich sie sind, wenn sie inmitten harter Arbeit zusammenkommen, zusammen sein, über eine biblische Geschichte nachdenken können. Pavel und ich stellten das Buch Parabible vor und daraus ein originell bearbeitetes Gleichnis über die Arbeiter im Weinberg in der Geschichte „Lauter Einser“. Den größten Teil des Abends haben wir gesungen. Wir sangen Lieder aus dem Gesangbuch Svítá und auch Volkslieder. Die meisten Teilnehmer des Kreises sind Landmädel aus Bohemka. Sie wollten auch einige Melodien für die Aufführung ihres Ensembles klären.
Wir vermissten Ola Andršová, die ehemalige Vorsitzende des Landsleute-Vereins. Im Frühjahr ist sie mit ihrer Familie nach Tschechien gezogen. Ihre Nachfolgerin Aljona Hortová macht sich aber ebenfalls ausgezeichnet.
Über die holprige Straße nach Veselinovka
Am Mittwoch machten wir uns auf kurvigen und sehr holprigen Wegen auf nach Veselinovka. Auch dieses schöne, inmitten von Feldern gelegene Dorf lebt. Diesmal war es voller Einheimischer, die schon früher nach Tschechien gezogen waren und nun, nach zweijähriger Unterbrechung, ihr Dorf besuchten. So war es auch bei unserer Gastgeberin Marie Provazníková. Ihre Tochter Ola und die Enkelin Dáša waren schon abgereist, aber Enkelin Marína aus Liberec war noch mit uns dort. Der Sonntagsgottesdienst wurde wieder von Mädchen organisiert, zwei Studentinnen aus Tschechien, die für drei Wochen gekommen waren, um das Tschechisch der Kinder aus Veselinovka zu perfektionieren. Ich habe mich sehr gefreut, Maries „Mädchen“ wieder zu treffen, wie sie die Frauen nennt, die in die Kirche gehen. Die meisten sind in ihrem Alter.
Der Sonntag ging aber noch weiter: Fast das ganze Dorf versammelte sich zum Jubiläum der Gemeindegründung. Die Lehrerin Valentýna Gavrot hatte mit Kindern und dem Chor Zlatá rosa [„Goldener Tau“] ein Programm einstudiert. Heutige und ehemalige Bewohner sahen zu, was ihre Kinder und Erwachsenen darzubringen vermochten. Das Stärkste für mich ist, wenn Ráďa Provazník singt. Er ist der einzige erwachsene Mann, der sich nicht verlegen versteckt, sondern mit fesselnder Stimme ein berührendes ukrainisches Lied singt. Der Abend wurde mit Speis und Trank fortgesetzt, und auf der Straße wurde bis zum Morgen getanzt. Daran nahmen wir jedoch nicht mehr teil. Morgens um halb fünf machte ich mich mit Pavel, Honza, Šárka und Tereza auf den Weg in Richtung Lemberg und nach Hause.
Ich verließ „unser“ Dorf wieder erfreut und ermutigt davon, wie gut es unseren Freunden geht. Ich gebe aber zu, dass ich es immer als Schatten empfinde, wenn kluge Leute von dort wegziehen, zu uns nach Tschechien. Ich gönne es ihnen, aber „zu Hause“ fehlen sie.
David Mašek, ein Vertreter unserer Konsulin in Kiew, mit dem wir uns in Kiew getroffen haben, schrieb mir, wie froh er sei, dass das Dorf trotz der Entvölkerung noch bestehe. „Ich wünschte, die Dinge würden sich zum Besseren wenden und es gäbe Arbeit und eine Perspektive in den Dörfern. Ich sage mir, wenn sich ein tschechischer Investor fände, zum Beispiel aus der Lebensmittelindustrie, würde das meiner Meinung nach helfen.“
Veselinovka und Bohemka hätten es verdient.
Miroslav Pfann
Der neue Generalsekretär
 Gegen Ende des Sommers kam es auf dem Posten des Leiters der Zentralen Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder zu einem Wechsel. Der bisherige Chefsekretär Jaromír Plíšek, ein ehemaliger Diplomat, der das Amt seit Januar 2017 leitete, wurde am Montag, den 20. September von seinem ehemaligen Stellvertreter Martin Balcar abgelöst.
Gegen Ende des Sommers kam es auf dem Posten des Leiters der Zentralen Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder zu einem Wechsel. Der bisherige Chefsekretär Jaromír Plíšek, ein ehemaliger Diplomat, der das Amt seit Januar 2017 leitete, wurde am Montag, den 20. September von seinem ehemaligen Stellvertreter Martin Balcar abgelöst.
Martin ist in der Gemeinde des Prager Stadtteils Strašnice aufgewachsen und studierte Sozialarbeit an der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag. Schon während seines Studiums leitete er sieben Jahre die Stiftung „Divoké husy“ (übersetzt: Wildgänse), anschließend war er bei einer Telefonseelsorge tätig und am Ende landete er im Zentralamt der Diakonie der EKBB als Leiter für Kommunikation und externe Beziehungen. Vor seinem Beginn in der Zentralen Kirchenkanzlei der EKBB im März 2020 arbeitete er sieben Jahre als Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei der tschechischen Zweigstelle von Amnesty International. „Ich nehme die Stelle des Generalsekretärs mit großer Demut an. Ich sehe in unseren Gemeinden und im Rahmen der ganzen Kirche eine riesige Vielzahl an Aktivitäten, was mich mit Optimismus und Freude erfüllt. Ich möchte ein Amt leiten, das der EKBB dient und ihr in den wirklich wichtigen Dingen hilft, nämlich in der Verbreitung des Wortes Christi. Und ich weiß, dass das Wichtigste auf der Ebene der Kirchgemeinden geschieht. Deswegen möchte ich mich auf die Effektivität der Aktivitäten konzentrieren und offen sein für nötige Veränderungen. Ich würde die Zentrale Kirchenkanzlei gerne so leiten, dass wir die Erwartungen der Kirche erfüllen und so handeln, wie sie es sich wünscht und entsprechend der Richtung, die sie einschlägt. Gleichzeitig freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit ausgezeichneten Kollegen in der Kanzlei und in der Kirche,“ sagt Martin Balcar.
Jiří Hofman
DIE DIAKONIE DER EKBB
 Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Tel: (+ 420) 242 487 811 (812); Fax: (+420) 242 487 834
E-mail: 4gsyQOQ-48xy4794Ys
Internet: www.diakonie.cz
Die Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) ist eine gemeinnützige christliche Organisation, die Hilfe und Unterstützung anbietet für ein würdiges und vollwertiges Leben, auch wenn es durch Alter, Krankheit, gesundheitliche Behinderungen, Isolation, schwierige soziale Situationen und andere Lebenskrisen beeinträchtigt ist. Die Dienste der Diakonie der EKBB erfolgen auf der Grundlage der Botschaft des Evangeliums von der Liebe Gottes und nach dem Vorbild des Dienstes Jesu Christi. In ihren Zentren und Spezial-Schulen bietet die Diakonie soziale, gesundheitliche, Bildungs- und Seelsorgedienste an. Unter den nicht-staatlichen Organisationen, die soziale Dienste anbieten, ist die Diakonie der EKBB die zweitgrösste Institution.
Wir haben Schüler, die an staatlichen Schulen abgewiesen werden
 Ein Gespräch mit Direktor Milan Černý zum Ausbau der Schule für schwerbehinderte Kinder
Ein Gespräch mit Direktor Milan Černý zum Ausbau der Schule für schwerbehinderte Kinder
Vor zehn Jahren erfuhr er von einer Bekannten, dass die Prager Förderschule der Diakonie einen Schulleiter suchte. Er hatte eine Ausbildung für eine solche Position, Erfahrung jedoch nicht. „Ich mag Herausforderungen und vermutete, dass die sich bei der Diakonie reichlich bieten“ – so erklärt Milan Černý, warum er sich schließlich für die Diakonie entschieden hat. Eine der größten Herausforderungen steht derzeit an: Die Förderschule „V Zápolí“ im Prager Stadtteil Michle muss ihre Kapazitäten erheblich erweitern, um mehr Familien mit schwerbehinderten Kindern zu helfen.
Warum muss die Schule „V Zápolí“ erweitert werden und kann nicht so bleiben, wie sie ist?
Das Interesse an der Schule ist groß und in der jetzigen Situation müssen wir sogar
Bewerbungen von Familien aus der nahen Umgebung ablehnen. Wir haben keinen Platz, und es wäre ein Fehler, nichts dagegen zu tun. Je mehr Kinder in unsere Schule gehen, desto mehr Familien können wir unterstützen. Die Förderschule ist für sie eine enorme Hilfe. Wir brauchen in unserer Schule auch dringend eine Turnhalle, die Kinder haben drinnen eigentlich keinen Platz zum Spielen. Für unsere autistischen Schüler fehlt uns zudem ein spezieller Raum, in dem wir sie in Sicherheit beruhigen können. Außerdem planen wir eine Übungsküche, weil wir die Selbständigkeit unserer Schüler bestmöglich fördern wollen – damit sie sich nach dem Abgang von der Schule bestmöglich um sich selbst kümmern können.
Wie viele Schüler wird die Schule aufnehmen können, wenn sie erweitert wird?
Doppelt so viele wie jetzt. Aktuell haben wir 48 Schüler, nach dem Umbau werden es bis zu hundert sein. Wir denken auch über eine Praktische Schule nach. Außerdem wird es im Neubau einen Kindergarten und eine Vorbereitungsstufe für die Grundschule geben, die wir von den anderen Klassen trennen.
Wie kommt das Geld für ein so großes Projekt zusammen?
Da wir in Prag tätig sind, also in einer sehr wohlhabenden Region, haben wir paradoxerweise ein bisschen Pech: Wir bekommen keine Investitionszuschüsse von der Europäischen Union. Die rund 10 Millionen Kronen, die uns fehlen, müssen wir anders auftreiben. Zunächst wenden wir uns mit der Bitte um Hilfe immer an die Familien unserer Schüler. Einige unterstützen uns direkt, andere verbreiten Informationen über den Ausbau in ihrem Umfeld. Ich habe mich auch an Unternehmen gewandt, die uns in der Vergangenheit unterstützt haben. Ich versuche mein Glück auch bei der tschechisch-vietnamesischen Gesellschaft, da vier vietnamesische Schüler unsere Schule besuchen. Aber jeder kann zum Ausbau unserer Schule beitragen. Wir haben auf unserer Webseite ein Spendenformular, über das es möglich ist, einen finanziellen Beitrag zu geben.
Sie haben bereits ein großes Projekt hinter sich, und das ist der neue Schulhof.
Auf den sind wir ungeheuer stolz. Die Familien unserer Kinder haben uns dabei geholfen. Der Vater eines Schülers etwa kam mit einem Bagger in den Garten und beseitigte alle Betonelemente, ein anderer spendete uns 50.000 Kronen. Im Grunde haben uns alle Eltern im Rahmen ihrer Möglichkeiten geholfen, und das weiß ich sehr zu schätzen. Nach und nach haben wir die notwendige Summe zusammengetragen und einen Garten mit vielen Klangspielzeugen, Rutschen, einem Trampolin und verschiedenen Elementen zur motorischen Entwicklung angelegt. Es gibt zudem viel Platz zum Ausruhen und eine schöne Gartenlaube. Und es entstand auch ein Stück Fußweg, auf dem die Kinder Fahrrad und Roller fahren können – das macht ihnen nämlich besonders viel Spaß.
Sind die Prager Förderschulen Ihrer Meinung nach etwas Besonderes?
Wir sind sicherlich insofern außergewöhnlich, als wir uns um Kinder mit den schwersten Behinderungen kümmern. Wir haben Schüler, die niemals an staatlichen Förderschulen aufgenommen würden. Aber wir zeichnen uns auch dadurch aus, dass unsere Mitarbeiter Menschen sind, die diese Arbeit gern machen, die voneinander lernen und sich gegenseitig eine Stütze sein wollen. Und ich denke, das gelingt uns. Jeder von uns trägt etwas dazu bei. Und ich glaube, das wirkt sich irgendwie auch auf unsere Kinder und ihre Eltern aus.
Vendula Janů
DIE EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT DER KARLSUNIVERSITÄT IN PRAG (ETF UK)
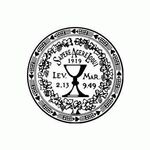 P.O. Box 529, Černá 9,
P.O. Box 529, Černá 9,
CZ 115 55 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 221 988 211; Fax: (+ 420) 221 988 215
E-Mail: 4gGvQOQ_a~km_.~4Ys
Internet: http://web.etf.cuni.cz/ETFENG-1.html
Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Karlsuniversität (ETF UK) ist die Nachfolgerin der Jan-Hus- Fakultät (1919–1950) und der Comenius-Fakultät (1950–1990). Im Jahr 1990 wurde sie in die Karlsuniversität eingegliedert. Die Verwaltung der Fakultät wird vom Dekan und dem Team der Prodekane geleitet, die auf vier Jahre in ihr Amt gewählt werden. Die Fakultät bietet Bakkalaureats- und Master-Studiengänge an – in evangelischer Theologie, Diakonie (Seelsorge und Sozialarbeit), ökumenische Studien, und verschiedene theologische Bereiche auf Doktoranden-Ebene. Die Fakultät ist ökumenisch für alle offen. Pfarrerinnen und Pfarrer der EKBB erhalten hier ihre Ausbildung.
Lohnenswertes Auslandssemester!
 Am 1. Februar 2021, mitten in der Corona-Pandemie, kam ich nach Prag, um ein Semester an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Karlsuniversität zu studieren. Es sah aus, als hätte sich der schwedische Winter mit mir auf die Reise gemacht, denn ich durfte Prag mehrere Tage wunderschön verschneit erleben. Gerade in diesen Tagen organisierten Věra Fritzová und Kristýna Kadlecová von der Fakultät einen Spaziergang zu einigen historischen Stätten. Das war ein großartiger Start in mein Semester in Prag!
Am 1. Februar 2021, mitten in der Corona-Pandemie, kam ich nach Prag, um ein Semester an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Karlsuniversität zu studieren. Es sah aus, als hätte sich der schwedische Winter mit mir auf die Reise gemacht, denn ich durfte Prag mehrere Tage wunderschön verschneit erleben. Gerade in diesen Tagen organisierten Věra Fritzová und Kristýna Kadlecová von der Fakultät einen Spaziergang zu einigen historischen Stätten. Das war ein großartiger Start in mein Semester in Prag!
Und dieses historische Flair ist etwas, das ich während meiner Zeit in Prag so sehr geschätzt habe. Das reiche christliche Erbe macht das Theologiestudium sehr interessant. Systematische Theologie aus der Perspektive eines tschechischen Theologen zu studieren und gleichzeitig selbst in der Tschechischen Republik zu leben, hat meinen Blick auf theologische Ansätze erweitert. Ich erinnere mich, dass wir darüber diskutierten, wie der Kommunismus und die Samtene Revolution die Theologie beeinflusst haben, und über die Art und Weise, wie das tschechische Volk allgemein zum Christentum steht. Und ganz am Ende meines Aufenthaltes, am 21. Juni, durfte ich die Vorführung des Historienfilms Jako letní sníh [Wie Sommerschnee] über den Bischof Johann Amos Comenius auf dem Altstädter Ring erleben. Das war auf den Tag genau 400 Jahre nach der Hinrichtung von 27 Protestanten auf diesem Platz – einem Ereignis, das Comenius’ Leben stark beeinflusst hat.
Neben der historischen Perspektive haben sich auch meine Lehrveranstaltungen an der Fakultät sehr gelohnt. Die Klassen waren klein und alles war online. Aber die Themen waren interessant und zum Nachdenken anregend, und es war äußerst wertvoll, Dinge mit so sachkundigen Lehrern zu diskutieren! Dieses Semester in meinem dritten Bachelorjahr hat mich mehr als jedes andere gelehrt, mein theologisches Wissen bei der Diskussion relevanter Themen einzusetzen. Ich bin meinen Lehrern sehr dankbar, dass sie so viel Raum für Fragen und Diskussionen eröffnet und uns durch die teilweise sehr komplexen Sachverhalte geführt haben. Ich glaube, dies ist etwas, von dem ich in meinem weiteren Studium und in meinem kirchlichen Dienst profitieren werde.
Rückblickend bin ich sehr froh, dass ich trotz Corona nach Prag gekommen bin. Auf diese Weise konnte ich auch den wunderschönen Frühling und den Sommeranfang erleben und einige der unglaublichen Schlösser und putzigen Städte und Dörfer sehen, die im ganzen Land zu finden sind. Und ich weiß, dass ich nicht zum letzten Mal in diesem Land gewesen bin!
Sofia Westerberg
Archäologische Ausgrabungen in Tel Motza
 Im August diesen Jahres machte sich eine Gruppe Pädagogen, Angestellter sowie Studenten der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Karlsuniversität Prag auf zu dreiwöchigen archäologischen Ausgrabungsarbeiten nach Tel Motza. Nach einjähriger pandemiebedingter Pause schließen sich die Arbeiten vor Ort an die Ausgrabungen im Jahr 2019 an.
Im August diesen Jahres machte sich eine Gruppe Pädagogen, Angestellter sowie Studenten der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Karlsuniversität Prag auf zu dreiwöchigen archäologischen Ausgrabungsarbeiten nach Tel Motza. Nach einjähriger pandemiebedingter Pause schließen sich die Arbeiten vor Ort an die Ausgrabungen im Jahr 2019 an.
Tel Motza befindet sich etwa 7 km vom altertümlichen Jerusalem entfernt und entspricht dem biblischen Ort Moza aus Josua 18,26. Archäologische Forschungen fanden hier bereits früher statt, allerdings wurde der Ort est im Jahr 1993 bei Planungsarbeiten für eine neue Straße nach Jerusalem zu einem archäologisch wichtigen Fundort erklärt.
Die Ausgrabungen an diesem Ort finden unter der Leitung von Shua Kisilevitz (Tel Aviv University und Israel Antiquities Authority) sowe Prof. Oded Lipschits (Tel Aviv University) statt. Ebenfalls am Projekt beteiligt sind die Universität Osnabrück in Deutschland sowie die Karlsuniversität in Prag. Außerdem können sich Freiwillige aus der ganzen Welt für das Projekt melden.
Die Ausgrabungen konzentrieren sich auf die Freilegung des Tempelkomplexes aus der Eisenzeit II (10.-6. Jhd. v. Chr.) und verlaufen in zwei Teilen, dem östlichen und dem westlichen. Der östliche Teil ist gekennzeichnet durch Silos, die an den Tempelhof angrenzen und wo in diesem Jahr verschiedene interessante Funde und Kultgegenstände zu Tage traten; im westlichen Teil konzentrierten sich die Forschungen hauptsächlich auf die Auffindung und Freilegung der Westwand des Tempels.
Der an diesem Ort freigelegte Tempel entspricht der biblischen Beschreibung des Ersten Tempels, der allerdings in Jerusalem gelegen haben soll. Aus dieser Sachlage entstehen jedoch verschiedene Fragen. Wie hängen diese beiden Tempel zusammen? Handelt es sich möglicherweise direkt um den Salomonischen Tempel? Handelt es sich um einen anderen wichtigen Tempel oder nur um eine weitere Gebetsstätte? Wem wurde der Tempel geweiht? Und was bedeutet das für die Bibelwissenschaft?
Das Projekt zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass die Mehrheit der am Projekt beteiligten „Ausgräber“ Theologiestudenten oder Theologen sind, die ihre Kenntnisse über zeitgenössische Forschungen der Bibelarchäologie erweitern und ergänzen. Gemeinsam mit Freiwilligen aus der ganzen Welt sowie Einheimischen aus unterschiedlichen Fachgebieten erleben sie ein Stück greifbarer Geschichte, tragen zu archäologischer Forschung bei und gehen körperlich anstregender und gleichzeitg sehr präziser Arbeit nach: vom Graben durch unterschiedliche Schichten und Zerstören der Fundamente jüngerer Gebäude über das Durchsieben von Lehm und das Sammeln verschiedener Keramik- oder Knochenteile bis hin zum Reinigen von Steinen.
Es war sehr spannend, die archäologische Arbeit zu erleben, zu erfahren, was gemessen, genau beschrieben, gezeichnet und dokumentiert wird, wie Keramik gereinigt und identifiziert wird oder wie Proben für verschiedene Analysen genommen werden. Wichtig waren auch die Erklärungen zu den verschiedenen Aspekten, etwa was genau wir ausgruben, warum wir diese oder jene Schicht freilegten, wie wir vorgehen sollten, mit welchen Werkzeugen, zu welchem Zweck etwas geschah und was wir zu erwarten hatten. Vor Ort lieferten diese Erklärungen Fachbetreuer, abseites der Grabungsstätte gab es eine Vielzahl von Fachvorträgen, Workshops, Diskussionen und Exkursionen, die sowohl die Archäologie als auch die Theologie abdeckten.
Für mich vielleicht am Interessantesten war es zu sehen, wie man aus dem „Graben im Lehm“ eine solche Menge an Informationen herausziehen kann. Es war faszinierend, wie aus einigen „uninteressanten“ Steinen, Scherben und Tonstücken, die dem Laien auf den ersten Blick völlig gewöhnlich erscheinen, mit Hilfe diverser Analysen und 3D-Modellierungen eine visuell konkrete Form des Ortes mit eigener Akustik, dem zu erwartenden Einfall von Tageslicht in den Innenraum des Objekts und anderen Details entstehen kann.
Die Arbeiten an der archäologischen Ausgrabungsstätte Tel Motza werden weiter fortgesetzt. Die nächste Saison ist für September 2022 geplant. Die weiteren Arbeiten sollen mehr Licht in die bestehenden historischen Unklarheiten bringen und die Bedeutung dieses jüdischen Tempels offenbaren. Ich denke, wir können uns auf jeden Fall auf viel freuen und werden mehr über den so bedeutenden Fund der Überreste des Tempels in Tel Motza erfahren.
Daniela Stehlíková
Technologie & Religion
 „Der Glaube an die Technologie stellt eine Art moderne Eschatologie dar – den Glauben daran, dass die Technologie den Menschen und mit ihm die Welt rettet“, sagt František Štěch von der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Karlsuniversität.
„Der Glaube an die Technologie stellt eine Art moderne Eschatologie dar – den Glauben daran, dass die Technologie den Menschen und mit ihm die Welt rettet“, sagt František Štěch von der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Karlsuniversität.
Mag. František Štěch, Dr. theol., studierte Theologie an der Südböhmischen Universität in Budweis, wo er bis 2016 lehrte. Erfahrungen sammelte er an mehreren ausländischen Universitäten: in den Niederlanden, in Deutschland und den USA. Er befasst sich mit Fundamentaltheologie, theologischer Interpretation der Landschaft und konzentriert sich auf die Erforschung der Beziehung zwischen Theologie und neuen Technologien. An der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Karlsuniversität leitet er eine internationale Forschungsgruppe zum Verhältnis von Theologie und zeitgenössischer Kultur und lehrt am Ökumenischen Institut.
Um den Einfluss der Technologie auf den Menschen geht es in Ihrem Projekt „Christentum nach dem Christentum: die Erforschung des menschlichen Schicksals im digitalen Zeitalter“. Worum geht es?
Es geht uns um einen ganzheitlichen Ansatz zum Thema menschliche Erfahrung in der Informationsgesellschaft. Die zentrale Hypothese lautet, dass fortschrittliche Informationssysteme nicht nur die menschliche Erfahrung der Welt oder die Konstruktion menschlicher Identität verändern, sondern auch ganze soziale und politische Gruppierungen prägen. Wir glauben, dass Theologie in dieser Situation einen wertvollen Blickwinkel darstellt, um die Veränderungen in der heutigen Welt zu verstehen, einschließlich Phänomenen wie der Digitalisierung oder der Datafizierung aller Dinge.
Versuchen Sie mir zu erklären, inwiefern eine theologische Sichtweise eigentlich nützlich sein kann.
Sie ist das mindestens in zweierlei Hinsicht. Erstens kann Theologie nützlich sein, um die Technologie sowie technologisches Denken zu analysieren und zu kritisieren, und zweitens erinnert sie uns wieder an das Thema Freiheit. Die Theologie will die Technologie nicht einfach kritisieren, sondern das freie Verhältnis des Menschen zur Technologie wiederentdecken. Und damit stellt sich erneut die Frage: „Wer ist der Mensch angesichts neuer Technologien?“ Auch technologisch hochentwickelte Zivilisationen sind nicht frei von religiösen Strukturen und Konzepten. Diese sind oft unauffällig in ihnen versteckt, kommen aber immer irgendwie an die Oberfläche. Der Glaube an die Technologie stellt eine Art moderne, säkularisierte Eschatologie dar – den Glauben daran, dass die Technologie den Menschen und mit ihm die Welt rettet. Manche setzen sogar neue religiöse Bewegungen in Gang und beten eine sogenannte technologische Singularität an – also den Wendepunkt, an dem die Fähigkeiten von Maschinen die Fähigkeiten des Menschen übersteigen. Es gibt zum Beispiel eine Sekte namens Weg der Zukunft, die vom ehemaligen Google-Entwickler Anthony Levandowski gegründet wurde. Ihre Mitglieder glauben an die Göttlichkeit der künstlichen Intelligenz. Aber selbst der Zukunftsforscher Ray Kurzweil glaubt daran, dass man dank der Entwicklung der Technologie Unsterblichkeit erlangen kann.
Was ist interessiert Theologen noch an diesem Thema?
Ein weiteres Thema ist zum Beispiel die Schöpfung. Ein Mensch, der seine Freiheit in schöpferischer Weise verwirklicht, schafft neue Technologien, um sein Leben einfacher und angenehmer zu machen, und wird so zum Gestalter – wenn Sie so wollen, zum Schöpfer – von Technologien. Natürlich will er die Kontrolle über seine Schöpfung behalten. Aber ist es möglich, alles, was wir erschaffen, vollständig zu kontrollieren? Die Fähigkeit, menschliches Verhalten vorherzusagen, wurde Gott (Leibniz) oder Engeln (Thomas von Aquin) zugeschrieben. Heute konkurrieren die Algorithmen technologischer Kolosse wie Google, Amazon oder Facebook tüchtig mit ihnen.
Religion trifft auf Technologie. Wie verändern sich dadurch das Christentum und seine Theologie?
Ich weiß nicht, ob es schon möglich ist zu sagen, wie sich das Christentum und seine Theologie in Abhängigkeit von neuen Technologien genau verändern. Aber ich bin überzeugt, dass sie sich ändern. Vielleicht könnten wir dies am Beispiel der Begegnung von Religion mit einem technischen Schlüsselmedium wie dem Internet veranschaulichen. Der amerikanische Soziologe Christopher Helland hat in der jüngeren Vergangenheit zwischen Religion online und Online-Religion unterschieden. Erstere könnte als statische Präsenz von Religion oder religiösen Inhalten im Internet bezeichnet werden. Also zum Beispiel Internetseiten von Pfarreien oder Kirchengemeinden und dergleichen. Diese bleibt natürlich bestehen, aber die allmähliche Verbesserung der Technologie hat ungefähr in den letzten zwei Jahrzehnten das Aufkommen einer „Online-Religion“ ermöglicht. Als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie wurden viele kirchliche Aktivitäten in einen virtuellen Raum verlegt. Während die Online- Übertragung von Gottesdiensten früher eine Ausnahme war, ist sie in diesem Jahr gängige Praxis und betrifft alle.
Interessierten Sie konkrete Ausprägungen dieses Trends?
Ein römisch-katholischer Geistlicher aus Maryland reagierte kreativ auf die aktuelle Situation und bot seinen Gläubigen ein Drive-Through-Sakrament der Versöhnung an, die Beichte. Das heißt, „Service“ mit Bedienung bis zum Auto, um die vorgeschriebenen Abstände für soziale Kontakte einzuhalten. Viel wird in diesem Zusammenhang auch über die Möglichkeit gesprochen, das Sakrament der Versöhnung online oder telefonisch zu erteilen. Und damit verbunden ist das Thema, Roboter zur Ausübung eines geistlichen Berufes einzusetzen. In einem buddhistischen Tempel in Kyoto in Japan gibt es bereits einen geistlichen Roboter namens Mindar, der die Gläubigen segnet und sogar ein geistliches Gespräch mit ihnen führen kann! 2017 wurde anlässlich des Jubiläums der Reformation vor 500 Jahren in Deutschland der Roboter BlessU-2 programmiert, der Gläubige segnet. In fünf Sprachen.
Ist nicht schon der Gedanke, dass ein Geistlicher von einem Roboter vertreten werden könnte, einigermaßen ketzerisch?
Es mag manchen so erscheinen, aber ich denke hier an den heiligen Paulus, der im ersten Brief an die Thessalonicher (5,21) schreibt: „Prüft aber alles und das Gute behaltet.“ Und das kommt mir in diesem Zusammenhang wie eine wichtige Aufforderung vor. Persönlich kann ich mir vorstellen, dass künstliche Intelligenz in Zukunft Geistliche in christlichen Kirchen beim Verfassen von Predigten unterstützen oder sie bei dieser Tätigkeit eventuell komplett ersetzen kann. Es ist auch möglich, einen Roboter so zu programmieren, dass er – und zwar absolut genau – eine rituelle Handlung ausführt. Es klingt vielleicht nicht so ketzerisch wie amüsant, aber es wirft ernsthafte Fragen auf: Was sind Wesen und Zweck einer Kirchenpredigt? Wie ist eigentlich die Rolle eines Geistlichen gegenwärtig zu verstehen? Was ist wesentlich für sie? Was ist das Wesen des Priestertums? Und so weiter.
Kann dann der Glaube, der sich zwischen Gott und dem Menschen abspielt, nicht zum Glauben zwischen Gott, dem Computer und dem Menschen werden?
Die christliche Theologie vertritt den Schöpfungsgedanken. Sie knüpft dabei an die ältere jüdische Tradition an und behauptet, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde. Die These, dass der Mensch Imago Dei ist, wird gerade durch die schöpferischen Fähigkeiten des Menschen erhärtet, die aus dieser Sicht gewissermaßen das Werk Gottes widerspiegeln. Menschen sind wie Gott. Kann es nicht passieren, dass wir in dem Bemühen, wie Gott zu sein, künstliche Intelligenz nach unserem Bilde schaffen? Damit ein Computer (oder computergesteuerter Roboter) wie ein Mensch werde? Die Entwicklung künstlicher Intelligenz wird für christliche Kirchen zu einem sehr interessanten Thema. Und das nicht nur in ethischer Hinsicht. Fragen zur Entwicklung der künstlichen Intelligenz können uns helfen, nicht nur das Wesen des Menschseins, sondern auch das Wesen des religiösen Glaubens nochmals zu überdenken.
Jiří Novák
