Bulletin 53 – Sommer 2021
Der Leitarikel
Liebe Freunde, liebe Leserinnen und Leser,
in unserer letzten, Oster-Nummer, konnte ich nicht anders als mich auch dem Thema Covid-19 zu widmen. Im Frühjahr waren die statistischen Zahlen, wenigstens in Tschechien, ziemlich alarmierend. Seit dieser Zeit hat sich die Situation um ein Vielfaches verbessert und aufgrund der zugänglichen Daten habe ich den Eindruck, dass es anderswo auch so ist, wenigstens in Europa.
So eine „Pest-Attacke“ haben wir bis jetzt noch nicht erlebt, so lassen Sie uns hoffen, dass wir daraus Lehren gezogen haben. Und es bleibt uns nichts anders übrig als zu hoffen, dass sich nach den Sommerferien nicht das letztjährige Szenario wiederholt! Aber wie steht es mit der weiteren „Pest-Attacke“ – in Weissrußland? Dort hat sich seit Ostern überhaupt gar nichts verändert, und das Szenario ist immer noch einund das selbe.
Wir sind machtlos, wir können fast nichts tun. Zu beiden Themen kehren wir in diesem Bulletin zurück – in einer „Schweigeminute“ und einem Bericht von zwei weissrussischen Gottesdiensten.
Und was ich noch gerne erwähnen würde, das ist das Thema LGBT. Denn in unserer Kirche ist uns diese Gemeinschaft nicht gleichgültig, bis jetzt haben wir auf diesem Gebiet drei Diskussionen organisiert und es kann uns erfreuen, dass daran unter den Evangelischen Interesse besteht.
 Es tun sich auch positive Dinge.
Es tun sich auch positive Dinge.
Halten wir uns an der Hoffnung und Gottes Friede sei uns nahe.
Mit vielen guten Wünschen für den ganzen Redaktionsrat
Jana Plíšková
DIE EVANGELISCHE KIRCHE DER BÖHMISCHEN BRÜDER
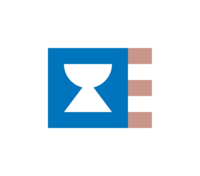 P.O. Box 466, Jungmannova 9,
P.O. Box 466, Jungmannova 9,
CZ 111 21 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 224 999 215(216); Fax: (+ 420) 224 999 219
E-Mail: ekumena@e-cirkev.cz
Internet: www.e-cirkev.cz
Die Grundlagen der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) wurzeln in der Utraquistischen Kirche (1431–1620) und in der Brüderunität ((1457–1620). Die EKBB entstand in ihrer heutigen Gestalt im Jahr 1918 durch den Zusammenschluss der bis dahin selbständigen evangelischen Kirchen Augsburger und Helvetischen Bekenntnisses. Deren Existenz wurde nach dem Ende der harten Gegenreformation, die von 1620 bis zum Erlass des Toleranzpatens durch Kaiser Joself II. im Jahr 1781 dauerte, erlaubt. Die strengen Beschränkungen mussten die Evangelischen freilich auch danach beachten, bis zum Erlass des Protestantenpatentes im Jahr 1861.
In der Zeit ihrer Entstehung hatte die EKBB 250 000 Mitglieder, im Jahre 1938 waren es dann schon 325 000 Mitglieder. Heute ist die Kirche in 14 Seniorate aufgeteilt mit einer Gesamtzahl von 250 Gemeinden und ca. 80 000 Gemeindegliedern. Die Kirche wird vom sechsköpfigen Synodalrat geleitet, der auf sechs Jahre gewählt wird. Repräsentiert wird die Kirche vom Synodalsenior und vom Synodalkurator.
Schweigeminute...
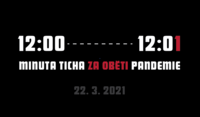 Am Donnerstag, den 4. März schickte der Synodalrat der EKBB den Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen in der gesamten Republik folgende Botschaft:
Am Donnerstag, den 4. März schickte der Synodalrat der EKBB den Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen in der gesamten Republik folgende Botschaft:
An die Ärzte, Krankenschwestern und -brüder, Sozialarbeiter, Pfleger, Sanitäter und alle weiteren Angestellten in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen
„Verehrte und liebe Leser, in dieser Zeit einer allseits wütenden Pandemie tragen Sie auf Ihren Schultern einen großen Teil der Last, die uns alle trifft. Sie arbeiten aufopferungsbereit an vorderster Front und direkt im Angesicht des Leids dieser Pandemie. Sie müssen mehr denn je der Tatsache ins Auge sehen, dass Ihre Patienten sterben, dass materielle und menschliche Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen, begrenzt sind. Wir versichern Ihnen, diese Last ist unser aller Last. Wir wissen, dass Sie alles in Ihrer Kraft stehende tun, vielmehr sogar als man von Ihnen verlangen und erwarten kann. Aber oft liegt es nicht in der Hand des Menschen den Tod zu verhindern. Und es ist ausgesprochen schwer diese Grenze und Machtlosigkeit anzunehmen.
Wir denken an Sie mit Verständnis, mit Bewunderung, mit Liebe. Einzeln, sowie in der Gemeinschaft unserer Pfarrgemeinden beten wir für die Genesung der Kranken, für die Linderung ihrer Leiden und ihres Sterbens, wir beten für Geduld und Hoffnung der ihr Nahestehenden und auch für Kraft und Hoffnung für Sie, Ärzte, Schwestern und Pfleger.
Von ganzem Herzen wünschen wir Ihnen, dass Sie Beistand bei Ihren Freunden, Vorgesetzten, Nachbarn finden und dass Ihnen wertvolle fachliche Hilfe zuteil wird, sei es durch Supervision, Psychotherapie oder geistliche Unterstützung.
Unsere Kaplane und Pfarrer in den Krankenhäusern stehen nicht nur Gläubigen zur Verfügung, sondern jeder auf der Suche nach Verständnis, Stärkung und Ermunterung kann sich an sie wenden. Wir sind uns sicher, dass auch andere Kirchen das so handhaben. Gott segne Euch.“
Am Montag, denn 22. März 2021 zu Mittag hielt das Leben in Tschechien für eine symbolische Minute still. Vielerorts ertönte Kirchengeläut. Tschechien gedachte mit einer Schweigeminute den Opfern der Corona-Pandemie.
Im Verlauf der letzten zwölf Monate starben im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie in Tschechien fast 25.000 Menschen. Viele weitere Opfer finden sich in den Statistiken nicht wieder. Dabei ist diese Zahl bei weitem noch nicht endgültig.
„Wir sind überzeugt davon, dass in der geteilten Trauer und Erinnerung an die Opfer unsere Gesellschaft einen Weg findet, besser und mit mehr Würde aus dieser Pandemie in die Zukunft zu schreiten, die uns danach erwartet. Die Erinnerung an die Opfer sollte nicht erlischen,“ so erläuterten die Organisatoren das Ziel der gesamtgesellschaftlichen Initiative. „Der Moment der Trauer dient nicht dazu Schuldige zu suchen oder irgendwelche Einzelinteressen hervorzuheben. Die Trauer und der Tod aus der Zeit der Pandemie sind aus unserem kollektiven Gedächtnis nicht mehr zu löschen. Die Schweigeminute für die Opfer der Pandemie ist ein Akt der Solidarität und eine Ehrerweisung für die Opfer und ihre Hinterbliebenen. Sie soll aber auch Dankbarkeit für das Leben ausdrücken, dessen Wert wir in dieser Zeit bewusster wahrnehmen als je zuvor.“
Jiří Hofman
Unterstützung für Unterdrückte in Belarus
 Anfang des Jahres rief der Synodalrat der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder zur Unterstützung der unterdrückten Opposition in Belarus auf.
Anfang des Jahres rief der Synodalrat der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder zur Unterstützung der unterdrückten Opposition in Belarus auf.
„Mit Beunruhigung verfolgen wir die angespannte Situation in Belarus. Über viele Monate schon finden Demonstrationen gegen das diktatorische Regime von Präsident Lukaschenko statt. Obwohl die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen im letzten August offensichtlich gefälscht wurden, weigert sich das Regime zurückzutreten. Die Regimegegner sehen sich stattdessen mit dauerhafter Unterdrückung konfrontiert: Es gibt glaubwürdige Zeugenberichte über hunderte Fälle von körperlicher Gewalt, Folter und Vergewaltigung der Demonstrierenden. Unsere eigene schwierige Situation in der Pandemie darf uns nicht den Blick auf alle jene Orte der Welt trüben, an denen Ungerechtigkeit, Verfolgung und Unfreiheit an der Tagesordnung sind. Auf die Krise in Belarus wollen wir in der Öffentlichkeit auch innerhalb der Europäischen Union und über internationale ökumenische Organisationen aufmerksam machen. Wir suchen Wege für konkrete finanzielle Unterstützung,“ so der Appell der Leitung der Evangelischen Kirche im Januar dieses Jahres.
„Unsere heutige Botschaft an alle Belarussen, die sich gegen das Gewaltregime stellen, lautet: Wir nehmen Euch wahr, wir sind bei Euch, sprechen über Euch und beten für Euch. Und das tun wir öffentlich, sodass Ihr davon erfahrt, sodass unsere Mitbürger davon erfahren, genauso wie unsere Regierung und alle jene auf der Welt, zu denen unsere Stimme dringt,“ so der stellvertretende Synodalsenior Pavel Pokorný, der daran erinnerte, dass insbesondere das Gebet ein Raum der Gedankenfreiheit ist.
Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder unterhält Beziehungen zur belarussischen Gemeinschaft in der Tschechischen Republik und verfolgt innerhalb einer Kommission für Menschenrechte und durch den Minderheitenpfarrer Mikuláš Vymětal die gewaltsame Unterdrückung der Opposition in Belarus.
Am letzten Donnerstag im März, dem 103. Jahrestags der belarussischen Unabhängigkeit, fand in der Kirche des Hl. Salvator in Prag der zweite belarussische ökumenische Gottesdienst statt.
Jiří Hofman
Neuer Synodalrat gewählt
 Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder wählte am 21. Mai 2021 in Prag auf der Synode ihre neue Leitung. Im Synodalrat werden Pfarrer Pavel Pokorný (als Synodalsenior), Ondřej Titěra und Roman Mazur zusammenwirken. Aus den Reihen der Laien erhielten Jiří Schneider (gewählt als Synodalkurator), Jana Šarounová und Simona Kopecká das Vertrauen. Die Amtszeit der neugewählten Kirchenleitung beginnt am 22. November 2021.
Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder wählte am 21. Mai 2021 in Prag auf der Synode ihre neue Leitung. Im Synodalrat werden Pfarrer Pavel Pokorný (als Synodalsenior), Ondřej Titěra und Roman Mazur zusammenwirken. Aus den Reihen der Laien erhielten Jiří Schneider (gewählt als Synodalkurator), Jana Šarounová und Simona Kopecká das Vertrauen. Die Amtszeit der neugewählten Kirchenleitung beginnt am 22. November 2021.
Jiří Hofman
Die Debatte über die Homo-Ehe: spät aber dennoch
 Die Kommission für den Dialog mit der LGBTQ+ Community hat drei Online-Diskussionen in Form eines moderierten Interviews vorbereitet. Diese hatten ein recht klares Ziel: die Debatte über Positionen zur Homo-Ehe in unserer Kirche eröffnen. Der Zahl der Zuschauer*innen nach lässt sich sagen, dass es innerhalb der Evangelischen Kirche ein großes Interesse gibt.
Die Kommission für den Dialog mit der LGBTQ+ Community hat drei Online-Diskussionen in Form eines moderierten Interviews vorbereitet. Diese hatten ein recht klares Ziel: die Debatte über Positionen zur Homo-Ehe in unserer Kirche eröffnen. Der Zahl der Zuschauer*innen nach lässt sich sagen, dass es innerhalb der Evangelischen Kirche ein großes Interesse gibt.
Die erste Diskussion fand am Mittwoch, den 10. Februar statt und trug den Titel „Biblische, theologische, ethische und psychologische Aspekte der Homosexualität“. Zu Gast waren die Psychotherapeutin Dagmar Křížková, der Ethiker Jindřich Halama und der Bibelwissenschaftler Martin Prudký, die Diskussion wurde von Pfr. Mikuláš Vymětal, dem kirchlichen Beauftragten für Minderheiten moderiert.
Die Diskussion thematisierte das Dokument „Die Problematik homosexueller Beziehungen,“ das von der Kirche im Jahr 2006 im Anschluss an die 1. Sitzung der 30. Synode (Mai 2004), herausgegeben wurde. Alle drei Gäste waren an der Vorbereitung dieses Dokuments beteiligt und sie sollten sich in der Diskussion, jetzt nach 15 Jahren, zu dem Dokument äußern. Alle vertreten den gleichen Standpunkt zu dieser Thematik: Homosexualität ist keine Krankheit und für Christ*innen handelt es sich nicht um ein Problem.
Martin Prudký erinnerte am Anfang, dass alle Texte des Alten und Neuen Testaments, die als Beweis für die Abscheulichkeit gleichgeschlechtlicher Liebe bezeichnet werden, im Kontext der Zeitperiode zu verstehen sind. Wichtig ist es zu betonen, dass die Bibel eigentlich den Begriff homosexuelle Orientierung gar nicht kennt. Sie kennt nur homosexuelle Handlungen, die fast in allen Texten als Form von Gewallt und Dominanz verstanden werden.
Jindřich Halama ist der Meinung, dass Homosexualität nicht das wichtigste Thema der christlichen Glaubenslehre ist, es ist viel mehr ein Thema der Seelsorge.
Dagmar Křížková präsentierte die sexologische/medizinische Sichtweise. Die sexuelle Orientierung ist angeboren, man kann sie mit medizinischen Maßnahmen nicht ändern. Alle Versuche, sie zu heilen, sind gescheitert, die Weltgesundheitsorganisation hat die Homosexualität schon im Jahr 1990 aus der Liste der Geisteskrankheiten gestrichen.
Die zweite Diskussionsrunde fand am Mittwoch, den 24. Februar unter dem Titel „Wie ergeht es lesbischen und schwulen Menschen in der Kirche und in der Tschechischen Gesellschaft“ statt. Diesmal waren konkrete Lebensgeschichten das Thema.
Mehrere Menschen haben die Einladung angenommen, darunter das Ehepaar Pospíšil, die Eltern einer jungen lesbischen Frau, desweiteren zwei Mitglieder der christlichen LGBT Community, Zdeněk Turek, Theaterschauspieler und Hilfspfarrer der EKBB, und Veronika Dočkalová, Vorsitzende des Vereins Logos. Außer der Katholikin Veronika Dočkalová sind alle Gäste aktive Kirchenmitglieder der EKBB. Die Debatte wurde wieder von Mikuláš Vymětal, dem Pfarrer für Minderheiten, moderiert.
Gleich zu Beginn entwickelte sich eine Diskussion zum Thema Coming out, dem Moment, in dem ein Mensch seine sexuelle Orientierung öffentlich bekannt macht. Eine interessante Perspektive zeigte das Ehepaar Pospíšil, die den Coming out von der anderen Seite her erlebten, also als Empfänger der Nachricht ihrer Tochter. „Wenn ich mich daran erinnere, brachte die Erklärung unserer Tochter über ihre Sexualität vor allem Erleichterung, weil all die Dinge, die wir irgendwie gefühlt hatten, auf einmal klare Realität wurden,“ sagte Lenka Pospíšilová.
Desweiteren wurde das bedeutende Thema der Wahrnehmung homosexuell orientierter Menschen in der Kirche diskutiert. Veronika Dočkalová erzählte von oft schmerzvollen Situationen in der Römisch-katholischen Kirche: „Als ich mich auf die Firmung vorbereitet habe, traf ich auf die Wand des Katholischen Rechts und des Katechismus, die mir klar sagten: Du gehörst hier nicht so ganz hin.“ Zu der Situation in der Katholischen Kirche fügte sie hinzu: „Falls jemand in einer stabilen Beziehung mit einem gleichgeschlechtlichen Partner oder einer gleichgeschlechtlichen Partnerin lebt, hat er oder sie keinen Zutritt zu den Sakramenten. Ich finde das äußerst bizarr. Falls ein Mensch einzelne Erfahrungen mit gleichgeschlechtlichen Partner*innen gemacht hat und sie in der Beichte aufrichtig bereut, hat er oder sie Zugang zu allen Sakramenten. Wenn aber herauskommt, dass der Mensch eine stabile Liebesbeziehung mit dem Partner oder der Partnerin hat, ist er für die Kirche praktisch nicht mehr von Bedeutung. Aus meiner Sicht handelt es sich dabei um Förderung der Promiskuität auf Kosten von stabilen Beziehungen.“ Auf Hürden im evangelischen Umfeld ist wiederum Zdeněk Turek gestoßen, der gleich mit mehreren Kirchen Erfahrungen gemacht hat, darunter die Brüderkirche und die Siebenten-Tags-Adventisten. Auch er erlebte unangenehme Situationen und traf auf Unverständnis.
Wie das Ehepaar Pospíšil betonte, ist es eine Tatsache, dass die EKBB Homosexualität nicht als Sünde wahrnimmt. Im Kontext anderer tschechischer Kirchen handelt es sich dabei aber um eine Minderheitsposition. Als Beweis für das Dialogbedürfnis im kirchlichen Umfeld kann auch das ökumenische und sogar internationale Interesse gewertet werden: Die Debatte wurde von Laien und einigen Geistigen verfolgt; aus dem Ausland hat sich zum Beispiel eine slowakische lutherische Pfarrerin gemeldet, der wegen ihrer Offenheit gegenüber Menschen der LGBT-Comunity, die Gefahr droht, dass ihr die Erlaubnis geistlicher Betätigung in ihrer Kirche entzogen wird.
Die Diskussion brachte keine klaren Antworten, und zwar absichtlich, wie man anfügen muss. Der Zweck war nicht eine klare Positionierung oder das „Markieren des Spielfeldes“. Ziel war es, Raum für Diskussion zu schaffen und offen über das Thema zu debatieren.
Die dritte Diskussion fand am Mittwoch, den 14. April 2021 statt.
Das Gespräch wurde von Pavel Pokorný, dem Stellvertreter des Synodalseniors der EKBB, moderiert und zu Gast waren: Ivan Eľko, Generalbischof der Evangelischen Kirche A. B. in der Slowakei, Benigna Carstens, Mitglied der Leitung der Brüder-Unität im deutschen Herrnhut, und Ondřej Stehlík, Pfarrer der Presbyterianischen Kirchgemeinde in New York.
Die Vertreter der internationalen Kirchen sprachen über ihre Standpunkte und Einstellungen zur Homosexualität, über die Erfahrungen mit dem Dialog innerhalb der Kirche und der Gesellschaft und über die Suche nach einem Konsens.
Ema Pospíšilová, Adéla Rozbořilová
DIE DIAKONIE DER EKBB
 Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Tel: (+ 420) 242 487 811 (812); Fax: (+420) 242 487 834
E-mail: info@diakonie.cz
Internet: www.diakonie.cz
Die Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) ist eine gemeinnützige christliche Organisation, die Hilfe und Unterstützung anbietet für ein würdiges und vollwertiges Leben, auch wenn es durch Alter, Krankheit, gesundheitliche Behinderungen, Isolation, schwierige soziale Situationen und andere Lebenskrisen beeinträchtigt ist. Die Dienste der Diakonie der EKBB erfolgen auf der Grundlage der Botschaft des Evangeliums von der Liebe Gottes und nach dem Vorbild des Dienstes Jesu Christi. In ihren Zentren und Spezial-Schulen bietet die Diakonie soziale, gesundheitliche, Bildungs- und Seelsorgedienste an. Unter den nicht-staatlichen Organisationen, die soziale Dienste anbieten, ist die Diakonie der EKBB die zweitgrösste Institution.
Von der Kritik zur Tat. Warum man sich in Svitavy entschlossen hat, eine Diakonie zu gründen und ein Seniorenheim zu errichten
 Man erzählt sich Folgendes: Als die Diakonie vor dreißig Jahren ihre Tätigkeit wiederaufnahm, sind wie aus dem Nichts neue Schulen und Zentren entstanden und zwar dank des Enthusiasmus von Mitgliedern der evangelischen Kirche. Heute ist das anders, wenn auch nicht völlig. Auch im 21. Jahrhundert entstehen neue Diakoniezentren auf der grünen Wiese.
Man erzählt sich Folgendes: Als die Diakonie vor dreißig Jahren ihre Tätigkeit wiederaufnahm, sind wie aus dem Nichts neue Schulen und Zentren entstanden und zwar dank des Enthusiasmus von Mitgliedern der evangelischen Kirche. Heute ist das anders, wenn auch nicht völlig. Auch im 21. Jahrhundert entstehen neue Diakoniezentren auf der grünen Wiese.
In diesem Falle ist es nicht gerade eine grüne Wiese, eher ein musterhaft begradigtes Baugelände. Ursprünglich stand hier ein verlassenes Gut, das von Abbruchmaschinen abgerissen wurde. Wir sind unweit von Svitavy in der Gemeinde Vendolí. Von hier aus hat man eine schöne Aussicht auf die Felder und den Wald. Gleich nebenan gibt es ein Lebensmittelgeschäft. Und wenn alles nach Plan verläuft, wächst hier in relativ kurzer Zeit ein neues Seniorenheim. Unter der Leitung der Diakonie Svitavy, was im Rahmen der diakonischen Familie ein Novum ist. Dessen Geburtsstunde schlug vor einigen Jahren in der Kirchgemeinde Svitavy. Im dortigen Pfarrhaus lebt das Ehepaar Keller. Filip Keller ist evangelischer Pfarrer, seine Frau Květa Juristin.
Gemeinsam mit anderen gingen sie im Ort ältere und kranke Gemeindeglieder besuchen. Häufig auf einer Pflegestation (im Tschechischen bekannt unter der Abkürzung LDN - Langzeitpflege). Als sie ihre Erfahrungen untereinander austauschten, waren sie sich einig, dass dieses Umfeld kein gutes Gefühl bei ihnen hinterlässt. Man hatte den Eindruck, die menschliche Würde leidet. Die anderen Mitglieder der Pfarrgemeinde sahen das ähnlich. „Aber uns ist noch nicht eingefallen, dass wir damit etwas machen könnten,“ sagt Květa Kellerová. „Es war eher ein gemeinsames Kritisieren.“
Dann kam ein Ausflug nach Nosislav bei Brünn. Die Brünner Diakonie hat dort zusammen mit den Protestanten vor Ort ein kleines Geschütztes Wohnheim für Senioren gebaut, so konzipiert, dass es einen gemeinsamen Haushalt nachahmt. Es steht unweit des Pfarrhauses, ungefähr in Dorfmitte. Nicht weit entfernt liegt der Weinberg. Die Führung hat die Besucher aus Svitavy beeindruckt.
Als es im April 2018 zu einem weiteren von vielen Besuchen auf der Pflegestation von Svitavy kam, wo ein Mitglied der Pfarrgemeinde untergebracht war, nur weil für ihn kein Platz in einer würdevolleren Umgebung gefunden werden konnte, kam es zu einer Wende. „Wenn sie das in Nosislav geschafft haben, schaffen wir das auch,“ erinnert sich Květa Kellerová an den Moment, in dem die Entscheidung fiel, dass auf die Kritik Taten folgen müssen. Es begannen vorbereitende Arbeiten, was heutzutage vor allem bedeutet, dass man verhandelt und verhandelt und verhandelt … und verhandelt.
„Wir wollten nicht, dass das Ganze Sache eines kleines Kreises von Enthusiasten bleibt,“ sagt Květa Kellerová. Zuerst war es nötig, für die Idee, ein neues Seniorenheim zu bauen, die Gemeindeglieder zu gewinnen. Ihr Vorstand (der Ältestenrat) unterstützte den Vorschlag eindeutig und beauftragte eine Arbeitsgruppe mit den Verhandlungen. Und die machte sich auf den Weg zur Geschäftsleitung der Diakonie, ausgestattet mit dem starken Argument, dass der Bezirk Pardubice, in dem Svitavy liegt, der letzte tschechische Bezirk ist, in dem die Diakonie nicht wirkt, und dass jetzt die Gelegenheit ist, dies zu ändern. Nach Abwägen verschiedener Varianten wurde beschlossen, dass die Geschäftsleitung der Diakonie selbst die Schirmherrschaft über das Bauprojekt in Vendolí übernimmt.
Und dann ging es zur Stadt und dann zum Bezirk. Květa Kellerová lud zusammen mit der Arbeitsgruppe alle Träger sozialer Dienste in der Stadt ein, um ihnen das Vorhaben vorzustellen, insbesondere, um den möglichen Eindruck zu zerstreuen, dass hier irgendein kirchliches Soloprojekt ohne Rücksicht auf alle anderen entsteht. Die Stadt wurde um Unterstützung angefragt. Erfolgreich.
Es klingt einfach und es lässt sich in wenigen Zeilen beschreiben. Dahinter stehen jedoch viele, viele Stunden des Überlegens, des Rechnens, des Vorbereitens von Unterlagen, des geduldigen Erklärens – ein Arbeitsumfang, der einen Einzelnen unter sich begraben würde. Mitstreiter sind notwendig. Květa Kellerová nennt in diesem Zusammenhang einen wichtigen Namen – Jiří Brýdl, emeritierter Senator, Bürgermeister von Svitavy, Bezirksabgeordneter und Mitglied des Ältestenrates der Kirchgemeinde Svitavy. Hinsichtlich seiner Berufserfahrung stellt er bei den Verhandlungen mit verschiedenen Institutionen eine vertrauenswürdige Autorität dar. Auch ihm ist es zu verdanken, dass gute Verbindungen zum Bezirk geknüpft werden konnten, so dass das künftige Heim in Vendolí bereits jetzt ins sogenannte Netz von Trägern sozialer Dienste des Bezirks eingefügt ist, was für die künftige Finanzierung ungemein wichtig ist.
Der Architekt Radim Oblouk sollte die Vorschläge für das neue Heim ursprünglich nur konsultieren. Die Zusammenarbeit im Team hat ihn jedoch so sehr angesprochen, dass er heute dasjenige Teammitglied ist, das am stärksten ausgelastet ist. Das geamte Haus entwarf er nach dem Vorbild der Seniorenheime in Graz und Leoben. Am wichtigsten ist die Innengestaltung des Hauses, die in offenen gemeinsamen Wohnräumen besteht. In sie gelangt man direkt aus den Zimmern der Bewohner. So enstehen zwei „Haushalte“ von zehn bis elf Mitgliedern.
Als der Entwurf fertig war, begann eine weitere Verhandlungsrunde direkt in der Gemeinde Vendolí, die für das Projekt ein Grundstück anbot, denn ein Seniorenheim ist seit langem Plan des Ortes. Seine finale Gestalt betrachtete der Rat der Kommune jedoch mit gemischten Gefühlen. „Wir wussten, dass es nicht leicht wird,“ sagt Květa Kellerová. In dem schmucken Ort legt man Wert darauf, dass alle Häuser traditionelle Satteldächer haben. Der Architekt war bemüht, dies wenigsten teilweise zu berücksichtigen. Die heutigen Ansprüche an Gebäude, in denen Energie gespart werden muss, verlangen jedoch nach einer anderen Disposition. Einige Vertreter der Kommune waren darum unzufrieden. Es begann eine weiter Runde des Erklärens und des Verhandelns, die von September bis Dezember vergangenen Jahres andauerte. Am Ende aber erlangte das Projekt im Rat der Kommune die Mehrheit.
Aber es ist noch lange nicht fertig. Der Architekt hat nämlich damit begonnen, dass Heim so umzuarbeiten, dass es den Standart eines Passivhauses erfüllt, also keinerlei Energie benötigt. Das ist eine der Bedingungen, um EU-Förderung zu bekommen, die bis zu 85 % der Baukosten decken sollte. Damit sind weitere Komplikationen verbunden, u.a. die Notwendigkeit, eine neue Baugenehmigung zu beantragen und die Bedingung, den Bau bis Ende 2023 fertigzustellen. „Wie wir es auch drehen und wenden, immer kommt heraus, dass es sehr schade wäre, das nicht zu versuchen. Auch wenn wir damit ein erhebliches Risiko auf uns nehmen,“ sagt Květa Kellerová, die bereit ist, das fertige Heim zu leiten.
Adam Šůra
DIE EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT DER KARLSUNIVERSITÄT IN PRAG (ETF UK)
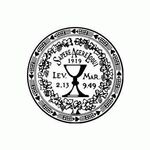 P.O. Box 529, Černá 9,
P.O. Box 529, Černá 9,
CZ 115 55 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 221 988 211; Fax: (+ 420) 221 988 215
E-Mail: intl@etf.cuni.cz
Internet: http://web.etf.cuni.cz/ETFENG-1.html
Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Karlsuniversität (ETF UK) ist die Nachfolgerin der Jan-Hus- Fakultät (1919–1950) und der Comenius-Fakultät (1950–1990). Im Jahr 1990 wurde sie in die Karlsuniversität eingegliedert. Die Verwaltung der Fakultät wird vom Dekan und dem Team der Prodekane geleitet, die auf vier Jahre in ihr Amt gewählt werden. Die Fakultät bietet Bakkalaureats- und Master-Studiengänge an – in evangelischer Theologie, Diakonie (Seelsorge und Sozialarbeit), ökumenische Studien, und verschiedene theologische Bereiche auf Doktoranden-Ebene. Die Fakultät ist ökumenisch für alle offen. Pfarrerinnen und Pfarrer der EKBB erhalten hier ihre Ausbildung.
Wie das Theologiestudium den eigenen Glauben erschüttern kann. Ein Gespräch mit dem Prodekan der Evangelisch-Theologischen Fakultät Ladislav Beneš
 Die Evangelisch-Theologische Fakultät ist Teil der Karlsuniversität und eine von drei theologischen Fakultäten. Im Jahr 2019 feierte sie ihr hundertjähriges Bestehen. Wie sie zur Zeit aufgestellt ist, wie das Studium dort aussieht und wie neue Studenten gewonnen werden, sind Themen, über die wir mit dem Prodekan für Studienangelegenheiten, praktischen Theologen und Pfarrer Ladislav Beneš gesprochen haben.
Die Evangelisch-Theologische Fakultät ist Teil der Karlsuniversität und eine von drei theologischen Fakultäten. Im Jahr 2019 feierte sie ihr hundertjähriges Bestehen. Wie sie zur Zeit aufgestellt ist, wie das Studium dort aussieht und wie neue Studenten gewonnen werden, sind Themen, über die wir mit dem Prodekan für Studienangelegenheiten, praktischen Theologen und Pfarrer Ladislav Beneš gesprochen haben.
Als ich Mitte der Neunziger Jahre mein Studium an der Fakultät aufgenommen habe, war die Zusammensetzung der Studenten sehr durchmischt. Die Mehrheit hatte nicht vor, sich auf den Dienst in der Kirche vorzubereiten. Wie ist das heute?
Die Situation hat sich sehr verändert und zwar in vielerlei Hinsicht. Was das Studium der evangelischen Theologie angeht, so kommt tatsächlich ein Großteil der Studenten aus dem kirchlichen Umfeld und erwägt hinterher in der Kirche zu arbeiten. Dabei kommen sie nicht nur aus der EKBB, sondern praktisch aus allen unseren Kirchen. Es sind junge Menschen nach dem Abitur, aber auch Presbyter, die ihre Kenntnisse vertiefen oder als Hilfsprediger mitarbeiten wollen. Außerdem kommen Menschen, die eine zweite Karriere in Erwägung ziehen – sie wollen anfangen etwas "Sinnvolles" zu tun. Aber die Situation an der Fakultät hat sich auch sehr dadurch verändert, dass das Studium im Fachbereich Soziale Arbeit hinzugekommen ist. Studenten in diesem Bereich machen etwa zwei Drittel der Studierendenschaft aus. Oft sind zwischen ihnen kirchlich Engagierte, aber natürlich auch solche, die sich zu keiner Kirche bekennen. Voneinander zu lernen – sowohl fächerübergreifend als auch in Hinblick auf verschiedenste unterschiedliche Weltanschauungen ist tatsächlich eine Herausforderung und ein spannender Ansatz, in dem wir eine vielversprechende Zukunft sehen.
Die Fakultät trägt zwar den Namen „Evangelisch“, aber sowohl unter den Studenten als auch unter den Dozenten sind Christen unterschiedlicher Konfession. Was macht diese Fakultät zu einer evangelischen?
Wie schon erwähnt, sind an unserer Fakultät nicht nur bekennende Christen. Wir sind Teil der Universität und deshalb stehen wir jedem offen, der die Werte der Universität teilt. Wir sind eine von drei theologischen Fakultäten. Es ist daher vielleicht einfacher zu formulieren, was uns voneinander unterscheidet. Ja, bei uns sind vielleicht die meisten Protestanten. Aber ich vermute, bei uns steht eher die enge und traditionelle Verbundenheit mit den evangelischen Kirchen im Vordergrund, in erster Linie und am stärksten mit der EKBB. Außerdem – oder vor allem – geht es bei uns um die Entwicklung der evangelischen Theologie mit ihrem Schwerpunkt auf kritischer Forschung im Bereich der Bibelwissenschaften. Damit hängt auch die Reflexion über die Wirkung des Evangeliums in der Geschichte und Gegenwart, über Fragen der christlichen Perspektive in der Ethik und über menschliche Freiheiten und Rechte in den Beziehungen zu anderen Religionen und Weltanschauungen zusammen. Diese Reflexion geschieht gewissermaßen frei, kritisch, aber auch mit Rücksicht auf die Traditionen des Protestantismus und vor dem Hintergrund der ökumenischen Zusammenarbeit und Offenheit gegenüber anderen und gegenüber allem, was kommt. Diese kritische Reflexion und diese Offenheit zeigen sich sowohl im Bereich der Theologie als auch in unseren anderen Fachgebieten.
Zur Arbeit der Fakultät gehören unabdingbar auch lebendige, langfristig aufgebaute Beziehungen zu ausländischen theologischen Hochschulen. Gibt es einige Beispiele für eine gelungene Zusammenarbeit mit dem Ausland?
Vielleicht bin ich darüber nicht ausreichend informiert, aber mir fällt keine „nicht gelungene“ Zusammenarbeit ein. An einige ausländische Hochschulen gehen die Studenten in den letzten Jahren nicht mehr, aber insgesamt ist das Studium im Ausland eine grundlegende Lebens- und Berufserfahrung. Einer der Vorteile unserer Fakultät liegt tatsächlich in der Anzahl an Kontakten und Möglichkeiten. Bei Erfüllung gewisser Mindestvoraussetzungen kann jeder, dem etwas daran liegt, im Ausland studieren. Zunächst fällt mir die traditionelle Zusammenarbeit mit Tübingen oder Heideberg in Deutschland ein oder die Kooperation mit Oxford in Großbritannien und den Universitäten Atlanta und Princeton in den USA. Im Bereich der sozialen Arbeit sind eher Hochschulen in Skandinavien attraktiv. Sehr stolz sind wir natürlich auf die Kooperation unserer Bibelwissenschaftler mit der Universität Tel Aviv. Diese besteht im Rahmen archäologischer Ausgrabungen in der Umgebung von Jerusalem, die nicht nur viel Erfahrung und Arbeit mit sich bringen, sondern insbesondere Erkenntnisse über das Leben zur Zeit des Reichs Juda. Und nochmal – zur Teilnahme kann sich grundsätzlich jeder unserer Studenten anmelden.
Für ausländische Studenten bietet die Fakultät auch Kurse auf Englisch an. Was ist der Hauptanreiz sich ausgerechnet diese Fakultät auszusuchen?
Das müsste man die Studenten fragen. Es ist wahrscheinlich überflüssig zu betonen, dass im letzten Jahr die Auslandsaktivitäten deutlich eingeschränkt waren. Trotzdem studieren bei uns ausländische Studenten für ein oder zwei Semester. Das geht heute von zu Hause aus oder hier in Prag. Ich weiß nicht genau, inwiefern das Interesse an der Fakultät seiner fantastischen Lage und seinem attraktiven kulturell-gesellschaftlichen und historischen Kontext geschuldet ist oder inwiefern es eher an den Dozenten liegt, sie sich stark im Ausland engagieren und dort publizieren. Es kommt eine Reihe ausländischer Forscher zu uns, die sich dann mit ihren Studenten ausgiebig über uns unterhalten. Gewöhnlich interessieren sich die Studenten für ein konkretes Thema oder eine Epoche der tschechischen Geschichte, ob nun Reformation oder Neuzeit. Manchmal ist auch die für Prag so typische Vermischung der Kulturen ausschlaggebend oder sie kommen mit einem speziellen Interesse für z.B. Biblistik. Ganz neu werden wir jetzt einen kompletten Bachelorstudiengang der evangelischen Theologie auf Englisch anbieten. Wir stellen fest, dass es auf der Welt viele Absolventen verschiedener theologischer Studiengänge gibt, die Interesse an einer grundlegenderen Ausbildung haben, einschließlich der Bibelsprachen oder systematischer Theologe oder Geschichte, sodass sie in ihren jeweiligen Ländern anschließend den Abschluss machen und sich weiter der Theologie widmen können.
An wen richten sich die auf soziale Arbeit ausgerichteten Studienfächer, die doch in ganz ähnlicher Form auch an anderen Hochschulen angeboten werden?
Wir bieten im Bachelorstudium Soziale und Pastorale Arbeit an. Aber ungefähr ein Viertel aller Vorlesungen und Seminare sind Grundlagen der theologischen Bildung, die der Stärkung der Motivation zu dieser Arbeit dienen. Damit zusammen hängt eine kritische Reflexion über das Menschenbild und die Würde und Rechte des Menschen, aber es geht auch um Notsituationen, Krankheiten, usw. Gelehrt wird eine theologische Reflexion über die Wirklichkeit der Sozialen Arbeit vor dem Grundverständnis der Einzigartigkeit des menschlichen Lebens. Der anschließende Masterstudiengang Krisen – und Pastoralarbeit in der Gemeinschaft – Diakonik verbindet die Elemente Arbeit in der Gemeinschaft mit pastoraler Arbeit, wobei der Schwerpunkt auf einer komplexen Reflexion über zwischenmenschliche Zusammenarbeit und Beziehungen liegt.
Steht es zur Debatte weitere Studiengänge einzuführen?
Derzeit nicht. Wir ziehen eher in Erwägung einige Spezialisierungen auszuweiten. Vor kurzem haben wir das Studienangebot um den konsekutiven Masterstudiengang Theologie – Spiritualität – Ethik erweitert, der einen tiefen Einblick in die christliche Denkweise und Ethik in einem ökumenischen Kontext bietet. Er schließt gewissermaßen an den Bachelorstudiengang Theologie christlicher Traditionen an. Das Studium eignet sich auch für alle, die sich bisher nicht mit Theologie befasst haben. Unser Grundgedanke war, dass ihn Studenten absolvieren, die einen Abschluss aus einem anderen Studiengang mitbringen und zusätzlich Kenntnisse in diesem Bereich erwerben wollen. Zum Beispiel Interessierte aus den Bereichen Kunst, Medien, Geschichte, Wirtschaft oder Medizin und selbstverständlich auch sogenannte kirchlich engagierte Laien. Bislang ist es uns allerdings nicht gelungen den Studiengang richtig anzubieten.
Auf der Webseite der Fakultät kann man Profile der Absolventen aus den einzelnen Studiengängen einsehen. Wie ist das tatsächlich? Finden die Absolventen leicht eine Stelle?
Soweit ich weiß findet jeder, der sich auf den Dienst in der Kirche vorbereitet und dort arbeiten möchte, eine Stelle. Dasselbe gilt für den Bereich der sozialen Arbeit. Das liegt sicher in gewisser Weise daran, dass dort immer eine gute Ausbildung verlangt wird, aber auch daran, dass die Studenten in diesen Bereichen bereits tätig sind und sich weiterqualifizieren oder Kontakte zu zukünftigen Arbeitgebern aufbauen. Sie entdecken, was sie interessiert und können das dann weiterverfolgen. Ich denke, das sagt Einiges über die hervorragende Qualität unserer Fakultät aus – das motiviert dazu in einer Reihe interessanter Berufe zu arbeiten, in der Kirche, im gemeinnützigen oder nicht-gemeinnützigen Bereich, in der Kultur oder der staatlichen Verwaltung.
Was würdest du dir wünschen, was die Studenten aus ihrer Zeit an der Fakultät mitnehmen sollen?
Das wird einigen vielleicht sehr wenig vorkommen – die Fähigkeit zu kritischem Denken. Das beinhaltet allerdings eine Menge nicht geringer Kenntnisse, die Fähigkeit methodisch nachzudenken, einen Überblick über eine ganze Reihe wissenschaftlicher Fächer, die Fähigkeit mit anderen in den Dialog zu treten und mit unterschiedlichsten Menschen zusammenzuarbeiten und gleichzeitig erfordert es eine gewisse Begeisterung für das lebenslange Lernen. Gibt es etwas Nützlicheres für unsere Kirche und Gesellschaft? Gibt es eine spannendere Art zu leben?
Ondřej Kolář
Visionen und Perspektiven der Kirchen im 21. Jahrhundert
 Das Symposium Kirche auf dem Weg: Visionen und Perspektiven für die Reise durch das 21. Jahrhundert, das am 13. April 2021 an der Evangelisch-Theologischen Fakultät (ETF) der Karlsuniversität stattfand, erinnerte an zwei bedeutende tschechische Praktische Theologen, Josef Smolík (1922–2009) und Pavel Filipi (1936–2015). Die Abteilung für Praktische Theologie der ETF lud in Zusammenarbeit mit dem Prager Seniorat der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder ihre Absolventen sowie Theologen aus dem Ausland ein und gedachte Smolíks und Filipis, indem deren Gedanken über die Kirche im aktuellen Kontext weiterentwickelt wurden.
Das Symposium Kirche auf dem Weg: Visionen und Perspektiven für die Reise durch das 21. Jahrhundert, das am 13. April 2021 an der Evangelisch-Theologischen Fakultät (ETF) der Karlsuniversität stattfand, erinnerte an zwei bedeutende tschechische Praktische Theologen, Josef Smolík (1922–2009) und Pavel Filipi (1936–2015). Die Abteilung für Praktische Theologie der ETF lud in Zusammenarbeit mit dem Prager Seniorat der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder ihre Absolventen sowie Theologen aus dem Ausland ein und gedachte Smolíks und Filipis, indem deren Gedanken über die Kirche im aktuellen Kontext weiterentwickelt wurden.
Der Hauptbeitrag stammte von Professor Alexander Deeg von der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Leipzig. Er wies darauf hin, dass das Problem der Kirche immer ein Problem der Sprache sei. Er kritisierte die Verewigung der christlichen Botschaft, zu der es komme, wenn das Evangelium auf einen bestimmten dogmatischen und ethischen Inhalt reduziert werde. Kirchen glaubten oft, dass es ausreiche, diesen Inhalt in neue, attraktivere Formen zu bringen. Professor Deeg betonte im Gegensatz dazu die Notwendigkeit, das Evangelium als dynamisches Geschehen zu verstehen. In Anknüpfung an die Emmausgeschichte sei es die Aufgabe von Christen und Kirchen, im Gespräch eine neue Sprache über Gott zu suchen.
Die nachfolgenden Beiträge hoben die Bedeutung gemeinsamer Visionen für die Bildung einer Gemeinde hervor (Scott Hamilton Andrews) sowie die Bedeutung des Gottesdienstes als zentrales Ereignis, in dem die Visionen und das Verständnis der Kirche gebildet werden (Tabita Landová). Weitere Beiträge behandelten die Tätigkeit der Professoren Josef Smolík und Pavel Filipi auf dem Gebiet der Ökumene, die sie beide mit der Praktischen Theologie verknüpften (Martin Vaňáč), die gegenwärtigen Perspektiven des Seelsorgedienstes (Ladislav Beneš) und die Möglichkeit, die Kirchengebäude als Raum für Religionsunterricht zu nutzen (Ondřej Macek). Die letzten beiden Beiträge bildeten einen gewissen Kontrast: Der eine suchte Inspiration für Kirchen im Bereich des Managements (Jiří Bochez), der andere im Bereich der gemeinsamen Beichte und des Annehmens der Gnade Gottes im Gottesdienst (Jana Hofmanová).
Das ganztägige Symposium fand online statt, teilweise auf Englisch mit tschechischer Übersetzung, und zog die Aufmerksamkeit von Hunderten von Teilnehmern auf sich. Der Videomitschnitt des Symposiums wird auf dem You Tube-Kanal der ETF der Karlsuniversität veröffentlicht. Alle Beiträge erscheinen in der Zeitschrift Teologická reflexe (Theologische Reflexion).
Tabita Landová
Student für eine Woche
 Es ist kein Geheimnis, dass die Widrigkeiten dieser Zeit das tschechische Bildungswesen im letzten Jahr erheblich gelähmt haben und die Hochschulen seit mehr als einem Jahr für die Öffentlichkeit unzugänglich sind. Aus diesem Grund mussten wir an der Evangelisch-Theologischen Fakultät neben dem Präsenzunterricht auch alle anderen begleitenden Veranstaltungen einschränken. Selbst eine solch traditionelle (und, ich wage zu sagen, für die Präsentation aller Universitäten höchst bedeutsame) Veranstaltung wie der „Tag der offenen Tür“ konnte nur virtuell stattfinden, um auch alle epidemiologischen Vorgaben zu erfüllen.
Es ist kein Geheimnis, dass die Widrigkeiten dieser Zeit das tschechische Bildungswesen im letzten Jahr erheblich gelähmt haben und die Hochschulen seit mehr als einem Jahr für die Öffentlichkeit unzugänglich sind. Aus diesem Grund mussten wir an der Evangelisch-Theologischen Fakultät neben dem Präsenzunterricht auch alle anderen begleitenden Veranstaltungen einschränken. Selbst eine solch traditionelle (und, ich wage zu sagen, für die Präsentation aller Universitäten höchst bedeutsame) Veranstaltung wie der „Tag der offenen Tür“ konnte nur virtuell stattfinden, um auch alle epidemiologischen Vorgaben zu erfüllen.
Wir standen daher vor der Frage, wie unsere Fakultät in dieser Situation ihre Lehrveranstaltungen präsentieren könnte. Und so wurde ganz spontan die Aktion „Student für eine Woche“ geboren. Wie der Name schon sagt, öffneten wir eine Woche lang die imaginären Tore des Distanzunterrichts, und diejenigen, die sich für ein Studium bei uns interessieren, hatten – natürlich online – die Möglichkeit, alle Freuden und Kümmernisse eines Vollzeitstudiums am eigenen Leibe auszuprobieren.
Am Ende informierten sich mehr als 50 Interessierte über ausgewählte Fächer aller Abteilungen und Studienbereiche, die unsere Fakultät anbietet, also über die theologischen Studienprogramme, soziale und pastorale Arbeit sowie Diakonik. Die Einführungskurse in das Studium des Alten und Neuen Testamentes stießen dabei auf eine überdurchschnittliche Resonanz, und die Anzahl der Besucher der Vorlesung am letzten Donnerstagmorgen im Februar übertraf all unsere Erwartungen. Die Möglichkeit, durch die Auslegungen unserer wissenschaftlichen Mitarbeiter neue Kenntnisse zu gewinnen, eine Erörterung auf akademischen Niveau zu erproben oder einfach nur in einen virtuellen Lehrsaal zu schauen, der Einblicke in die Räumlichkeiten unserer Kollegen gewährt, ist offenbar ein verlockendes Angebot. Und wir selbst konnten die Möglichkeiten und Grenzen der verwendeten Videokonferenzplattformen und unsere Fähigkeiten vollständig testen.
Obwohl wir natürlich hoffen, dass wir im kommenden Semester mit voller Kraft in das Fakultätsgebäude in der Černá-Straße zurückkehren können, wissen wir nun, dass wir auch unter ungünstigen Bedingungen Studienanwärtern einen Einblick in den Alltag eines Studierenden an der Evangelisch-Theologischen Fakultät ermöglichen können. Und wir hoffen sehr, dass einige von ihnen später ihren Weg zu uns finden werden.
Matěj Bouček
Das Bibelkolloquium per Videokonferenz
 Das Internationale Treffen der Bibelwissenschaftler, das aus Seminaren hervorging, die in den 1980er Jahren in Privatwohnungen abgehalten wurden, und das nun schon fast dreißig Jahre lang immer in der Woche nach Ostern an der Evangelisch-Theologischen Fakultät stattfindet, musste im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie in letzter Minute verschoben werden. Das diesjährige Treffen (XXVIII. colloquium biblicum, 7.–8. April 2021) wurde als Videokonferenz ausgerichtet; das Programm wurde auf anderthalb Tage gekürzt. Diesmal konzentrierten sich die Beiträge auf Bibeltexte und nichtbiblische Stoffe, die sich mit der Figur des Propheten Elia in ihren verschiedenen Rollen und Bedeutungen befassen. An dem Kolloquium nahmen über 30 Wissenschaftler, Studenten und Pfarrer aus der Tschechischen Republik, Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und der Slowakei teil. Obwohl die Form der Videokonferenz nicht gerade ideal für Seminarkonferenzen und dynamische Diskussionen ist, war das Treffen diesmal ein Erfolg und sehr intensiv und fruchtbar.
Das Internationale Treffen der Bibelwissenschaftler, das aus Seminaren hervorging, die in den 1980er Jahren in Privatwohnungen abgehalten wurden, und das nun schon fast dreißig Jahre lang immer in der Woche nach Ostern an der Evangelisch-Theologischen Fakultät stattfindet, musste im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie in letzter Minute verschoben werden. Das diesjährige Treffen (XXVIII. colloquium biblicum, 7.–8. April 2021) wurde als Videokonferenz ausgerichtet; das Programm wurde auf anderthalb Tage gekürzt. Diesmal konzentrierten sich die Beiträge auf Bibeltexte und nichtbiblische Stoffe, die sich mit der Figur des Propheten Elia in ihren verschiedenen Rollen und Bedeutungen befassen. An dem Kolloquium nahmen über 30 Wissenschaftler, Studenten und Pfarrer aus der Tschechischen Republik, Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und der Slowakei teil. Obwohl die Form der Videokonferenz nicht gerade ideal für Seminarkonferenzen und dynamische Diskussionen ist, war das Treffen diesmal ein Erfolg und sehr intensiv und fruchtbar.
Martin Prudký
