Bulletin 52 – Ostern 2021
Der Leitarikel
Liebe Leserinnen und Leser,
Im letzten, dem Weihnachts-Bulletin, haben wir über einige große historische Jahrestage geschrieben. Dieses Mal ist es anders, es fällt mir nur ein Jahrestag ein und dazu ein ziemlich paradoxer. Es ist nämlich gerade ein Jahr her, seit wir, eine große Mehrheit, zu Hause eingeschlossen sind, weil uns von draußen ein höchst ungebetener Besucher bedrängt, Coronavirus genannt. Und irgendwie wird es nicht besser, die Zahlen sind eher unerfreulich, zuweilen sieht es hoffnungsvoll aus, aber dann kommt wieder ein Sprung zurück, es geht andauernd nach oben und wieder nach unten…
Wir versuchen so gut es geht normal zu leben, aber wir schaffen das nicht so recht, wir sehen unsere Angehörigen nicht, wir haben Bedenken im Blick auf die, denen wir begegnen, mit einem Kameraden auf einen Kaffee oder ein Bier zu gehen, das kommt uns fast schon wie ein schöner Traum vor.
Was bringt uns diese Zeit Gutes? Jede schlechte Etappe hat doch auch ihr Gutes, und in diesem Fall auch für uns wichtige Seiten. Das Leben wurde nicht angehalten! Ja, viele Menschen sterben, und das tut uns weh, aber sehr viele sind auch wieder gesund geworden und Kinder werden geboren, so als wäre nichts! Zum Glück erscheinen auch weiterhin gute Bücher, wir haben also etwas zum Lesen, seien wir dafür dankbar! Und nicht nur Bücher, es entstehen auch sehr gute Filme, Theatervorstellungen – und dass die Menschen sich nicht vom Virus kleinkriegen lassen, das ist doch auch eine gute Nachricht, es ist nicht alles schlecht!
Um wenigstens etwas von dem zu erwähnen, was Sie im neuen Bulletin lesen, möchte ich auf zwei junge Pfarrer hinweisen, die sich Pastoral Brothers nennen. Diese wollen sich sicher auch nicht vom Virus zum Schweigen bringen lassen. Die Beiden sind Pfarrer und gleichzeitig ein  bisschen Schauspieler in einem, die Hoffnung bringen, Freude, aber was ganz besonders wichtig ist – sie sprechen auch erfolgreich die atheistische Mehrheit der Tschechen an! Und das will schon etwas heißen! Schauen Sie sich die Beiden an; und halten wir uns alle an die Hoffnung, die von Oben kommt.
bisschen Schauspieler in einem, die Hoffnung bringen, Freude, aber was ganz besonders wichtig ist – sie sprechen auch erfolgreich die atheistische Mehrheit der Tschechen an! Und das will schon etwas heißen! Schauen Sie sich die Beiden an; und halten wir uns alle an die Hoffnung, die von Oben kommt.
Für den Redaktionsrat
Jana Plíšková
DIE EVANGELISCHE KIRCHE DER BÖHMISCHEN BRÜDER
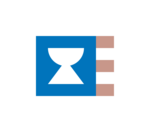 P.O. Box 466, Jungmannova 9,
P.O. Box 466, Jungmannova 9,
CZ 111 21 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 224 999 215(216); Fax: (+ 420) 224 999 219
E-Mail: ekumena@e-cirkev.cz
Internet: www.e-cirkev.cz
Die Grundlagen der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) wurzeln in der Utraquistischen Kirche (1431–1620) und in der Brüderunität ((1457–1620). Die EKBB entstand in ihrer heutigen Gestalt im Jahr 1918 durch den Zusammenschluss der bis dahin selbständigen evangelischen Kirchen Augsburger und Helvetischen Bekenntnisses. Deren Existenz wurde nach dem Ende der harten Gegenreformation, die von 1620 bis zum Erlass des Toleranzpatens durch Kaiser Joself II. im Jahr 1781 dauerte, erlaubt. Die strengen Beschränkungen mussten die Evangelischen freilich auch danach beachten, bis zum Erlass des Protestantenpatentes im Jahr 1861.
In der Zeit ihrer Entstehung hatte die EKBB 250 000 Mitglieder, im Jahre 1938 waren es dann schon 325 000 Mitglieder. Heute ist die Kirche in 14 Seniorate aufgeteilt mit einer Gesamtzahl von 250 Gemeinden und ca. 80 000 Gemeindegliedern. Die Kirche wird vom sechsköpfigen Synodalrat geleitet, der auf sechs Jahre gewählt wird. Repräsentiert wird die Kirche vom Synodalsenior und vom Synodalkurator.
Auf den Spuren von Sváťa Karásek
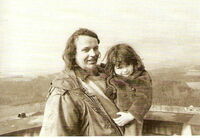 Mit Svatopluk Karásek (18. Oktober 1942 – 20. Dezember 2020) ist ein evangelischer Pfarrer verstorben, der den tschechischen Protestantismus grundlegend beeinflusst hat. Mit der gleichen Souveränität war er in so verschiedenen Bereichen wie dem kulturellen Underground, der Kirche und dem Establishment aktiv.
Mit Svatopluk Karásek (18. Oktober 1942 – 20. Dezember 2020) ist ein evangelischer Pfarrer verstorben, der den tschechischen Protestantismus grundlegend beeinflusst hat. Mit der gleichen Souveränität war er in so verschiedenen Bereichen wie dem kulturellen Underground, der Kirche und dem Establishment aktiv.
Im Jahre 1981 kam Sváťa Karásek in die schweizer Stadt Zürich. Ein, für diese Umgebung, nicht ganz typischer Pfarrer. Lange Haare, mächtige Figur, lautes Lachen. Er griff oft zur Gitarre, die er zwar schlecht, dafür ganz ohne Hemmungen spielte. Er kam aus der kommunistischen Tschechoslowakei, von wo ihn die geheime Staatspolizei vertrieben hatte. Diese hatte es sich in dieser Zeit zum Ziel gesetzt, so viele Regime-Gegner wie nur möglich durch unendliche Verhöre, Hausdurchsuchungen, Entführungen und Schläge aus dem Land zu vertreiben. Sváťa erlag deren Versuchen, wenn auch ungern. Vor allem aus Rücksicht auf seine Familie. Seine Ehefrau Stáňa kümmerte sich um drei Kinder und hatte ein schwaches Herz, das die sich wiederholenden Stresssituationen aushalten musste.
Die Staatspolizei konnte feiern. Sie schaffte es, eine charakteristische Persönlichkeit zu verjagen. Karásek gab vielen Menschen durch Wort und Tat den Mut, frei zu handeln. Wie sich aber einige Jahre später herausstellte, war das Werk, an dem er beteiligt war, mächtiger als die Macht des scheinbar allmächtigen totalitären Staates.
Kunst und Gesellschaft
Er wurde in einer antikommunistischen Familie geboren. Der Vater, eigentlich ein Beamter, später Arbeiter, war in den Fünfzigern aus politischen Gründen in Haft. Von seiner Mutter hatte er den eigenen Worten nach den Sinn für Humor und Spaß geerbt, weswegen er in seiner Schulzeit oft schlechte Noten in Betragen und Verweise bekam. Geistige Inspiration waren ihm die amerikanische Beat – Generation und die Bibel, vor allem das Neue Testament, welches er nicht wegen des Rufes fast schon verbotener Literatur las, sondern weil er sich durch die biblische Botschaft angesprochen fühlte. In Kontakt mit dem Christentum kam er schon als Kind. Den evangelischen Gottesdienst besuchte er mit seiner Mutter.
Sein Weg zum Studium an der damaligen Theologischen Comenius-Fakultät – der einzigen protestantischen Fakultät in Tschechien – war nicht einfach. Dem nichtkonformen Jugendlichen wollten die Staatsvertreter damals maximal ein Landwirtschaftsstudium erlauben – mit der Begründung, er habe ja seine mittlere Reife auf dem Gebiet Gärtnerei und Weinanbau abgelegt. Karásek arbeitete deshalb für kurze Zeit als Bergarbeiter in den Bergwerken bei Kladno, versuchte die Aufnahmeprüfungen erneut und wurde 1964 angenommen. Auch dank der Fürsprache von Fakultätsdekan J.L. Hromádka, dessen Wort Macht hatte. Dieser bedeutende Theologe und Träger des Leninpreises hatte nämlich gute bis ausgezeichnete Beziehungen zum kommunistischen Regime.
In die Fakultät brachte der Student Karásek eine neue Perspektive. Studenten und Lehrer waren um ein möglichst ungestörtes Studium und Forschung in den theologischen Wissenschaften bemüht, die Mutigeren bemühten sich auch um einen kritischen Dialog mit dem Regime. Mit Karásek kam aber allmählich ein künstlerischer, kreativer Geist zu Wort. Sein Tatendrang, seine Direktheit, seine hohe Gestalt, der langsame, besonnene Redestil und vor allem sein unerschütterliches Selbstvertrauen verhelfen ihm dabei zu unübersehbarer Autorität. Was die Form betrifft, so denkt er sich da nichts Neues aus. Im Land ist schon seit Vorkriegszeiten eine starke Tradition lebendig, die Theater, Kabarett und engagiertes Liedermachen verbindet. In Karáseks Studienzeiten erlebt sie einen neuen Boom. Karásek schließt sich dieser Richtung an. Seit seiner Jugend hat er einige Erfahrungen mit Theater, Band und der Vertonung von Poesie gesammelt, er schreibt sogar selbst Gedichte. Und er schafft es, nicht wenige andere Menschen an der Fakultät und von außerhalb mitzureißen. Ihm geht es nicht um künstlerische Perfektion, sondern vielmehr um die Gemeinschaft, die sich bei solchen Aktivitäten bildet, und um die Botschaft des Evangeliums, die man auf diese Weise verbreiten kann.
Die freien Jahre
Durch den Einfluss der Erziehung seiner Familie glaubte er weder an den Kommunismus noch an den Sozialismus. Bis zum Jahr 1968 hatte er aber keinen Grund, sich gegen das System in der Tschechoslowakei zu stellen. Die Wandlung kommt erst mit dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts und sie hängt auch mit einer Familientragödie zusammen. Mit seiner Frau Stáňa erwarten sie die ersten Kinder. Die vorzeitig geborenen Zwillinge jedoch sterben. Im Krankenhaus gibt es keinen Inkubator und bei dem Transport erfrieren die Zwillinge im ungeheizten Rettungswagen. Als ein Kirchenvertreter Karásek mit den gottesfürchtigen Worten, es sei „Gottes Wille“ gewesen, trösten will, erwidert der zornige junge Pfarrer, dass es vielmehr an der Nachlässigkeit eines nicht funktionsfähigen Staates lag. Die Eheleute lassen sich aber nicht entmutigen. Ein Jahr später kommt ihre Tochter Adélka zur Welt.
Da ist die Familie Karásek schon in Hvozdnice bei Prag tätig. Und mit großem Erfolg, denn die Gemeinschaft rund um das evangelische Pfarrhaus wird durch Karáseks Wirken immer größer. Den kommunistischen Ämtern gefällt dies nicht, deshalb wird Karásek unfreiwillig ins nordböhmische Grenzgebiet versetzt. Dort aber wiederholt sich die Geschichte. Der Pfarrer mit den langen Haaren und der Gitarre, der noch dazu einen Jeep fährt, zieht die Jugendlichen wie ein Magnet an. Das Ergebnis ist der Verlust der staatlichen Erlaubnis, den Pfarrberuf auszuüben – die Ämter haben ihm einfach verboten zu predigen. Mit der Familie zieht er auf die verlassene Burg Houska in einer Gegend voller romantischer Felsen und Schluchten. Er bekommt hier die Stelle des Kastellans und Verwalters der Bücher im Depositorium. Und er erlebt hier – wie er später selbst bestätigt – den freiesten Lebensabschnitt.
Auf der Burg Houska bleibt er abseits des offiziellen Geschehens. Dafür besuchen ihn Freunde aus Nah und Fern und auch Unbekannte suchen ihn auf. Rund um die Burg bildet sich eine neue Kommunität, für die Karásek seine Predigten bereits zielstrebig in Liedform schreibt, weil er die Abende beim Feuer nicht mit theologischen Reden stören will. Gitarre und Gesang hingegen passen perfekt dazu, und das obwohl Karásek ein schlechter Sänger und noch schlechterer Gitarrist ist. Die musikalischen Grundlagen leiht er sich vom amerikanischen Spiritual, die Texte aber schreibt er selbst. Er spielt geschickt mit der Sprache, hat ein Gefühl für den Klang der Worte, die Botschaft hinter den Texten bleibt aber immer klar. Amateurhafte Aufnahmen seiner Lieder verbreiten sich auf Kassetten.
„Ich weiß nicht, welche Aufnahme es war, vielleicht die zwanzigste, es klang sehr gedämpft, aber vor allem klang es, als käme es aus dem Inneren der Erde. Seine Stimme war sehr tief und hypnotisch. Es war unmöglich, sich von dem Kassettenrekorder zu entfernen.“ So beschreibt Michal Plzák, heute Pfarrer, damals atheistischer Gymnasiast, seine erste Begegnung mit Karáseks Liedern. Es war Karásek, der ihn auf den – im kommunistischen Staat – gefährlichen Weg ins Theologiestudium brachte. „Durch seine Lebensphilosophie und Worte zeigte er uns das Christentum in einer Form, die nicht dumm, altertümlich und lächerlich ist. Eine glaubwürdige und tragende Alternative, die eine lebendige Gemeinschaft bildet und dutzende, hunderte Menschen in die Kirche zog – für kurze oder längere Zeit, manche für immer.“ Der fromme tschechische Protestantismus war nun einer regelrechten Invasion an jungen Menschen ausgesetzt, die im Aussehen, Benehmen und Denken ziemlich nonkonform wirkten. Plzák meint aber, „dass die Kirche sich daran gewöhnt hat und von Zeit zu Zeit auch Dankbarkeit zeigte.“
Insbesondere sein Erfolg bei der Jugend machte Karásek in den Augen der kommunistischen Ämter zum Feind, und das in solchem Ausmaß, dass er zusammen mit der Gruppe um die legendäre Underground-Band The Plastic People of the Universe verurteilt wurde. Gerade dieser Band hat er öfters Raum und Zuflucht auf der Burg Houska geboten. Dieser Prozess mit den jungen Leuten ging in die Geschichte ein als ein wichtiger Vorbote der Bürgerrechtsbewegung Charta 77. Diese begann, mit Václav Havel an der Spitze, vom Regime das Einhalten von Menschenrechten zu fordern.
Karásek blieb dem Underground bis zu seinem Tod treu. Aber ging über dessen Grenzen hinaus. Er übernahm die äußere Ästhetik des Underground, formte sie wahrscheinlich sogar selbst und wirkte als eines der visuellen Symbole des Underground. Er nahm am Leben der Underground–Community teil. Nach dem Vorbild Jesu hatte er Verständnis für problematische, am Rande stehende Menschen. Dies war bei ihm aber keineswegs eine Vorliebe für Nihilismus oder Niedrigkeit. Seine ganze Persönlichkeit war in die gegensätzliche Richtung gewandt. In seinen Predigten, die er unter dem selbsterniedrigenden Titel Gottes Dummkopf (Kalich, Torst, 2000) veröffentlichte, lesen wir wieder und wieder Worte des Glaubens an den guten Willen und an Gottes Führung, deren Ziel der Prediger oft mit dem Bild eines großen Festes für alle darstellt. Darin war sein Glaube einfach und fest. Mit Versen aus dem Evangelium, die dem widersprachen, zögerte er nicht zu polemisieren.
In der Salvator-Gemeinde
Nach der Revolution im Jahre 1989 pendelt er mehrere Jahre zwischen Prag und der Schweiz, wo ein Teil seiner Familie sesshaft geworden ist, und im Jahre 1997 wird er evangelischer Pfarrer in der Prager evangelischen Kirche des Heiligen Salvators, einem der wichtigsten Gotteshäuser der tschechischen protestantischen Tradition. Gleichzeitig engagiert er sich in der Politik. Vier Jahre wirkte er als Parlamentsabgeordneter, zwei Jahre war er Beauftragter der Regierung für Menschenrechte, bis ins Jahr 2018 war er in der Verwaltung des Stadtteils Prag 1 tätig. Nach dem plötzlichen Tod seiner Frau Stáňa heiratete er erneut. Mit seiner Ehefrau Pavla hatte er zwei Kinder.
Das Ende seines Lebens wurde durch einen Schlaganfall geprägt, nach dem er die Sprache verlor und das Reden wieder neu lernen musste. Für jemanden, der das ganze Leben als Pfarrer tätig ist, mag dies ein schrecklicher Schlag sein. Karásek jedoch lobte die Vorteile, die ihm das Handicap brachte – sein Intellektualismus nahm ab, er verlor das Bedürfnis, sich zu streiten, seine charakteristische Explosivität verschwand. Sein Glaube an das gute Ende war unerschütterlich. So bekannte er in einer seiner Adventspredigten: „Gottes Friede, das Königreich der Gerechtigkeit und Freiheit, das ist keinesfalls verloren! Das ist – glaubt es, oder glaubt es nicht – unsere Zukunft, das ist Gottes heiliges Land, […] es ist Gottes Zukunft, die uns nahe wird.“
Adam Šůra
Wir sollten Verständnis für die Komplexität der zwischenmenschlichen Beziehungen und die Vielfalt der Umwelt haben. Ein Interview mit Pavel Hanych, dem neuen Leiter der Abteilung für ökumenische und internationale Beziehungen der zentralen Kirchenkanzlei der EKBB
 Pavel Hanych (37 Jahre) studierte evangelische Theologie an der Karlsuniversität in Prag. Er arbeitete zehn Jahre in der Zentrale der Diakonie, zuletzt als Leiter der Abteilung für Kommunikation und als Pressesprecher. Er ist als Hilfsprediger der EKBB ordiniert und leitet auch die Veröffentlichung des neuen evangelischen Gesangsbuches. Die Musik ist seine größte Leidenschaft, der er sich schon seit seiner Kindheit widmet. Auf einem Spezialgymnasium für Musik studierte er Geige. Er lebt mit seiner Frau Klára und dem anderthalb Jahre alten Sohn Pavel zusammen.
Pavel Hanych (37 Jahre) studierte evangelische Theologie an der Karlsuniversität in Prag. Er arbeitete zehn Jahre in der Zentrale der Diakonie, zuletzt als Leiter der Abteilung für Kommunikation und als Pressesprecher. Er ist als Hilfsprediger der EKBB ordiniert und leitet auch die Veröffentlichung des neuen evangelischen Gesangsbuches. Die Musik ist seine größte Leidenschaft, der er sich schon seit seiner Kindheit widmet. Auf einem Spezialgymnasium für Musik studierte er Geige. Er lebt mit seiner Frau Klára und dem anderthalb Jahre alten Sohn Pavel zusammen.
Ökumenische und internationale Beziehungen – das klingt sehr offiziell. Was kann man sich darunter vorstellen?
Die Evangelische Kirche bemüht sich seit ihren Anfängen um den Dialog und einen gemeinsamen Weg der Christen trotz der Verschiedenheit der Traditionen und Akzente der einzelnen Kirchen. Unsere Aufgabe besteht darin, dies zu unterstützen. Hier in Tschechien, in unseren reichen, aber zerbrechlichen ökumenischen Beziehungen. Und dann im Ausland, wo wir stark ausgeprägte Partnerschaften und Freundschaften mit vielen Kirchen pflegen. Neben zahlreichen Besuchen, Studien- oder Arbeitsbesuchen unterstützen wir einander und tauschen uns über Praxisbeispiele in vielen Bereichen des kirchlichen Lebens aus. Und natürlich wollen wir nicht an der Grenze der anderen Kirchen stehenbleiben und hier sehe ich eine dritte Säule unserer Arbeit – in der Beziehung zur Öffentlichkeit, darin, wichtige gesellschaftliche, etische und politische Themen zu öffnen, Minderheiten oder Menschen am Rand der Gesellschaft zu schützen. Wir wollen, dass die Kirche ein offener und sicherer Raum für alle ist. In Zusammenarbeit mit dem Synodalrat und der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit beteiligen wir uns daran, dass auch in diesem Bereich unsere Stimme hörbar ist.
Du hast Theologie studiert, hast Dich auf den Pfarrdienst vorbereitet und Du warst vor allem lange in der Diakonie tätig. Was nimmst Du daraus in die neue Arbeitsstelle mit?
Auf jeden Fall das Wissen rund um die Kirche, welches ich mir während meines Studiums und in verschiedenen kirchlichen Gremien angeeignet habe. Zehn Jahre bei der Diakonie waren eine wertvolle Zeit, dort habe ich aus großer Nähe festgestellt, dass auch eine kleine Kirche eine Organisation leiten kann, die doch zu den wichtigen und respektierten sozial Diensten in der Tschechischen Republik gehört und auch international wirkt. Trotz der Größe und der quantitativen Parameter, die die Diakonie im Vergleich zur Kirche mittlerweile erreicht hat, hat sie sich niemals von der Kirche distanziert und will auch weiterhin eine gute Beziehung zu ihr behalten. Mein Engagement in der Diakonie hat bestimmt auch mein Sozialgefühl gestärkt. Trotz all des Wachstums und des Lebens in relativer Ruhe und Reichtum leben bei uns weiterhin viele Menschen, Familien, Kinder, die es im Leben sehr schwer haben. Das hat mich gelehrt, dass auch die Kirche nicht in ihrer eigenen sozialen Blase leben sollte. Dass sie stattdessen offen, einfühlsam, einladend und nicht urteilend sein soll. Dass sie ein sicherer Hafen auch für diejenigen sein soll, die nicht dem Mainstream entsprechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dies in der EKBB gut funktioniert, aber trotzdem darf man es nicht vergessen.
Welches sind die drei wichtigsten Aufgaben, die Du jetzt vor Dir siehst?
Das Kennenlernen von internationalen Beziehungen in Zeiten, in denen die Welt irgendwie verschlossen ist, ist keine ideale Ausgangsposition. Ausländische Partner lade ich der Reihe nach zum Online–Kaffee ein, wir treffen uns über die Bildschirme und lernen uns gegenseitig kennen. Die zweite Aufgabe ist es, die drei Pfeiler unserer Arbeit gut zu erfassen – innere Ökumene, internationale Beziehungen, Gesellschaft – und innerhalb dieser Prioritäten und Ziele zu setzen, den weiteren Verlauf zu durchdenken und zu planen. Das braucht genügend Zeit, denn daneben haben wir auch mit deer tagtäglichen Administration zu tun, die auch in Covid–Zeiten nicht geringer ist. Dabei sind mir meine großartigen Teamkollegen eine große Stütze. Die dritte Aufgabe ist mehr eine persönliche – in den nächsten Monaten würde ich gerne mein Deutsch auf ein höheres Level bringen, denn neben Englisch ist dies eine grundlegend wichtige Sprache in unserer Abteilung.
Adam Šůra
Tschechisch-Amerikanische Partnerschaft online
 Die Partnerschaft zwischen der EKBB und der Presbyterianischen Kirche in den USA hat eine lange Tradition. Viele Wurzeln liegen im 19. Jahrhundert. Damals gründeten Immigranten aus den Böhmischen Ländern in Amerika tschechische evangelische Gemeinden. Diese pflegten oft intensive Beziehungen zu den Evangelischen in der alten Heimat. Viele dieser Gemeinden wurden Teil der Presbyterianischen Kirche in den USA. In der Zeit des Kommunismus und der geschlossenen Grenzen wurden viele Kontakte unterbrochen.
Die Partnerschaft zwischen der EKBB und der Presbyterianischen Kirche in den USA hat eine lange Tradition. Viele Wurzeln liegen im 19. Jahrhundert. Damals gründeten Immigranten aus den Böhmischen Ländern in Amerika tschechische evangelische Gemeinden. Diese pflegten oft intensive Beziehungen zu den Evangelischen in der alten Heimat. Viele dieser Gemeinden wurden Teil der Presbyterianischen Kirche in den USA. In der Zeit des Kommunismus und der geschlossenen Grenzen wurden viele Kontakte unterbrochen.
Nach der Samtenen Revolution nahmen die Beziehungen zwischen der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder und der Presbyterianischen Kirche (USA) einen neuen Aufschwung. Gäste aus den USA besuchten Gemeinden der EKBB, Gruppen kamen zu Arbeitseinsätzen in der neugegründeten Diakonie, Kontakte zwischen den Kirchenzentralen in Prag und Louisville, Kentucky, wurden geknüpft, es gab einen Austausch zwischen unserer Evangelisch-Theologischen Fakultät und verschiedenen theologischen Fakultäten in den USA. Eine Frucht dieser Aktivitäten ist ein Netzwerk von Partnerschaften von Gemeinden, der Diakonie und der Evangelisch-Theologischen Fakultät, die alle Teil der Partnerschaft zwischen der EKBB und der PC (USA) sind. Auf beiden Seiten des Ozeans gibt es eine Gruppe, die sich um die Pflege dieser Partnerschaft kümmert. In unserer Kirche ist es die sogenannte Partnership Working Group, in der Presbyterianischen Kirche ist es das Czech Mission Network. Beide Gruppen haben gemeinsam schon vier Partnerschaftskonferenzen veranstaltet: nach einer ersten Konferenz 2008 in Prag folgte eine weitere 2012 in Annapolis, Maryland, dann 2016 wieder in Prag und 2019 in Atlanta, Georgia, am Columbia Theological Seminary. Die nächste Konferenz soll in gut zwei Jahren in Mähren, in Olomouc stattfinden, und zwar vom 9. bis 13. Juli 2023 unter dem Thema: Gemeinsam auf dem Weg. Wir rechnen damit, dass über 60 Vertreterinnen und Vertreter aus den USA und aus Tschechien an dieser Konferenz teilnehmen werden.
Die Zeit der Einschränkungen durch die Pandemie wurde für diese Partnerschaft zu einer Herausforderung! Auf beiden Seiten des Ozeans haben wir uns mehr und mehr an virtuelle Kommunikation gewöhnt. Online Sitzungen und auch Gottesdienste wurden zu einer alltäglichen Erfahrung. Video Konferenzen wurden für viele Teil der Arbeit, Freizeit und auch der familiären Kommunikation. Deshalb lag es nahe, auch in unserer Partnerschaft die Video-Kommunikation auszuprobieren. Gesagt, getan. Am 16 Juni 2020 trafen sich die beiden Partnerschaftsgruppen zum ersten Mal zur gemeinsamen Video-Konferenz. Und sie war gleich ein Erfolg, so dass sich beide Seiten darauf verständigt haben: Wir machen weiter. Und nicht nur für uns selber. Zweimal im Jahr veranstalten wir eine ca. zweistündige Video-Konferenz, zu der wir alle Interessierten einladen. Der Termin für die erste Video-Konferenz: Sonntag, der 21. März 2021 um 14 Uhr amerikanischer und 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das Thema: PRAYER AND PRAISE IN THE PANDEMIC: A Conversation about Worship in the Season of COVID-19. Auf Deutsch: Gebet und Lobpreis in der Pandemie: ein Gespräch über den Gottesdienst in der Zeit von Covid-19. Wir hoffen, dass viele sich einladen lassen und an diesem Gespräch teilnehmen. Ein weiteres Gespräch planen wir dann für den Herbst und weitere für die nächsten Jahre.
Wir erhoffen uns von diesem Format unserer Partnerschaft, dass wir unsere Partnerschaft weiter öffnen können und dass mehr Menschen daran teilnehmen können. Vielleicht lassen sich auch weitere Gemeinden oder Gemeindegruppen für eine tschechisch-amerikanische Partnerschaft begeistern. Zur Zeit liegt die Zahl der Partnerschaften noch unter 10. Da bietet es sich geradezu an, weitere Partnerschaften ins Auge zu fassen. Immerhin gibt es in der Presbyterianischen Kirche (USA) ungefähr 10 000 Gemeinden. Dabei sind neben der Presbyterianischen Kirche in den USA auch die Lutherische Kirche in Amerika und die Church of Scotland an unserem Partnerschaftsnetzwerk beteiligt. Wir sind sehr dankbar für diese globalen Partnerschaften, die uns die Augen öffnen für die globale Dimension des Evangeliums von Jesus Christus, der seine Jünger bis an die Enden der Welt schickt, dass sie das Evangelium verkündigen.
Gerhard Frey-Reininghaus
Pfarrer fesseln auf YouTube die tschechische Öffentlichkeit
 Sie nennen sich Pastoral Brothers und stellen neben ihrer normalen Arbeit auch sehr originelle Videos ins Internet. Jakub Malý und Karel Müller. Zwei evangelische Pfarrer aus Prag.
Sie nennen sich Pastoral Brothers und stellen neben ihrer normalen Arbeit auch sehr originelle Videos ins Internet. Jakub Malý und Karel Müller. Zwei evangelische Pfarrer aus Prag.
Der Erfolg ihrer Beiträge, mit denen sie biblische Themen der breiten Öffentlichkeit näherbringen und gleichzeitig satirisch zum öffentlichen Geschehen Stellung nehmen, hat ihre Erwartungen übertroffen. Tausende Fans folgen ihnen regelmäßig. Ihre Videos sprechen wöchentlich Zehntausende Menschen an, und ihre Reichweite in den sozialen Netzwerken geht weit über den Kreis des Seniorats und sogar der gesamten Kirche hinaus.
Dabei kam die Idee, Videos für junge Leute zu drehen, den beiden spontan – sie wollten gar nicht unbedingt Youtuber werden. Es war eher eine verrückte Entscheidung als ein konkreter und gut durchdachter Plan. Sie wollten es einfach mal probieren. Lange Zeit hatte ihnen nämlich ein Kommunikationskanal in der Kirche gefehlt, über den sie die jüngere Generation ansprechen konnten. Doch hatten weder Jakub noch Karel größere Erfahrung mit dem Erstellen von Filmen.
Die Anfänge waren also schwierig. Aber es war den Werken anzusehen, dass die beiden gern zusammenarbeiteten. „Es macht uns Spaß zu überlegen, wie wir christliche Inhalte mit Humor rüberbringen können. Wir lernen ständig etwas Neues – vom Schreiben der Drehbücher bis zur Erstellung des Videos selbst“, erläutern die Pastoral Brothers.
Nach einem Jahr Arbeit, als sie allmählich Fans gewannen, beantragten sie über die Kirche eine Förderung aus Schottland. „Wir haben rund 200 000 Kronen [gut 7 600 Euro] erhalten, wovon wir semiprofessionelle Geräte und Software gekauft sowie die Erstellung grafischer Elemente für unsere Videos und Werbung in den sozialen Netzwerken bezahlt haben. Das hat uns ganz schön weitergebracht“, beschreibt Karel die Anfänge.
Der Durchbruch gelang im Frühjahr 2020. Die Tschechische Republik erlebte die erste Welle der Pandemie und die Regierung erließ außerordentliche Maßnahmen, die das soziale und kulturelle Leben im Land einschränkten. In einem traditionell atheistischen Umfeld vergaß sie dabei ständig die Kirche und den geistlichen Dienst.
Die Situation nahm absurde Ausmaße an – der Staatsapparat öffnete Baumärkte oder Zirkusse, während Gottesdienste noch verboten waren oder strengen Vorschriften unterlagen. Und dann entdeckten die Medien das Pastorenduo auf YouTube.
Mit ihrem Video, in dem zu sehen ist, wie sie in Talaren durch einen Hornbach gehen und laut über die Möglichkeiten nachdenken, Gottesdienste im Einkaufszentrum abzuhalten, schafften sie es in eines der meistbeachteten Fernsehjournale des Landes. Einerseits ermöglichten die Maßnahmen der Regierung die Anwesenheit von Zehntausenden von Käufern, andererseits untersagten sie strengstens die Versammlung einer Handvoll Gläubiger in großen Kirchen. Die Absurdität der Situation war plötzlich leicht zu verstehen, selbst in einem Land, in dem sich nur ein Bruchteil der Bevölkerung zum Glauben bekennt.
In ihren normalen Videos bringen Karel und Jakub das biblische Zeugnis auch Menschen näher, die noch nie davon gehört haben. Zum Beispiel beschäftigten sie sich mit den Zehn Geboten Gottes, mit ethischen Fragen des Lebens, streamten während des Lockdowns Gottesdienste für Jugendliche und erklärten in einer Serie bizarre Bibelstellen, die bei einem ungeübten Bibelleser einen etwas seltsamen Eindruck hinterlassen können.
Von Anfang an überlegten sie auch, wie sie aus dem virtuellen Raum effektiv herauskommen und nahe bei den Suchenden und ihren Fragen sein könnten – und zwar live, nicht nur über Bildschirme oder Displays. „Wir haben einen Kurs über das Christentum ins Leben gerufen. Nach zwei Stunden waren alle Plätze vergeben“, erinnert sich Karel an den Sommer 2020, als es zu Lockerungen der Beschränkungen kam und es dadurch wieder möglich wurde, sich von Angesicht zu Angesicht zu treffen. „Wir sind immer noch in Kontakt mit diesen Menschen und einige wollen sich sogar taufen lassen. Zukünftig wollen wir niedrigschwellige Gottesdienste für unsere Fans anbieten. Wir schreiben auch an einem Buch. Es stellt christliche Grundgedanken auf verständliche Weise vor. Es wird in einem nichtkirchlichen Verlag erscheinen, der uns von sich aus angesprochen hat“, erzählen die YouTube-Pfarrer mit Blick auf ihre Zukunftspläne.
Außerdem begannen sie mit der Vorbereitung eines Podcasts, in dem sie Referenten der Evangelisch-Theologischen Fakultät zum Gespräch einladen, um mit ihnen eingehend Fragen des Glaubens und der biblischen Zeugnisse zu erörtern. Sie widmen sich auch dem interreligiösen Dialog und sprechen mit bedeutenden Vertretern verschiedener Religionen und des öffentlichen Lebens. Zu den Gästen zählten bisher beispielsweise der Theologe und Träger des Templeton-Preises, Tomáš Halík, oder der prominente tschechische Ökonom und ehemalige Berater von Präsident Václav Havel, Tomáš Sedláček.
Das große Interesse von Menschen aus dem ökumenischen oder außerkirchlichen Umfeld überrascht Karel und Jakub bis heute. Ihre ursprüngliche Absicht war es, Videos für evangelische Jugendliche zu erstellen, aber es folgen ihnen auch Menschen bis 45 aus verschiedenen Kirchen oder auch ohne Religion.
Aus den Pastoral Brothers sind Influencer geworden. Die Medien und andere Mitglieder der YouTube-Community laden sie zum Gespräch ein. Mehrfach haben sie im nationalen Fernsehen und Radio Aufmerksamkeit erregt. Im Jahr 2020 setzte das Magazin Forbes sie auf die Liste der „30 unter 30“, zählte sie also zu dreißig einflussreichen Persönlichkeiten der Tschechischen Republik, die noch keine dreißig Jahre alt waren.
Dabei sind weder Jakub noch Karel in der Kirche großgeworden. Sie suchten ihren Weg zum Glauben erst nach und nach an der weiterführenden Schule. Bald schon beschlossen sie, Theologie zu studieren, und begannen ihren Dienst in der Kirche. Karel unterrichtet zudem Ethik an einer Schule der Evangelischen Akademie. In ihren Regionen widmen sie sich hauptsächlich der Jugendarbeit, und sobald die epidemische Situation dies zulässt, wollen sie wieder „live“ mit den Kursen des christlichen Glaubens starten.
Sie nennen sich selbst scherzhaft die besten Youtuber unter den Pfarrern und die besten Pfarrer unter den Youtubern. Seit dem Frühjahr dieses Jahres arbeiten sie an einer regelmäßigen Sendung in einer der beiden größten digitalen Fernsehanstalten der Tschechischen Republik.
Jiří Hofman
DIE DIAKONIE DER EKBB
 Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Tel: (+ 420) 242 487 811 (812); Fax: (+420) 242 487 834
E-mail: info@diakonie.cz
Internet: www.diakonie.cz
Die Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) ist eine gemeinnützige christliche Organisation, die Hilfe und Unterstützung anbietet für ein würdiges und vollwertiges Leben, auch wenn es durch Alter, Krankheit, gesundheitliche Behinderungen, Isolation, schwierige soziale Situationen und andere Lebenskrisen beeinträchtigt ist. Die Dienste der Diakonie der EKBB erfolgen auf der Grundlage der Botschaft des Evangeliums von der Liebe Gottes und nach dem Vorbild des Dienstes Jesu Christi. In ihren Zentren und Spezial-Schulen bietet die Diakonie soziale, gesundheitliche, Bildungs- und Seelsorgedienste an. Unter den nicht-staatlichen Organisationen, die soziale Dienste anbieten, ist die Diakonie der EKBB die zweitgrösste Institution.
Warum es hilft ein Narr zu sein
 Unser Interview mit Pavel Novák, dem Leiter der Sozialeinrichtung für Kinder und Jugendliche der Diakonie Jablonec nad Nisou, haben wir, wie fast alles in dieser bewegten Zeit, online am PC geführt. Immerhin konnten wir uns hören und sehen, weshalb ich sicher bin, dass Pavel Novák sich tatsächlich an seinem Arbeitsplatz befindet. Das ist ziemlich wichtig, schließlich müssen die Menschen, mit denen er arbeitet, definitiv Vertrauen zu ihm gewinnen.
Unser Interview mit Pavel Novák, dem Leiter der Sozialeinrichtung für Kinder und Jugendliche der Diakonie Jablonec nad Nisou, haben wir, wie fast alles in dieser bewegten Zeit, online am PC geführt. Immerhin konnten wir uns hören und sehen, weshalb ich sicher bin, dass Pavel Novák sich tatsächlich an seinem Arbeitsplatz befindet. Das ist ziemlich wichtig, schließlich müssen die Menschen, mit denen er arbeitet, definitiv Vertrauen zu ihm gewinnen.
Der fast Vierzigjährige besuchte das Gymnasium in Semily und absolvierte dann ein Studium an der Pädagogischen Fakultät der Jan-Evangelista-Purkyně Universität in Ustí nad Labem. Anschließend widmete er sich allerdings nicht der Pädagogik, sondern nahm direkt eine Stelle bei der Diakonie der EKBB an. Pavel Novák lebt mit seiner Familie in Vysoké nad Jizerou und hat drei Kinder im Alter von sechs, fünf und drei Jahren: Die Namen von Vilemína, Hubert und Felix sollten einen Kontrast zum klassischen Nachnamen „Novák“ darstellen.
Lag Ihnen nach dem Studium nicht so viel daran zu unterrichten?
Ich wollte mich auf jeden Fall mit Jugendlichen beschäftigen, aber eine Stelle als Lehrer habe ich in der Nähe meines Wohnorts nicht gefunden. Als im Jahr 2009 die Diakonie in Jablonec eine Sozialeinrichtung für Kinder und Jugendliche eröffnete, hat mich das sehr interessiert. Und sie haben mich genommen.
Wenn Sie als Lehrer ohne Lehrerfahrung in einer sozialen Einrichtung anfangen, brauchen Sie da keine Fortbildung? Wollte man von Ihnen kein Diplom, keine Zusatzqualifikation?
Tatsächlich konnte ich formell die Arbeit als Sozialarbeiter nicht ausüben. Ich musste eine Umschulung zum Sozialarbeiter machen. Die wurde damals vom tschechischen Streetwork-Verband eigens für die Arbeit in niedrigschwelligen Sozialeinrichtungen angeboten. Ich habe viele wirklich nützliche Dinge gelernt, zum Beispiel wie man seine Besucher voranbringen kann.
Als Leiter eines solchen Sozialangebots, sitzen Sie da eher am Schreibtisch oder arbeiten Sie direkt mit den Kindern?
Ich mache beides. Aber den größten Teil der Zeit verbringe ich schon mit den Besuchern. Ich leite zwei niedrigschwellige Sozialangebote und bin darüber hinaus als Sozialarbeiter in einem Projekt namens Kruháč aktiv.
Das Thema dieser Ausgabe ist „Hoffnung“. Das ist ein Begriff, über den oft gesprochen wird, mit dem wir irgendwie umgehen, aber kann er uns in der Praxis tatsächlich irgendwie helfen? Kann er einen im Alltag stützen? Bedeutet er dasselbe wie Sinnhaftigkeit?
Ich möchte nicht pathetisch sein, aber ich glaube, dass ohne ein gewisses Gefühl der Hoffnung diese Arbeit nicht machbar wäre. Ich halte das wirklich für eine grundlegende Voraussetzung. Woran mache ich das fest? Innerhalb der elf Jahre, die ich hier arbeite, hat sich hier eine Reihe von Kollegen abgewechselt, die mit dem offensichtlichen Willen kamen zu helfen, nur war dieser Wille bald ausgeschöpft und sie sind wieder gegangen. Bei anderen hingegen geht der Wille nicht verloren und das liegt daran, dass sie sich der Hoffnung in ihrer Arbeit bewusst sind. Vielleicht muss man dazu sagen, dass der Mensch für diese Arbeit ein bisschen ein „Narr“ sein muss.
Wie meinen Sie das?
Wir stoßen Tag für Tag darauf, dass diese Hoffnung irgendwie zu Nichte gemacht wird. Was wir planen funktioniert überhaupt nicht, manchen Menschen helfen wir über mehrere Jahre und es sieht „hoffnungsvoll“ für sie aus, aber dann verschwinden sie ... Deshalb sage ich ein „Narr“, man muss etwas einfältig sein. Die Hoffnung muss sozusagen losgelöst von der Arbeit existieren, sie muss darüber stehen, unabhängig.
Wie fühlen Sie sich in diesem Zusammenhang bei der Arbeit? Wie ergeht es Ihnen als ein solcher „Narr“?
Ganz gut eigentlich. Es ist sehr spannend, ein Abenteuer. Unsere Jugendlichen sind besondere Charaktere und sie verhalten sich sehr unerwartet, das ist nie langweilig. Genau deshalb, weil sie so sind wie sie sind, geraten sie ständig in Schwierigkeiten.
Wie sieht also ein gewöhnlicher Arbeitstag von Ihnen aus?
Zunächst hat dieser gewöhnliche Arbeitstag relativ ungewöhnliche Arbeitszeiten. Wir fangen erst um 10 Uhr an und hören um halb sieben abends auf. Das finde ich nicht so gut, weil ich erst abends nach Hause komme. Morgens fange ich auf der Arbeit mit Verwaltungsaufgaben an, davon gibt es nicht wenig: individuelle Pläne, Verträge, Vorbereitung und so weiter. Von 13 bis 18 Uhr kommen dann unsere Besucher. Es sind grob geschätzt etwa 30 am Tag.
Was passiert dann am Nachmittag?
Das hängt von der Altersgruppe der Besucher ab. Dem Gesetz entsprechend haben wie die volle Altersspanne – von sechs bis 26 Jahren. Aber die Mehrheit ist nicht über 20. Es kommen Kinder und Jugendliche aus Roma-Familien, für die wir eine gute Alternative zum Rumhängen auf der Straße sind. Die jüngeren brauchen irgendeine Form der Unterhaltung, es muss ihnen hier gefallen, sonst kommen sie nicht. Dabei helfen wir dann zum Beispiel bei den Schulaufgaben. Die Älteren haben meist schon ein konkretes Anliegen mit dem sie zu uns kommen. Ein ernsthaftes Problem ist, dass in den letzten zirka drei Jahren immer mehr Menschen kommen, deren Existenz akut bedroht ist und das obwohl sie noch sehr jung, 18, 20 Jahre alt, sind. Wir begleiten sie zum Amt, helfen ihnen Arbeit und Wohnung zu finden und besprechen ihre persönlichen Probleme mit ihnen. Außerdem machen wir Streetwork, dabei geht es darum direkt auf den Straßen etwas zu bewirken.
Was macht das für einen Eindruck in der Umgebung, wenn Sie auf der Straße arbeiten?
Man hält uns ein bisschen für Narren, aber darüber sprachen wir schon. An den meisten Orten, wo wir arbeiten, kennt man uns und die Menschen haben sich an uns gewöhnt. Wir müssen uns die Hoffnung erhalten, dass es Sinn macht, obwohl es manchmal fast albern wirkt. Auf der Straße können wir einerseits auf jemanden treffen, den wir schon kennen, aber der uns irgendwie abhanden gekommen ist, auf der anderen Seite leisten wir Vorsorgearbeit, wir suchen aktiv potentielle Besucher. Ich glaube, darin sind wir ziemlich gut. Wir sind nicht aufdringlich, sondern wirken eher sympathisch. Das sieht man daran, dass die Betreffenden Interesse zeigen. Wir haben unsere eigenen Ansätze wie wir vorgehen, damit wir nicht aussehen wie ein Überfallkommando oder wie Straßenhändler.
Und wie sieht es jetzt in der Coronapandemie bei Ihnen aus?
Es ist alles ein bisschen zerstört. Die Besucher kommen in Kleingruppen oder einzeln. Und was die Arbeit vor Ort auf der Straße angeht, versuchen wir über soziale Netzwerke die Leute trotzdem anzusprechen. Das, was normalerweise auf der Straße oder bei uns in der Einrichtung passieren würde, geschieht halt jetzt auf Facebook.
Die Arbeit scheint Ihnen Freude zu bereiten, sie halten sich geradezu närrisch an das Prinzip Hoffnung. Aber gibt es nicht von Zeit zu Zeit Dinge, die Ihre Hoffnung ein wenig erschüttern?
Es kommt zum Beispiel nicht selten vor, dass uns hier einer verloren geht. Da kann es sein, dass einer von unseren Besuchern etwas klaut. Damit muss man rechnen. In der Regel ist das dann jemand, der bei uns neu ist. Oder jemand, der wirklich in große Schwierigkeiten geraten ist. Oder jemand, der sich an uns rächen möchte.
Wieso sollte sich jemand rächen wollen?
Es gibt viele Dinge, die unseren Kindern und Jugendlichen Freude bereiten, aber wir verlangen auch, dass gewisse Regeln eingehalten werden und das finden sie dann nicht mehr so toll, das ist manchmal neu für sie. Aber wenn sie diese Regeln nicht einhalten, dann hat das Konsequenzen. Sie kriegen zum Beispiel Hausverbot, für einen Tag oder manchmal auch länger. Dann denken sie, dass sie uns das zurückgeben müssen und wenn sie gehen, stecken sie irgendetwas ein und verschwinden damit. Wer das war, erkennt man zum Beispiel daran, dass der Betreffende plötzlich nicht mehr kommt. Aber wir nehmen das nicht allzu ernst. Es ist verständlich, das sind Menschen, die wirklich oft nicht einmal was zu Essen haben und auf der Straße schlafen. Im Endeffekt erschüttert es meine Hoffnung dann doch nicht so.
Wenn diese Hoffnung über den Dingen liegt und unabhängig ist, wie Sie sagen, dann ist sie auch ein bisschen theoretisch, oder? Oder äußert sie sich irgendwie konkret? Vielleicht durch Lob? Sehen Sie manchmal offensichtliche Erfolge?
Das gibt es sicher. Die Kinder geben uns auf gewisse Art etwas zurück. Das ist kein direktes Lob, aber wenn sie Dinge sagen wie – „Pavel, das hast du mir beigebracht!“, dann freut mich das natürlich! Das ist die Würze, ohne die jedes Essen langweilig wäre. Aber ich komme noch einmal auf diese gewissen Torheit zurück, die mit der Arbeit einhergeht – vierzigmal funktioniert es nicht, aber wenn der einundvierzigste kommt sage ich nicht, dass es von vorneherein klar ist, dass es keinen Sinn hat. Im Gegenteil, ich versuche es erneut, als ob er der erste wäre.
Haben Sie ein Beispiel dafür?
Es gibt hier sehr viele sehr junge Menschen, die früh ins Sexualleben einsteigen. Sie sind etwa 15, 16 Jahre alt, Jungen und Mädchen. Wir wissen das und denken uns eine ganze Reihe präventiver Maßnahmen aus. Wir sprechen mit ihnen, auch über Familienplanung und sie scheinen uns verstehen und die Prävention sinnvoll zu sein. Aber dann ist jemand 15, wirft alle unsere Ratschläge in den Wind und stürzt sich Hals über Kopf in das Abenteuer mit all seinen Folgen. Und das ist für mich genau jener Einundvierzigste. Aber ich muss dazu sagen, bei guter präventiver Arbeit ist das Ergebnis, dass „nichts passiert“. Also, das heißt nichts Schlimmes. Wir erfahren zwar, dass diesem oder jenem Jugendlichen dieses oder jenes passiert ist, aber wir erfahren nicht, was passiert wäre, wenn wir nichts unternommen hätten. Es könnte immer noch viel schlimmer sein! Es ist daher nicht immer einfach abzuschätzen, welchen Einfluss unsere Arbeit tatsächlich hat. Manch einen Besucher verlieren wir völlig aus den Augen und dann wissen wir nicht, was aus ihm wird und was unsere Arbeit bewirkt hat. Dann sagt uns sein Kumpel, dass er in Kanada ist.
Der Einundvierzigste ist also ein Beweis dafür, dass es immer Hoffnung gibt, wenn ich nur ein Narr genug bin?
Ja. Völlig unabhängig davon, ob das sinnvoll ist, ob das Erfolg haben wird, versuche ich es einfach noch einmal. Mich macht das nicht fertig. Wenn wir uns dann auf der Arbeit über diese Dinge unterhalten und uns gegenseitig von diesen vergeblichen Versuchen erzählen, dann lachen wir darüber. Über uns selbst lachen wir dann, nicht über unsere Besucher! Ob das sinnvoll ist? Natürlich verfolgen wir die Ergebnisse, gerade für Berichte müssen wir einige Statistiken anfertigen, aber das ist nicht ausschlaggebend für uns. Das hat nichts mit der Energie zu tun, die wir in unsere Arbeit stecken.
Überkommt sie nicht trotzdem manchmal der Gedanke, dass Sie das alles besser sein lassen sollten?
Natürlich gibt es Dinge, die mich aufregen, ja. Aber das hat nichts mit unseren Besuchern zu tun. Das hängt eher damit zusammen, wie uns die Öffentlichkeit wahrnimmt, bzw. inwiefern wir unterstützt werden. Mit der Einstellung in der Gesellschaft. Ich weiß nicht, woher die bei den Leuten kommt – damit meine ich diejenigen, die entscheiden, ob wir weitermachen können oder nicht. Aber der Gedanke alles aufzugeben kam mir noch nicht. Eigentlich möchte ich gerne weiterhin dieser Narr sein.
Wenn Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen, wo sehen Sie sich in Zukunft? Wollen Sie hier weitermachen?
Ja. Das ist zwar nicht sehr fantasievoll, aber so ist es nun mal.
Jana Plíšková
DIE EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT DER KARLSUNIVERSITÄT IN PRAG (ETF UK)
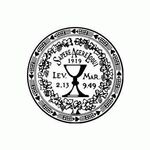 P.O. Box 529, Černá 9,
P.O. Box 529, Černá 9,
CZ 115 55 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 221 988 211; Fax: (+ 420) 221 988 215
E-Mail: intl@etf.cuni.cz
Internet: http://web.etf.cuni.cz/ETFENG-1.html
Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Karlsuniversität (ETF UK) ist die Nachfolgerin der Jan-Hus- Fakultät (1919–1950) und der Comenius-Fakultät (1950–1990). Im Jahr 1990 wurde sie in die Karlsuniversität eingegliedert. Die Verwaltung der Fakultät wird vom Dekan und dem Team der Prodekane geleitet, die auf vier Jahre in ihr Amt gewählt werden. Die Fakultät bietet Bakkalaureats- und Master-Studiengänge an – in evangelischer Theologie, Diakonie (Seelsorge und Sozialarbeit), ökumenische Studien, und verschiedene theologische Bereiche auf Doktoranden-Ebene. Die Fakultät ist ökumenisch für alle offen. Pfarrerinnen und Pfarrer der EKBB erhalten hier ihre Ausbildung.
Kurs für Krankenhauskapläne an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Karlsuniversität
 Am Freitag, dem 4. Dezember 2020, fand an der Evangelisch-Theologischen Fakultät (ETF) der Karlsuniversität der feierliche Abschluss des nunmehr fünften Qualifizierungskurses zum „Krankenhauskaplan“ statt. Der Kurs im Umfang von 310 Stunden wird von der ETF in Zusammenarbeit mit der Katholischen Theologischen Fakultät der Karlsuniversität, der Vereinigung der Krankenhauskapläne der Tschechischen Republik und einzelnen Kirchen in der Tschechischen Republik organisiert. Der erfolgreiche Abschluss des Kurses ist Voraussetzung für die Arbeit von Geistlichen in medizinischen Einrichtungen.
Am Freitag, dem 4. Dezember 2020, fand an der Evangelisch-Theologischen Fakultät (ETF) der Karlsuniversität der feierliche Abschluss des nunmehr fünften Qualifizierungskurses zum „Krankenhauskaplan“ statt. Der Kurs im Umfang von 310 Stunden wird von der ETF in Zusammenarbeit mit der Katholischen Theologischen Fakultät der Karlsuniversität, der Vereinigung der Krankenhauskapläne der Tschechischen Republik und einzelnen Kirchen in der Tschechischen Republik organisiert. Der erfolgreiche Abschluss des Kurses ist Voraussetzung für die Arbeit von Geistlichen in medizinischen Einrichtungen.
Von den zwölf Absolventen arbeitet bereits die Hälfte in Krankenhäusern, die übrigen befinden sich derzeit in der Vorbereitungsphase und sammeln Erfahrungen. Der theoretische Teil der Ausbildung ist mit dem praktischen so eng wie nur möglich verknüpft, damit die Kapläne schon mannigfaltige Situationen mit Patienten, ihren Angehörigen und dem Krankenhauspersonal erleben und dabei ihre Arbeit und ihre Einstellungen im medizinischen Umfeld durchdenken können. Dazu absolvieren sie sowohl Kurse im Bereich des medizinischen Rechts oder der Ethik als auch in spezieller Seelsorge und im Management. Insgesamt drei einwöchige Praktika, die die Kapläne in drei verschiedenen Krankenhäusern unter Anleitung erfahrener Kapläne absolvieren, sind eine großartige Schule für Kommunikation und Selbsterkenntnis.
Einer der wichtigen und wertvollen Aspekte des Kurses ist die ökumenische Zusammenarbeit. Sowohl die Kursleiter als auch die Leiter der Praktika stammen aus mindestens drei Kirchen, die Teilnehmer selbst repräsentierten fünf Kirchen. Zweifelsohne ist in unserem Land die ökumenische Zusammenarbeit zwischen Kirchen eine Grundvoraussetzung für die Arbeit eines Kaplans, aber auch die Fähigkeit, mit Menschen anderer Religionen sowie mit solchen, die sich zu gar keinem Glauben bekennen, ins Gespräch zu kommen. Essentiell auch die Kunst, in multidisziplinären Teams zusammenzuarbeiten. Der Kurs bietet in dieser Hinsicht unschätzbare Erfahrungen.
Der Kurs war, wie andere Lehrveranstaltungen, von der Situation um COVID-19 geprägt. Trotzdem unterstrichen die Erfahrung des Online-Unterrichts, die neuen Möglichkeiten der Seelsorge, der Austausch mit Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, und die seelsorgerischen Gespräche mit Patienten, die keine Besuche empfangen durften, die Bedeutung des Dienstes von Kaplänen und fügten dem Kurs eine neue Dimension hinzu. Nun blicken wir bereits dem nächsten Ausbildungszyklus entgegen.
Dr. Ladislav Beneš, Lehrstuhl für praktische Theologie an der ETF der Karlsuniversität
Bachelor-Studiengang an der ETF
 Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Karlsuniversität in Prag bietet jetzt nicht nur ein Masterstudium, sondern auch ein Bachelor-Studienprogramm auf Englisch an. Einer der Gründe für die Einrichtung des Bachelor-Programms in englischer Sprache war, dass die Bewerber für das Master-Programm häufig eine der Bedingungen, nämlich den Abschluss in Alten Sprachen, nicht erfüllten.
Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Karlsuniversität in Prag bietet jetzt nicht nur ein Masterstudium, sondern auch ein Bachelor-Studienprogramm auf Englisch an. Einer der Gründe für die Einrichtung des Bachelor-Programms in englischer Sprache war, dass die Bewerber für das Master-Programm häufig eine der Bedingungen, nämlich den Abschluss in Alten Sprachen, nicht erfüllten.
Das Bachelor-Studienprogramm „Evangelische Theologie“ konzentriert sich hauptsächlich auf Grundkenntnisse der Theologie und ihre systematischen, historischen und kulturellen Dimensionen. Die Absolventen sind in der Lage, mit biblischen Texten in ihren ursprünglichen Sprachen zu arbeiten, wobei sie moderne Methoden nutzen. Sie verfügen über grundlegende Fähigkeiten beim Verstehen und Interpretieren von Texten (insbesondere der christlichen Tradition) und können diese in ihren entsprechenden literarischen, historischen und ideologischen Zusammenhängen interpretieren.
Besonderes Augenmerk wird auf den Erwerb von Kenntnissen der wichtigsten Weltreligionen, des philosophischen Denkens, der christlichen Ethik und ökumenischer Fragen gelegt.
Die Absolventen werden auf die weitere akademische Arbeit und einen Bachelor-Aufbaustudiengang in verwandten Bereichen vorbereitet. Auch können sie erfolgreich in den Arbeitsmarkt eintreten, wenn eine geisteswissenschaftliche Ausbildung erforderlich ist und Kenntnisse von wertorientiertem Denken und religiösen Fragen von Vorteil sind, zum Beispiel im Bildungs-, Kultur- und humanitären Bereich.
Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Webseite: etf.cuni.cz
Kristýna Kadlecová
Exkursion nach Theresienstadt
 Am Dienstag, den 15. Dezember 2020, bot das Erasmus-Büro der ETF einen Tagesausflug für die ausländischen Studierenden der Fakultät in das ehemalige Ghetto und Konzentrationslager Theresienstadt (Terezín) an. Das könnte man für sehr ungewöhnlich in der Adventszeit halten, aber in diesen Tagen waren die äußeren Umstände für Unternehmungen in Gruppen ausnahmsweise günstig. Es konnten sogar noch einige Kommilitonen anderer Fakultäten daran teilnehmen.
Am Dienstag, den 15. Dezember 2020, bot das Erasmus-Büro der ETF einen Tagesausflug für die ausländischen Studierenden der Fakultät in das ehemalige Ghetto und Konzentrationslager Theresienstadt (Terezín) an. Das könnte man für sehr ungewöhnlich in der Adventszeit halten, aber in diesen Tagen waren die äußeren Umstände für Unternehmungen in Gruppen ausnahmsweise günstig. Es konnten sogar noch einige Kommilitonen anderer Fakultäten daran teilnehmen.
Als Deutscher halte ich persönlich eine Begegnung mit einem solchen Ort für eine unverzichtbare Erfahrung für mich selbst und jeden anderen Studierenden. Speziell Theresienstadt erinnert an die Verlogenheit und Hinterhältigkeit des Naziregimes im Umgang mit jüdischen Menschen, gegenüber den Gefangenen selbst, der örtlichen Bevölkerung wie auch der Weltöffentlichkeit. Eine einführende Präsentation, verschiedene Ausstellungen und eine kundige Führung durch das Ghetto, den Friedhof und das Gestapogefängnis führten uns das Ausmaß der gewissenlosen Härte vor Augen, mit der Tausende eingepfercht oder weitertransportiert wurden in die Gaskammern in den weiter östlich gelegenen Lagern. Den stärksten Eindruck hinterließen bei mir die Leichenhallen und das Krematorium. Selbst nach ihrem Sterben gab es keinen Respekt für diese Menschen, deren Leichen gegen die Praxis ihrer Religion verbrannt wurden; die Asche wurde später in den Fluss geschüttet, um die Zahl der Todesopfer zu verschleiern. Dieser Ort kam mir vor wie ein einziger Schrei, auf den mir die Antwort fehlt. Hoffentlich wird sie der kommende Erlöser bringen…
Wir sind Věra Fritzová und Kristýna Kadlecová dankbar für die Organisation dieser Unternehmung unter schwierigen Umständen. Auch wenn der Tag fast etwas überfüllt war an Information, wird er in Erinnerung bleiben als bedeutendes Ereignis in unserem Semester.
Michael Klein, Evangelische Theologie
