Bulletin 51 – Weihnachten 2020
Liebe Leserinnen und Leser,
Auf große und größere Jahrestage ist es immer gut hinzuweisen. Ihre Bedeutung verliert sich nicht, sie gilt immer, heute genauso wie vor einigen hundert Jahren. Jahrestage soll man sich bewusst machen. Diesmal bieten wir drei Jahrestage an und alle sind mehr oder weniger mit der Existenz unserer Kirche, der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder, verbunden.
Bulletin 51 – Weihnachten 2020
Die Schlacht auf dem Weißen Berg hat am 8. November 1620 stattgefunden. Es sind also genau 400 Jahre, und wie damals, so fällt auch der Jahrestag am 8. November auf einen Sonntag. Das Gedenken an diesen Jahrestag wurde lange vorbereitet, doch wegen der Covid-19 Pandemie musste es stark reduziert werden, was aber die Bedeutung dieses Jahrestages keinesfalls mindert! Was bedeutet für Böhmen die Schlacht selber und die Zeit danach, der dreißigjährige Krieg und die „dunkle Zeit“? Während der gewaltsamen Rekatholisierung ging bis zu einer halben Million Einwohner ins Exil. Es ist ein tiefer Einschnitt, dessen sich die Angehörigen der protestantischen Kirchen, aber auch der katholischen Kirche bewusst sind. Und so versuchen die Kirchenvertreter bei den „alljährlichen Feiern“ eine gemeinsame Stellung zu diesem Ereignis zu finden. Und ich denke, dass dies in den letzten Jahren gelingt.
Der zweite Jahrestag knüpft an den ersten an. Vor 350 Jahren starb Jan Amos Comenius, Bischof der Brüderunität, Pädagoge und Philosoph, „Lehrer der Völker“, auch er wurde gezwungen, in der besagten „dunklen Zeit“ aus unserem Land definitiv wegzugehen.
Der dritte Jahrestag gehört nun schon in unsere Gegenwart, in die fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, in die Zeit der kommunistischen Tschechoslowakei. Unter mehr als zweihundert vom damaligen Regime Hingerichteten war eine einzige Frau, die hervorragende Juristin Milada Horáková. Ein Mitglied der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder. Dieses Jahr im Juni waren es 70 Jahre seit ihrer Ermordung.
Liebe Freunde, die Bedeutung von Weihnachten verändert sich nicht, das Coronavirus wird daran nichts ändern, höchstens die Bedeutung von Weihnachten noch vertiefen.
Halten wir uns an die Hoffnung in guten und schlechten Zeiten!
„Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsre Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern: Der HERR hat Großes an ihnen getan!“ (Psalm 126,1–2)
Jana Plíšková
DIE EVANGELISCHE KIRCHE DER BÖHMISCHEN BRÜDER
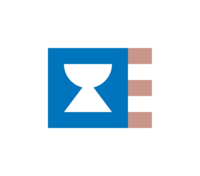 P.O. Box 466, Jungmannova 9,
P.O. Box 466, Jungmannova 9,
CZ 111 21 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 224 999 215(216); Fax: (+ 420) 224 999 219
E-Mail: ekumena@e-cirkev.cz
Internet: www.e-cirkev.cz
Die Grundlagen der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) wurzeln in der Utraquistischen Kirche (1431–1620) und in der Brüderunität ((1457–1620). Die EKBB entstand in ihrer heutigen Gestalt im Jahr 1918 durch den Zusammenschluss der bis dahin selbständigen evangelischen Kirchen Augsburger und Helvetischen Bekenntnisses. Deren Existenz wurde nach dem Ende der harten Gegenreformation, die von 1620 bis zum Erlass des Toleranzpatens durch Kaiser Joself II. im Jahr 1781 dauerte, erlaubt. Die strengen Beschränkungen mussten die Evangelischen freilich auch danach beachten, bis zum Erlass des Protestantenpatentes im Jahr 1861.
In der Zeit ihrer Entstehung hatte die EKBB 250 000 Mitglieder, im Jahre 1938 waren es dann schon 325 000 Mitglieder. Heute ist die Kirche in 14 Seniorate aufgeteilt mit einer Gesamtzahl von 250 Gemeinden und ca. 80 000 Gemeindegliedern. Die Kirche wird vom sechsköpfigen Synodalrat geleitet, der auf sechs Jahre gewählt wird. Repräsentiert wird die Kirche vom Synodalsenior und vom Synodalkurator.
Eine Botschaft an den postmodernen Menschen. Wie sich der Lebenslauf eines jungen italienischen Studenten mit den Ereignissen längst vergangener Tage kreuzt
 Ich, Alberto Rocchini, komme aus Pavia in Italien, wo ich Literatur und Geschichte studierte. Während eines Studienaufenthalts in Mainz in Deutschland, habe ich angefangen mich für die Reformation zu begeistern und nach meiner Rückkehr nach Italien bin ich in die Waldenserkirche eingetreten. Diese kleine Kirche (in Italien etwa 50000 Mitglieder) breitete sich von ihrem ursprünglichen Zentrum in den Alpen an der Grenze zwischen Italien und Frankreich nach dem Toleranzedikt des Piemonter Königs Karl Albert im Jahr 1848 immer weiter aus. Die Waldenserkirche ist der Nachfolger jener mittelalterlichen Bewegung, die von Petrus Waldes aus Lyon angeführt wurde. Schon im Jahr 1532 schloss sie sich mit den Beschlüssen der Synode von Chanforan der Genfer Reformationsbewegung an. Siepflegte außerdem konstruktive Kontakte zu den Böhmischen Brüdern.
Ich, Alberto Rocchini, komme aus Pavia in Italien, wo ich Literatur und Geschichte studierte. Während eines Studienaufenthalts in Mainz in Deutschland, habe ich angefangen mich für die Reformation zu begeistern und nach meiner Rückkehr nach Italien bin ich in die Waldenserkirche eingetreten. Diese kleine Kirche (in Italien etwa 50000 Mitglieder) breitete sich von ihrem ursprünglichen Zentrum in den Alpen an der Grenze zwischen Italien und Frankreich nach dem Toleranzedikt des Piemonter Königs Karl Albert im Jahr 1848 immer weiter aus. Die Waldenserkirche ist der Nachfolger jener mittelalterlichen Bewegung, die von Petrus Waldes aus Lyon angeführt wurde. Schon im Jahr 1532 schloss sie sich mit den Beschlüssen der Synode von Chanforan der Genfer Reformationsbewegung an. Siepflegte außerdem konstruktive Kontakte zu den Böhmischen Brüdern.
Nach verschiedenen Arbeits- und Lebenserfahrungen bin ich von Wien über Brünn nach Prag gekommen, wo ich als Lehrer für Deutsch und Italienisch arbeitete. In Tschechien habe ich mehr über die hussitische Reformation gelernt und dass sie Teil der sogenannten „ersten Reformation“ ist, so wie die Waldenserbewegung auch. Im Jahr 2013 habe ich mich dann für Theologie an der Hussitisch-Theologischen Fakultät der Karlsuniversität eingeschrieben. Im Herbst diesen Jahres beende ich mein Masterstudium mit einer Arbeit über die Waldenserkirche, ihre Geschichte, Gedanken und Organisationsstruktur.
Ich bin Mitglied in der Kirche der Böhmischen Brüder und wenn Gott mich länger in Tschechien leben lässt, dann möchte ich als Pfarrer dienen. Ich würde gerne die geschichtlichen Verbindungen und heutigen theologischen Beziehungen zwischen der böhmischen und der italienischen Kirche verdeutlichen und vertiefen. Beide sind schließlich Erben der ersten Reformation und trotz unterschiedlicher soziologischer Kontexte verkünden sie dem postmodernen Menschen mutig und selbstbewusst das Evangelium unseres Herren.
Ein paar Gedanken aus der Abschlussarbeit von Albert Rocchini:
Ich habe versucht historische Schlüsselereignisse, die zur Entstehung der Waldenserbewegung Ende des 12. Jahrhunderts führten, chronologisch zu skizzieren. Typisch ist die enge Beziehung zur helvetischen Reformation im 16. Jahrhundert, die Emanzipation zur Zeit der Savoyen und dann des italienischen Staats und die Verbreitung des Evangeliums über Diasporen, die die Waldenserkirche bis heute charakterisiert. Ich wollte die sich entwickelnde Waldenserbewegung zeigen, die in neun Jahrhunderten evangelischen Zeugnisses und schlimmster Verfolgung in Europa ein alternatives, „nicht-konstantinisches“ Kirchenmodell von Männern und Frauen verbreitet hat, die für das Evangelium unseres Herren Christus brennen und die, wie auch der Apostel Paulus, von den Worten ermutigt werden: „Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte!“ (1. Kor, 9,16)
Es war mir ein Anliegen, die engen Beziehungen zwischen der Waldenser- und der Hussitenbewegung aufzuzeigen und wie sie sich gegenseitig bereichert haben: Wie die Waldenserbewegung die hussitische Revolution in Böhmen beeinflusst, vielleicht gar die Voraussetzungen dafür geschaffen hat und wie später die Waldenser auf dem akademisch-theologischen Gedankengut, das die Hussiten aus ihrer geopolitischen Situation schöpften, aufbauen konnten.
Gleichzeitig sollte die heutige Waldenserkirche mit ihrem reformierten Glauben, ihrer Struktur und ihren Hauptgedanken, die sie in die italienische Gesellschaft trägt, vorgestellt werden. Darüber hinaus präsentiere ich das sich seit 1975 entwickelnde Modell der Integration zwischen der Waldenserkirche und der Methodistischen Kirche. Das könnte ein Modell für weitere kleine europäische Kirchen sein, wie zum Beispiel die Tschechoslowakische Hussitische Kirche oder die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder.
Für einen kritischen italienischen Katholiken, der ein geistliches Zuhause sucht oder eine Alternative, wie er Christ in einer pluralistischen Gesellschaft sein kann, ist die kleine Waldenserkirche ein Licht, ein einfaches aber beständiges, wie es von einer Kerze kommt oder von einer geöffneten Bibel auf dem Altar. Ihr Erbe der Reformation – sola fide, sola gratia, sola skriptura (allein durch den Glauben, allein durch die Gnade, allein durch die Schrift) – ist befreiend und führt gleichzeitig zu Verantwortung. Und genau das braucht unsere postmoderne, durch Individualismus und Relativismus geprägte Gesellschaft.
Treue bis ins Grab
 Vor einiger Zeit hatte Petr Jašek einen Traum. Einen Albtraum. Es war im Jahr 2013, als ihm träumte, er wäre in einer Zelle eingeschlossen, säße auf dem Boden auf eisigen Fliesen und schaute ins das, durch ein kleines Fenster oben in der verriegelten Tür herein strahlende Licht. Dieses Bild ließ ihn von da an nicht mehr los, umso mehr, als es zwei Jahre später, Ende 2015, Wirklichkeit wurde. Petr Jašek wurde im Sudan verhaftet und als Spion zu mehr als 20 Jahren Haftstrafe verurteilt. Dank der Bemühungen der tschechischen Regierung und der Botschafterin der Tschechischen Republik in Kairo wurde er im Jahr 2017 entlassen, in der offiziellen Version begnadigt von Präsident Al-Baschir. Über diese Ereignisse schrieb er ein Buch mit dem Titel „Gefangen mit dem IS: Glaube leben im Angesicht des Terrors“ (im Tschechischen: Snubní prsten za život – etwa Den Trauring gegen das Leben), das im November im Brunnen Verlag Gießen erscheint.
Vor einiger Zeit hatte Petr Jašek einen Traum. Einen Albtraum. Es war im Jahr 2013, als ihm träumte, er wäre in einer Zelle eingeschlossen, säße auf dem Boden auf eisigen Fliesen und schaute ins das, durch ein kleines Fenster oben in der verriegelten Tür herein strahlende Licht. Dieses Bild ließ ihn von da an nicht mehr los, umso mehr, als es zwei Jahre später, Ende 2015, Wirklichkeit wurde. Petr Jašek wurde im Sudan verhaftet und als Spion zu mehr als 20 Jahren Haftstrafe verurteilt. Dank der Bemühungen der tschechischen Regierung und der Botschafterin der Tschechischen Republik in Kairo wurde er im Jahr 2017 entlassen, in der offiziellen Version begnadigt von Präsident Al-Baschir. Über diese Ereignisse schrieb er ein Buch mit dem Titel „Gefangen mit dem IS: Glaube leben im Angesicht des Terrors“ (im Tschechischen: Snubní prsten za život – etwa Den Trauring gegen das Leben), das im November im Brunnen Verlag Gießen erscheint.
Petr Jašek ist ein Pfarrerskind, sein Vater war Pfarrer bei der EKBB.
Er studierte an der Prager Universität für Chemie und Technologie (VŠCHT) und absolvierte ein postgraduales Studium am Institut für Hämatologie und Bluttransfusion (ÚHKT) in Prag, an dem er 20 Jahre lang arbeitete. In den folgenden zehn Jahren von 1992 bis 2002 war er Direktor des Krankenhauses Počátky (Potschatek). In den neunziger Jahren war er einer der Mitbegründer des tschechischen Zweigs der International Christian Association (ICA), der auf Deutsch etwa Hilfe der verfolgten Kirche heißt und dessen Aufgabe es ist, verfolgten Christen in vielen Ländern der Erde zu helfen. Dieser Arbeit widmet Peter sich jetzt voll und ganz. Er lebt mit seiner Frau Vanda in Buštěhrad (Buckov) und besucht die Gemeinde der Böhmischen Brüder in Kladno. Sie haben eine Tochter und einen Sohn und schon die erste Enkelin.
Warum trägt Ihr Buch ausgerechnet diesen Titel (im Tschechischen etwa „Den Trauring gegen das Leben“, Anm. d. Ü.)?
In den ersten zwei Monaten meiner Gefangenschaft war ich in einer Zelle mit Kämpfern des Islamischen Staats. Die wollten meinen Ring als Gegenleistung dafür, dass sie mit einem Nichtmuslimen zusammenlebten. Damit sie ihn mir nicht mitsamt dem Finger abnahmen, habe ich ihnen den Ring lieber direkt gegeben. Hinterher haben meine Frau und ich uns neue gekauft...
Als Direktor haben Sie im Jahr 2002 im Krankenhaus aufgehört, was kam dann?
Dann habe ich schon angefangen für die ICA, unsere Schwesterorganisation in Amerika, zu arbeiten. Ziel unserer Arbeit ist es, Christen in aller Welt zu helfen, die verfolgt werden und Verletzung erlitten haben, hauptsächlich weil sie ihren Glauben nicht ablegen wollten. Wenn ein Christ nämlich den ihm angebotenen islamischen Glauben ablehnt, dann müssen ihm als Warnung die linke Hand und der rechte Fuß abgeschlagen werden. So hat Mohammed das gesagt. Und das betrifft auch Kinder. Unser medizinisches Programm zielt daher darauf ab, Menschen zu helfen, denen entweder ein oder beide Gliedmaßen amputiert worden sind.
Das ist sicherlich eine Tätigkeit, die dem Menschen große mentale Stärke abverlangt, das ist nichts für jedermann. Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, dass Sie sich in diesem doch recht spezifischen Bereich engagieren wollen?
Das geht zurück auf das Jahr 1978, als ich auf dem Gymnasium war und meine Familie Verhören der StB ausgesetzt war. Mein Vater zeigte mir zu der Zeit ein Buch des rumänischen Juden Richard Wurmbrand, das das für mich wichtigste Werk nach der Bibel wurde. Richard Wurmbrand durchlebte 14 Jahre kommunistische Haft, er wurde zweimal gefangen genommen, drei Jahre verbrachte er in einer Einzelzelle, nur wenige überlebten das. Dank ihm habe ich verstanden, dass der Mensch, wenn er wirklich seinem Glauben folgt und im Vertrauen auf Gott lebt, sich nicht zu fürchten braucht. Wenn er Gott vertrauen möchte, dann gibt Gott ihm auch Kraft. Im Jahr 1992 dann, als ich schon an der Uni war, habe ich gemeinsam mit Stanislav Forejt nach dem Vorbild Richard Wurmbrands den tschechischen Zweig der International Christian Association gegründet, wobei die tschechische Organisation Pomoc pronásledované církvi (etwa Hilfe der verfolgten Kirche) heißt. Es ging uns darum, in Ländern zu helfen, die nicht frei sind, genauso wie die Menschen aus dem Westen zur Zeit des Totalitarismus uns geholfen haben. Ausschlaggebend für die Gründung im Jahr 1967 war tatsächlich Richard Wurmbrand. Zunächst ist es wichtig, sich gegenseitig darüber zu informieren, wer verfolgt wird und diesen und deren Familien dann zu helfen. Einmal in zwei Monaten erscheint ein Bulletin, das „Hlas mučedníků“ (Die Stimme der Märtyrer) heißt.
Aber wie sieht Ihre Tätigkeit in der Praxis aus? Wenn Sie zu Hause sind, woher wissen Sie, was Sie tun müssen?
Auf der Erde gibt es ungefähr 70 Länder, in denen Christen verfolgt werden. Wir haben in diesen Ländern Zweigstellen und wissen daher, was wo notwendig ist. Wenn heutzutage irgendwo etwas passiert, dann weiß man das in dieser digitalisierten Welt sehr schnell. In Afrika gibt es in jedem Dschungel einen Mobilfunkbetreiber! Es gibt dort kein Wasser, keinen Strom, aber Handynetz. Ich bin dann Regionaldirektor geworden und war für die halbe Welt zuständig – von Pakistan über Europa bis ganz Afrika. Seit 2011 bin ich nur noch für Afrika verantwortlich, in Nigeria war ich in den letzten 15 Jahren fast 30 Mal, dort gab es mehrere schwerwiegende Fälle. In der Regel ist die ärztliche Versorgung eines Menschen, dem seine Gliedmaßen abgeschnitten worden sind, dort nicht auf dem Niveau, wie es notwendig wäre. So haben wir zum Beispiel im Norden Nigerias ein Prothesenlabor errichtet, in dem die modernsten Prothesen hergestellt werden können. Das Problem liegt eher darin, dass die Eingeborenen sich lieber mit einem Stumpf begnügen, als ein modernes Hilfsmittel zu tragen...
Sie sind ganz offensichtlich eine starke Persönlichkeit. Schließlich haben Sie eine Gefangenschaft in einer angsteinflößenden Welt hinter sich. Als Sie angefangen haben, müssen Sie sich diesen Risiken bewusst gewesen sein – wie sind Sie damit umgegangen?
Für mich war das eher eine Ehre. Es ging eher darum eine Schuld zu begleichen, etwas zurückzugeben, wie ich bereits gesagt habe. An die Gefahren habe ich nicht so sehr gedacht. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal eine Bibel in den Iran oder nach Algier geschmuggelt habe, war das eine Ehre für mich. Außerdem ist ein wichtiger Aspekt, dass es um Hilfe von Christen für Christen geht. Es geht um die Zusammengehörigkeit der einzelnen Gliedmaßen zum Körper, so wie es der Apostel Paulus gesagt hat – wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit!
Warum sind Sie eigentlich damals in den Sudan gefahren?
Ich bin dort im Dezember 2015 hingefahren um Verletzungen und Verbrennungen für finnische Spezialisten zu überprüfen und zu dokumentieren. Es ging um den Sohn eines muslimischen Geistlichen, der während seines Studiums in Khartum zum Christentum konvertiere, was dort ein Kapitalverbrechen ist. Der Geheimdienst warf eine Brandbombe auf ihn, die einen Großteil seines Körpers verbrannt hat.
Wie sehr war sich Ihre Familie den Gefahren bewusst?
Meine Frau nimmt meine Arbeit als meine Berufung wahr, sie identifiziert sich damit. Manchmal hat sie mich sogar begleitet und auch meine Tochter war mit mir in Nigeria. Sie studierte damals im zweiten Jahr Medizin und konnte dort die Verbände anlegen – wer hat schon die Gelegenheit solche Erfahrungen zu sammeln?
Als Sie damals in den Sudan gefahren sind, haben Sie damit gerechnet, dass man Sie verhaften könnte?
Damit muss man rechnen, nur auf der anderen Seite – wenn man irgendwo 15 Jahre lang hinfährt und immer heile und nach Plan zurückkommt, dann gewöhnt man sich irgendwie daran. Und gerade für den Sudan habe ich in Wien problemlos ein Visum bekommen, sie haben mich dort freundlich angelächelt und mir die Hand gedrückt... Vier Tage nach Khartum, das ist doch nichts.
Und als Sie eingesperrt wurden? Haben Sie geglaubt, dass jemand von draußen einschreitet? Oder haben Sie gedacht, dass sie dort für immer bleiben würden? Hätte man Sie auch umbringen können?
Der Mensch passt sich langsam irgendwie an. Erst glauben Sie, dass das nur ein paar Tage dauert, dann vielleicht einen Monat und wenn es dann immer länger wird... Nach vier Monaten Verhör haben sie mich einem Richter vorgeführt, der sieben Paragraphen verlesen hat, laut denen sie mich beschuldigten. Zwei von ihnen waren mit der Todesstrafe belegt. Weitere vier Monate hat die Untersuchung durch den Staatsanwalt gedauert, dann erst hat das Gerichtsverfahren begonnen. Ich würde sagen, dass ich mich nach und nach daran gewöhnt habe, aber die Hoffnung, dass sie mich freilassen, ist immer geblieben. Ganz sicher. Auch konkrete Ereignisse haben mir Kraft gegeben. Zum Beispiel als in eine überfüllte Zelle mit unmenschlichen Bedingungen ungefähr 12 Eritreer dazu kamen und ich auf einmal die göttliche Eingebung hatte zu ihnen zu gehen. Es gelang mir, mich zu ihnen durchzudrängen und ihnen das Evangelium zu verkünden. Und da sind wir wieder beim Glauben. Ich habe ihnen davon erzählt, wie ich meinem Glauben gefolgt bin und sie waren davon ergriffen. Wir haben zusammen gebetet und auf einmal hatte ich das Gefühl, dass dies der Grund war, aus dem ich monatelang hier festsaß. Es störte mich nicht mehr, dass sich alles so zog, denn vielleicht hatte ich ja hier eine bestimmte Aufgabe von Gott zu erledigen!
Hatten Sie die Möglichkeit zu erfahren, was bei uns für Ihre Freilassung unternommen wurde? Wussten Sie, dass eine Petition unterschrieben und eine Gebetskette angeleitet wurde?
Mir hat insbesondere der Besuch von unserem Konsul in Ägypten sehr geholfen; der erste war elf Tage nach meiner Verhaftung. Ich wusste, dass unsere Botschafterin in Ägypten ebenfalls radikale Schritte unternimmt. Aber von den Ereignissen hier bei uns erfuhr ich erst aus Briefen, die ersten kamen etwa nach drei Monaten. Die Situation war zu der Zeit besser als im letzten Gefängnis. Die Wärter verkauften dort neben Drogen auch Handys, so konnte ich wieder Anschluss an die Welt finden. Telefone sind zwar verboten dort, aber jeder hat eins. Es haben sogar die Gefangenen selbst mit Hilfe ihrer Smartphones die Petition für meine Freilassung unterschrieben – es kamen eine halbe Millionen Unterschriften zusammen! Oder ich konnte auf YouTube eine Demonstration für meine Freilassung vor der Botschaft des Sudans in Madrid sehen, da konnte ich meine Tränen kaum zurückhalten. Es hat mir auch sehr geholfen, dass im letzten Gefängnis eine Kapelle war.
Wie ist das möglich?
Es gab dort auch eine Moschee und weil dort auch Gefangene aus dem Südsudan waren, Christen, mussten sie ihnen verfassungsgemäß eine Kapelle zur Verfügung stellen, auch wenn das nur eine hergerichtete Zelle war. Als mein „Luxusaufenthalt“ in der Einzelzelle beendet war, kam ich in eine Zelle, in der hundert Menschen auf einmal waren, aber plötzlich hatten wir eine Kapelle. Ich habe mich oft mit zwei sudanesischen Pastoren unterhalten und die haben gesagt: „Du hast eine Bibel, also predigst du zuerst.“ Als ich noch auf meiner Einzelzelle war und die Bibel las, hatte ich einen ganzen Stoß Notizen vorbereitet und so konnte ich jetzt predigen. In einem Gefängnis im Sudan! Und das sogar fünfmal die Woche!
Ich verstehe, dass das sicher eine große Veränderung war, aber ich kann mir dennoch nicht ganz vorstellen, wie es Ihnen gelungen ist in der ganzen Zeit nicht aus dem inneren Gleichgewicht zu kommen.
Natürlich war ich nicht glücklich. Am schlimmsten war es immer morgens. Das erste Essen gab es immer erst um eins, das Trinkwasser war braun und man musste immer erst abwarten bis sich der Schlamm unten absetzte und natürlich überkamen mich auch depressive Gedanken. Als ich aber angefangen hatte zu predigen, da wurde diese morgendliche Trauer weniger. Die Gewissheit, dass Gott dort für mich Arbeit hatte, war eine große Sache. Am Anfang kamen zu den Gottesdiensten etwa 20 Menschen, aber nach und nach wurden es immer mehr und als ich 2016 am Heiligen Abend predigte, kamen mehr als 200 Menschen. Es kamen sogar Muslime. Am Ende war es mir fast egal wie lange ich dort noch blieb – ich würde dort so lange sein, wie Gott es für mich vorsah. Auch hier geht es wieder um den Glauben – wenn der Mensch sein Leben in Christus Hände legt, dann muss er damit rechnen, dass Gott ihn an Orte führt, die nicht unbedingt angenehm sind, denn der Bibel zufolge ist die Verfolgung der Christen ein untrennbarer Bestandteil ihres Lebens. Aber warum? Warum hasst die Welt Christen? Weil sie nicht von dieser Welt sind! Weil sie gefährlich sind! Weil der sudanesischen Präsident Al-Bashir Christen hasst.
Ich habe gehört, dass man Ihnen im Gefängnis angeboten hat Muslim zu werden und dass man Sie dann freigelassen hätte. Glauben Sie, dass man Sie wirklich entlassen hätte?
Ich muss kurz betonen, dass das ein Gefängnis des Geheimdienstes war. Die hätten mich freigelassen und das gehörig ausgenutzt, sie hätten daraus eine riesige Causa gemacht – wir haben einen europäischen Spion freigelassen!
Und waren Sie nie zumindest versucht diesem „Werden Sie Muslim“ nachzugeben? Ist doch egal, was Sie denen sagen, Sie verlassen den Sudan und bleiben Christ...
Nein, das war nie eine Versuchung für mich. Gerade weil ich diese Verfolgung als einen Teil des Lebens ansehe, habe ich mich nie gefragt – Gott, warum? Ich war in einer Zelle inmitten von Muslimen, ich habe nie gesehen wer mir die Faust ins Gesicht schlägt, wer mich verletzt. Sie haben fünfmal am Tag gebetet und ich musste mich währenddessen hinknien und in die Toilette schauen. Aber davor habe ich mich nicht gefürchtet, ich hatte eher Angst den Verstand zu verlieren. Aber ich habe die ganze Zeit über an die Kraft des Gebets geglaubt.
Einmal habe ich mich um neun Uhr abends auf den Boden gelegt und bin wohlig eingeschlafen. Danach habe ich festgestellt, dass meine Gemeinde in Kladno um acht Uhr abends eine Stunde für mich gebetet hat, wo auch immer sie alle gerade waren. Es gibt dort eine Stunde Zeitverschiebung, also in Kladno wurde um acht gebetet und ich bin genau um neun Uhr eingeschlafen. Als sie mir mit einem Stock auf den Kopf schlugen, hatte ich Christus vor Augen, wie er geschlagen wurde. Den Schmerz habe ich nicht gespürt. Auch da habe ich anschließend erfahren, dass sie zu Hause für mich gebetet hatten...
Wie haben Sie eigentlich erfahren, dass Sie freigelassen wurden?
Ich war gerade draußen, im letzten Gefängnis konnten wir auf einen Hof nach draußen gehen und habe den 126. Psalm gelesen: „Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden... Der HERR hat Großes an ihnen getan.“ Ich hatte das gerade zu Ende gelesen als ein paar Sekunden später der Aufseher kam und mir mitteilte, dass ich frei sei. Er hat das auf Arabisch gesagt und um mich herum brachen alle in Jubel aus.
Werden Sie sich nach dieser Erfahrung jemals wieder in ein so unsicheres, gefährliches Gebiet wagen?
Wir haben auf der ganzen Welt ein großes Netzwerk von Mitarbeitern, die dasselbe tun wie ich. Abgesehen davon, bekäme ich in einigen Ländern nicht mal ein Visum. Und wenn ich eins bekäme, könnte das eine Falle sein. Ich muss auf jeden Fall sehr umsichtig sein. Ich will nichts riskieren. Jetzt, als Gesandter der ICA reise ich mehr in die Länder, die die Verfolgten unterstützen. Ich treffe mich immer noch mit verfolgten Christen, aber eher in Nachbarländern. Wichtig ist, dass sie wegen mir nicht in Gefahr geraten. Aber es stimmt, dass ich letztes Jahr wahrscheinlich am meisten gereist bin – die Gefangenschaft und dann das Buch, das in vielen Ländern herausgekommen ist, das sind Anlässe zu vielen Treffen und Konferenzen. Damit bin ich wirklich ausgelastet. Schauen wir, was der Herr weiter für mich vorsieht, ich werde mich sicher nicht dagegen wehren.
Jana Plíšková
Wie die Christlichen Begegnungstage in Graz nachholen? Ostrau 2022!
 Aufgrund der Pandemie mussten die österreichischen Organisatoren die für den 3. bis 5. Juli 2020 in Graz geplanten Christlichen Begegnungstage in Mitteleuropa mit großem Bedauern absagen. Nach dieser schwierigen Entscheidung stellte sich die Frage, wie die 30 Jahre lange Tradition und die Kontinuität dieses Ereignisses aufrechterhalten werden kann, damit es nicht acht lange Jahre unterbrochen wird. Die nächsten Christlichen Begegnungstage, zu denen die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz eingeladen hat, sind nämlich erst für das Jahr 2024 geplant.
Aufgrund der Pandemie mussten die österreichischen Organisatoren die für den 3. bis 5. Juli 2020 in Graz geplanten Christlichen Begegnungstage in Mitteleuropa mit großem Bedauern absagen. Nach dieser schwierigen Entscheidung stellte sich die Frage, wie die 30 Jahre lange Tradition und die Kontinuität dieses Ereignisses aufrechterhalten werden kann, damit es nicht acht lange Jahre unterbrochen wird. Die nächsten Christlichen Begegnungstage, zu denen die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz eingeladen hat, sind nämlich erst für das Jahr 2024 geplant.
Mehrere Vertreter der teilnehmenden Kirchen fragten bei der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder an, ob es nicht möglich wäre, in der Zwischenzeit ein kleineres Treffen in der Tschechischen Republik in einem begrenzten Format zu veranstalten, um den Zeitraum von den Begegnungstagen in Budapest im Jahr 2016 bis zum Treffen in Frankfurt an der Oder im Jahr 2024 zu überbrücken.
Der Synodalrat der EKBB wog seine Möglichkeiten ab und beschloss, diesem Wunsch nachzukommen. Gegenwärtig planen wir also, im September 2022 Christliche Begegnungstage im mährisch-schlesischen Ostrau (Ostrava) abzuhalten. Da in unserer Kirche jedes Jahr im September ein Jugendtreffen stattfindet, möchten wir diese beiden großen Veranstaltungen verbinden und insbesondere junge Menschen aus Mitteleuropa zur Teilnahme einladen. Anfang Oktober traf sich bereits zum ersten Mal das internationale Vorbereitungskomitee, um über den Rahmen des Programms, die Veranstaltungsorte sowie die Gesamtfinanzierung zu beraten. Das Vorbereitungskomitee beschloss außerdem, das Motto und das Logo des Treffens von Graz zu übernehmen und einige bereits vorbereitete Programmpunkte auch in Ostrava zu veranstalten.
Wir hoffen, dass die Umstände uns wohlgesinnt sein werden, das Coronavirus der Vergangenheit angehören wird und die Begegnungstage uns die Gelegenheit bringen werden, dankbar zusammen zu sein und Gott zu feiern.
Daniela Hamrová
Ich gehe erhobenen Hauptes
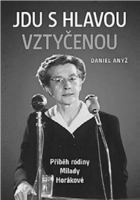 Denkt man an die Herrschaft der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, waren die 1950er Jahre eindeutig die schlimmsten, härtesten. Im Volk herrschten Schweigen und Angst, manchmal Desinteresse und Gleichgültigkeit, in Teilen sicherlich auch Zustimmung für dieses Regime, das der Nation mit Gewalt aufgezwungen worden war; und von oben Terror, Verhaftungen, Gefängnis und auch Hinrichtungen. Sicher gab und gibt es viele Länder auf der Welt mit einem viel härteren Regime, aber in Mitteleuropa?! Aber ja, die Sowjetunion war schließlich nicht weit …
Denkt man an die Herrschaft der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, waren die 1950er Jahre eindeutig die schlimmsten, härtesten. Im Volk herrschten Schweigen und Angst, manchmal Desinteresse und Gleichgültigkeit, in Teilen sicherlich auch Zustimmung für dieses Regime, das der Nation mit Gewalt aufgezwungen worden war; und von oben Terror, Verhaftungen, Gefängnis und auch Hinrichtungen. Sicher gab und gibt es viele Länder auf der Welt mit einem viel härteren Regime, aber in Mitteleuropa?! Aber ja, die Sowjetunion war schließlich nicht weit …
In unserem Land wurden über 260 Hinrichtungen vollstreckt, doch unter diesen Hingerichteten war nur eine einzige Frau: die Juristin Milada Horáková, deren Tod sich in diesem Jahr genau zum 70. Mal jährt. Sie wurde am 27. Juni 1950 hingerichtet. Während der kommunistischen politischen Prozesse wurde sie Opfer eines Justizmordes, wurde wegen „Verschwörung und Hochverrats“ verurteilt zur Zeit der größten Tyrannei von Präsident Klement Gottwald.
Milada Horáková war auch schon während des Krieges inhaftiert. Zusammen mit ihrem Ehemann Bohuslav wurde sie von der Gestapo wegen Widerstandsaktivitäten im „Petitionsausschuss Wir bleiben treu“ (Petiční výbor Věrni zůstaneme) schon im August 1940 festgenommen und beide wurden erst im April 1945 freigelassen. Milada konnte daher die Verhörmethoden und die allgemeine Behandlung von Verurteilten unter beiden Regimen vergleichen – das kommunistische war letztendlich „gründlicher“.
Milada Horáková kämpfte als Abgeordnete für die Tschechoslowakische Volkssozialistische Partei. Wie die Erinnerungen ihres Ehemannes Bohuslav Horák zeigen, hatten allerdings die demokratischen Kräfte nach dem Krieg gar keine Chance gegen die tschechoslowakischen Kommunisten, welche von den sowjetischen Genossen aus Moskau beschützt und gleichzeitig in der Hand gehalten wurden.
Der Prozess gegen Milada war eine völlig künstliche Konstruktion, die von der Führung der Kommunistischen Partei unter direkter Beteiligung sowjetischer Berater und unter persönlicher Aufsicht Klement Gottwalds entworfen und inszeniert wurde. Die Parteiführung brauchte einen fiktiven Feind, auf den sie verweisen und den sie exemplarisch hart bestrafen konnte, damit niemand auch nur zu versuchen wagte, wirklichen Widerstand zu leisten.
Die Wahlen im Mai 1946 gewannen die Kommunisten. Viele glaubten wirklich an die Idee des Kommunismus, und formal waren es vielleicht „freie“ Wahlen. Nur stimmte man damit für den allgegenwärtigen gesellschaftlichen Druck der Kommunisten, die unter anderem medial oder bessergesagt durch ihre Propaganda bereits den öffentlichen Raum beherrschten. Sie folgten zu diesem Zeitpunkt schon absolut rücksichtslos dem Motto „wer nicht für uns ist, ist gegen uns“. Als Oppositionsabgeordnete wurde Milada Horáková von der Geheimpolizei beobachtet, und wenn sie in ihren Wahlkreis in Südböhmen fuhr, wurden ihre Äußerungen überwacht. Was dann im Februar 1948 geschah, kann man, trotz aller politischen Scharaden im Hintergrund, nur als gewaltsame Machtübernahme bezeichnen. Bewaffneter Putsch. Ende.
Milada wurde „erst“ im September 1949 verhaftet; Bohuslav gelang die Flucht aus der Tschechoslowakei. Den Prozess, den die Kommunisten als „Prozess gegen die Führung einer hinterhältigen Verschwörung gegen die Republik – Horáková & Co.“ bezeichneten, konnte er im Juni 1950 nur aus fragmentarischen Informationen, die ihn im Flüchtlingslager Valka in Nürnberg-Langwasser erreichten, verfolgen.
Heuer, zum siebzigsten Jahrestag von Miladas Tod, tauchten in Prag Transparente mit ihrem Porträt und der Aufschrift „Von den Kommunisten ermordet“ auf. Eines davon hängt auch an der Kirche der EKBB in Prag-Smíchov. Milada war Mitglied der dortigen evangelischen Gemeinde gewesen.
In den Briefen, die Milada kurz vor ihrer Hinrichtung aus dem Gefängnis in Prag-Pankrác an ihre Angehörigen schrieb, heißt es: „Weint nicht zu sehr um mich. Ich weine ja auch nicht. Mit Blick auf die Ewigkeit ist das menschliche Leben eigentlich nur ein so kleines Ereignis … In den schwersten Augenblicken, in den Kasematten von Theresienstadt, in der Hauptzelle Nr. 8, habe ich erkannt, was Gott ist, und ich habe gespürt, dass Er mich angenommen hat. Und deshalb stützt auch Ihr Euch auf den Glauben an Ihn … Bedauert mich nicht! Ich ertrage meine Strafe ergeben und unterwerfe mich ihr demütig – vor dem Urteil meines Gewissens habe ich bestanden – und ich hoffe und glaube und bete, dass ich auch vor dem höchsten Gericht bestehen werde, vor Gott.“
Daher stammt auch der Satz „Ich gehe erhobenen Hauptes“. Dieser Satz von Milada gab einem Buch seinen Titel, das der Journalist Daniel Anýž geschrieben hat, der auf die Politik der USA und die transatlantischen Beziehungen spezialisiert ist. Die Zitate aus den Briefen stammen aus diesem Buch. Daniel Anýž schrieb das Buch dank der großen Hilfe von Milada Horákovás Tochter Jana Kánská, die in den USA lebt. Sie ist jetzt 87 Jahre alt und voller Leben. Ihren Lebensmut und ihre Liebe zur Wahrheit hat sie wohl geerbt.
Jana Plíšková, Daniel Anýž
Ein Kreuz als Symbol der Versöhnung nach vierhundert Jahren
 Die mittelalterliche militärische Auseinandersetzung auf dem Weißen Berg bei Prag im Jahr 1620 spaltete die tschechische Nation und stürzte sie für die folgenden hundertfünfzig Jahre in Finsternis. Der Jahrestag dieser Schlacht bietet die Gelegenheit zu einem gemeinsamen symbolischen Akt der Versöhnung. Auch wenn die Kirchen schon lange einen gemeinsamen ökumenischen Weg beschreiten, wurde im November 2020 auf dem Weißen Berg ein Versöhnungskreuz als beständiges Zeichen der Vergebung und des gegenseitigen Verständnisses aufgestellt.
Die mittelalterliche militärische Auseinandersetzung auf dem Weißen Berg bei Prag im Jahr 1620 spaltete die tschechische Nation und stürzte sie für die folgenden hundertfünfzig Jahre in Finsternis. Der Jahrestag dieser Schlacht bietet die Gelegenheit zu einem gemeinsamen symbolischen Akt der Versöhnung. Auch wenn die Kirchen schon lange einen gemeinsamen ökumenischen Weg beschreiten, wurde im November 2020 auf dem Weißen Berg ein Versöhnungskreuz als beständiges Zeichen der Vergebung und des gegenseitigen Verständnisses aufgestellt.
In der Schlacht am Weißen Berg wurde der Aufstand der Böhmischen Stände, die unter anderem die religiöse Gleichberechtigung zwischen Katholiken und Protestanten forderten, endgültig niedergeschlagen. Es folgte stattdessen eine Zeit der Vorherrschaft und Unterdrückung, für die sich der Begriff „Zeit der Finsternis“ eingebürgert hat. Während der gewaltsamen Rekatholisierung gingen bis zu eine halbe Million Menschen ins Exil, einschließlich weltweit bedeutender Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Johann Amos Comenius.
Nach vier Jahrhunderten bietet die Erinnerung daran die Möglichkeit vergangene Traumata, historisches Unrecht und die beidseitige Trennung über viele Generationen hinweg zu verarbeiten. Grundlage dafür ist all das, was uns als Angehörige verschiedener Kirchen eint und nicht das, was uns trennt.
Ein beständiges Zeichen dieser Bemühung soll gerade auf dem Weißen Berg auf der Allee der Exilanten das Kreuz der Versöhnung sein. Das Versöhnungskreuz ist Teil der tschechischen geistigen und kulturellen Tradition und wird an Orten aufgestellt, an denen sich etwas Unheilvolles zugetragen hat. Es dient als Symbol vergangenen Unrechts und des erneuerten Verständnisses und der Vergebung.
Die moderne Form dieses Kreuzes, dessen Autor der deutsche Benediktinerpater Abraham Fischer ist, weist auf die tiefere geistige Bedeutung der Versöhnung hin, die nicht durch menschliche Kraft entsteht, sondern ein Werk Gottes ist.
Das Gesamtkreuz besteht aus drei Einzelkreuzen: zweien aus Stahl und einem aus Titan. Die zwei rostigen Stahlbalken stehen für zwei unversöhnliche Konfliktparteien, der Rost steht für unsere Sünden und unsere konfliktbelastete Welt. Der dritte Teil, das blaue Titankreuz, das nicht den Einflüssen der Umwelt unterliegt, steht für den Himmel und dafür, dass wir wahren Frieden vor allem dann erreichen, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass uns das eint, was außerhalb dieser Welt liegt.
Das Versöhnungskreuz ähnelt auf dem Boden liegend einer Stahlspinne, die den Weg versperrt. Erst wenn sie mit vereinten Kräften aufgestellt und ausgerichtet wird, wird sie zu einem Kreuz – und zwar zu einem solchen Kreuz, das von allen Seiten und aus allen Blickwinkeln gleich gut sichtbar ist. Das Kreuz ist ein Zeichen der Versöhnung, auf die beide Kirchen setzen und die heute, trotz der Last der Vergangenheit, größtenteils zur Realität geworden ist.
Der Hauptteil des gemeinsamen Andenkens, das der Ökumenische Rat der Tschechischen Republik gemeinsam mit der Tschechischen Bischofskonferenz organisiert hat, sollte eine ökumenische Vesper auf dem Weißen Berg direkt am Jahrestag, am Sonntag, den 8. November, sein. Damit verbunden sollten Jugendliche aus allen Ecken Tschechiens eben zu diesem Ort pilgern.
Einer Veranstaltung in dieser Form standen jedoch die aktuellen Maßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie entgegen. Das Programm musste daher deutlich eingeschränkt werden und der gemeinsame Gottesdienst, an dem hunderte Gläubige teilnehmen sollten, fand in Form einer Fernsehübertragung ohne die Teilnahme einer breiten Öffentlichkeit statt. Die Vesper beinhaltete auch ein Bußgebet, im Rahmen dessen die Vertreter der Kirchen vergangenes Leid anerkannten und Gott nicht nur um Vergebung, sondern auch um Hoffnung für den gemeinsamen zukünftigen Weg baten.
Bestandteil des Gedenkens ist auch eine langfristige Kooperation der Tschechischen Bischofskonferenz und des Ökumenischen Rats, die gemeinsam eine Fachkommission zur Untersuchung der Konfessionsgeschichte des 17. Jahrhunderts und zusammenhängender Themen ins Leben gerufen haben. Die Kommission veröffentlicht regelmäßig Arbeitspapiere für Gemeinden, Pfarreien, Schulen und die Öffentlichkeit und veranstaltet Fachkolloquien. „Wir bemühen uns darum, Vorurteile abzubauen, die zwischen uns bestehen und uns wahrheitsgemäß den Ereignissen anzunähern, die uns zur Wahrheit führen, da sie von Christus gelenkt werden. Es geht darum, dass wir uns auch durch die Arbeitsergebnisse der Kommission als Christen näher kommen“, so der Vorsitzede des Ökumenischen Rats der Kirchen und Synodalsenior der EKBB Daniel Ženatý.
Mit Unterstützung des Ökumenischen Rats der Kirchen Jiří Hofman
Zum 350. Todestag von Johann Amos Comenius
 Johann Amos Comenius (tschechisch Jan Amos Komenský) stammte aus dem Südosten Mährens, aus einer Familie, die den Böhmischen Brüdern angehörte. Er wurde am 28. März 1592 geboren. Sein Geburtsort ist jedoch umstritten: mal wird Nivnice (Nivnitz), mal Uherský Brod (Ungarisch Brod) genannt. Johann war nach vier Töchtern der einzige Sohn des Ehepaars Comenius. Seine Kindheit verbrachte er wahrscheinlich an beiden erwähnten Orten im Südosten Mährens, und ab 1598 besuchte er die Brüderschule in Uherský Brod.
Johann Amos Comenius (tschechisch Jan Amos Komenský) stammte aus dem Südosten Mährens, aus einer Familie, die den Böhmischen Brüdern angehörte. Er wurde am 28. März 1592 geboren. Sein Geburtsort ist jedoch umstritten: mal wird Nivnice (Nivnitz), mal Uherský Brod (Ungarisch Brod) genannt. Johann war nach vier Töchtern der einzige Sohn des Ehepaars Comenius. Seine Kindheit verbrachte er wahrscheinlich an beiden erwähnten Orten im Südosten Mährens, und ab 1598 besuchte er die Brüderschule in Uherský Brod.
Nicht nur sein Talent bestimmte das Schicksal von Johann Amos, sondern auch die Tatsache, dass sich die Brüder-Unität gebildeten priesterlichen Nachwuchs sichern musste. Deshalb wurde er ins Ausland geschickt, um drei Jahre lang, von 1611 bis 1614, an kalvinistisch orientierten Universitäten in Deutschland zu studieren, unter anderem an der Universität Heidelberg. Nachdem er 1614 nach Mähren zurückgekehrt war, unterrichtete Comenius an der Schule in Přerov (Prerau) und wurde 1616 zum Pfarrer der Brüdergemeine ordiniert.
Wie die Mehrheit der Böhmischen Brüder unterstützte Comenius den Ständeaufstand in Böhmen gegen die katholischen Habsburger. Die Niederlage der böhmischen und mährischen evangelischen Stände in der Schlacht am Weißen Berg am 8. November 1620 besiegelte somit auch sein Schicksal. Um die Jahreswende 1621/22 musste er aus Angst um seine Freiheit und sein Leben seine damaligen Wirkungsstätte verlassen und sich an verschiedenen Orten in Nordmähren verstecken. Die neue Verfassung Verneuerte Landesordnung legalisierte 1627 die Erbmacht der Habsburger in den Böhmischen Ländern und erklärte den Katholizismus zur einzig zugelassenen Religion. Nichtkatholische Stände wurden angewiesen, innerhalb von sechs Monaten entweder das Land zu verlassen oder zum Katholizismus überzutreten. Die Folge war eine große Auswanderungswelle, mit der auch die Familie Comenius ins Exil ging.
Im großpolnischen Leszno (Polnisch-Lissa) fand Comenius Zuflucht, und es sollte ihm ein zweites Zuhause werden: In drei Etappen verbrachte er hier insgesamt 19 Jahre seines Lebens. Dank seiner auf Latein verfassten Werke, insbesondere modernen Lehrbücher und pansophischen Schriften, erlangte er Bekanntheit in ganz Europa.
Mit 50 Jahren stand Comenius an der Spitze seiner Schaffenskraft, und es gab beträchtliches Interesse an seiner Arbeit in Europa. Er erhielt sogar von Kardinal Richelieu persönlich eine Einladung nach Paris. In erster Linie verfasste Comenius Lehrbücher, aber sein wirkliches Interesse richtete sich zunehmend auf sein Hauptwerk, die universalreformatorische Schrift De rerum humanarum emendatione consultatio catholica („Allgemeine Beratung über die Verbesserung der menschlichen Angelegenheiten“).
Eine Katastrophe war für Johann Amos die unselige Nachricht vom Abschluss des Westfälischen Friedens im Oktober 1648, mit dem Böhmen, entgegen schwedischer Versprechungen, unter der Kontrolle der Habsburger verblieb. Aber auch jetzt konnte seine Vitalität nicht durch Misserfolge gebrochen werden. Seine Kontakte ins Ausland (insbesondere mit England) bestanden weiterhin, und er versuchte, von dort Hilfe für die tschechischen Exulanten zu bekommen. Trotz der endgültigen Bestätigung des Westfälischen Friedens im Januar 1650 beschloss die Synodalversammlung der Böhmischen Brüder, die Unität nicht aufzulösen, sondern sie für die Zukunft aufrechtzuerhalten.
In dieser neuen Situation begrüßte Johann Amos Comenius die Einladung der siebenbürgischen protestantischen Fürstenfamilie Rákóczi, eine Reform ihrer Lateinschule in Sárospatak vorzunehmen. Er hatte dadurch die Gelegenheit, die Kontakte zu den Exilgemeinden der Böhmischen Brüder in Ungarn wieder aufzunehmen und zu versuchen, neue politische Unterstützung für die tschechischen Exulanten zu gewinnen. Er verbesserte die örtliche Schule und schrieb hier viele ausgezeichnete, insbesondere didaktische Werke [Schola ludus (Die Schule als Spiel), Orbis pictus (Die Welt in Bildern)]. Intrigen des Rektors der Schule verschlechterten jedoch Comenius’ Position in Sárospatak zunehmend, und so beschloss er im Juni 1654, nach Leszno zurückzukehren.
Zu dieser Zeit lebte noch einmal kurz und zum letzten Mal die Hoffnungen der tschechischen Exulanten auf, dass sich die Verhältnisse in Mitteleuropa umkehren könnten. Eine Koalition aus Schweden, Cromwells England und Siebenbürgen zeichnete sich ab. Als 1655 der schwedisch-polnische Krieg ausbrach, feierte der kriegerische Schwedenkönig Karl X. Gustav zunächst große Triumphe. Bald jedoch begann sich das Blatt zu wenden, polnisch-katholische Einheiten griffen Leszno (das für ein Nest von Ausländern und protestantischen Verrätern gehalten wurde) an und brannten es nieder. Johann Amos konnte mit seiner Familie in letzter Minute fliehen, doch bei dem Brand verlor er seinen gesamten Besitz, einschließlich der Bibliothek und vieler wertvoller, unvollendeter Manuskripte.
Comenius hatte vorübergehend Zuflucht in Frankfurt an der Oder gefunden, als ihn im Juni 1656 eine Einladung nach Amsterdam erreichte; diesmal zog er endgültig in die Niederlande.
Die vierzehn Jahre in Amsterdam waren für ihn eine Zeit des kreativen Aufschwungs (hier vollendete und veröffentlichte er seine zahlreichen literarischen und wissenschaftlichen Werke). Seine Ideen und Bemühungen entfernten sich jedoch bereits von der Realität des damaligen Europa, das von Macht und wirtschaftlichen Interessen beherrscht wurde. Trotzdem hörte er auch in den letzten Jahren seines Lebens nicht auf, seine Pflichten als Bischof der Brüdergemeine zu erfüllen, und pflegte den Kontakt zu seinem Heimatland und den tschechischen Exulanten (unter anderem auch durch die Veröffentlichung seiner tschechischen Bücher).
Er starb am 15. November 1670 in Amsterdam inmitten einer unvollendeten Arbeit im Alter von 78 Jahren und wurde eine Woche später, am 22. November, in der Stadt Naarden, 20 km südöstlich von Amsterdam, beigesetzt. Die letzte Station auf Comenius’ langer Reise war das Grab in der Kirche der wallonisch-reformierten Kirche, zu welcher der Verstorbene eine sehr enge persönliche Beziehung gehabt hatte.
Jaroslav Kumpera (redaktionell gekürzt)
Wodurch ist die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder für ihre ausländischen Partnerkirchen inspirierend und interessant?
Eine deutsche Theologin antwortet mit einer Liebeserklärung an die „Böhmische Brüderkirche“:
 I.
I.
Im Jahre 1957 war die Evangelische Kirche in Westdeutschland schon wieder reich und angesehen. Ich war damals blühende siebzehn Jahre alt. Ich hatte die besondere Chance, im Juni 1957 zum ersten Mal die Böhmische Brüderkirche zu besuchen. Ich war Mitglied einer Delegation der Rheinischen Landeskirche zur Prager Comenius-Fakultät. Eingeladen waren eigentlich meine Mutter und weitere sieben Kirchenmänner. Aber mich hatte Mutti mitgenommen.
Ich kam aus einem Pfarrhaus im Rheinland. Mein Großvater, ein bekannter Evangelist, meine Mutter, eine der ersten Frauen im Amt der Pastorin, alles hochangesehene und sicher bezahlte Glieder der offiziellen Evangelischen Kirche. Sie lehrten mich, Gottes Führung zu vertrauen, für meine kleinen Sünden um Vergebung zu bitten, auf ein Wiedersehen mit meinem in russischer Kriegsgefangenschaft gestorbenen Vater im Himmel zu hoffen.
Und plötzlich stand ich, eine unbedarfte Schülerin, in Chodov u Karlových Varů (Schodau bei Karlsbad) unter Menschen, die ein seltsames Deutsch sprachen. Tschechische Landwirte, die in Oppeln in Oberschlesien seit 200 Jahren gelebt hatten und nach Kriegsende 1945 dort vertrieben worden waren: Re-Emigranten.
Jetzt hatten einige Tränen in den Augen. Sie drängten sich um uns. Eine Frau rieb ganz verstohlen den Stoff meines Kleides zwischen ihren Fingern. Sie brachten mir eine Rose aus Porzellan. Die kleine Kirche dort im ehemaligen "Egerland" war voll. Der tschechische Ortspfarrer Ctirad Novák saß neben mir in der Bank, er brauchte heute nicht zu predigen; denn von der Kanzel erklangen nach zwölf Jahren zum ersten Mal wieder Gottesworte in deutscher Sprache von unserer Delegation.
Damals, im Juni 1957, erhielt mein Leben eine entscheidende Wende. Ich erfuhr, dass Menschen um Christi willen litten. Es brachte kein Ansehen, kein Geld, keine Ehre, Mitglied einer Kirche zu sein. Es brachte vielmehr Tränen. Wir reisten bis nach Bratislava - und überall war es ähnlich: Bescheiden gekleidete Männer und Frauen erzählten von ihren Nöten als Pfarrer und Pfarrfrauen. Wo im Vorjahr 40 Jugendliche konfirmiert worden waren, kamen dieses Jahr nur noch drei. Wo sich früher zwei Küster um die Kirche gekümmert hatten, musste im Winter in der Nacht zum Sonntag der Pfarrer zweimal aufstehen, um im Ofen des Kirchenraumes Kohle nachzulegen. Zum Evangelischen Kirchentag nach Deutschland reisen? Ausreise verboten! Das Kind auf die Oberschule schicken? Ausgeschlossen! Pfarrer Novák in Chodov berichtete unlängst: Bedrohliche Herren von der Staatssicherheit besuchten immer wieder das Pfarrhaus, auch nach unserem Besuch 1957. Alles wollten sie wissen über diese Delegation aus dem Rheinland: Wer steckte dahinter?
Ich fragte mich, wie Gott so ungerecht sein konnte: Wir hier im Westen hatten als Christen alles. Alles. Und dort wollte die Mangelwirtschaft, ja, die Verfolgung kein Ende nehmen, fünfzig Jahre lang. Dort mussten Menschen um Christi willen leiden...weil Moskau es so wollte.
Diese Bereitschaft zum Opfer für Gott, die noch Bonhoeffer beseelte, fehlt uns heute in den deutschen Kirchen.
Euren Hus haben die Mächtigen getötet, Euren Comenius verjagt (andere Mächtige waren es allerdings, nicht die Herren Kirchensekretäre des Sozialismus). Aber Ihr böhmischen und mährischen Christen seid treu geblieben, bis heute. Darin können wir Eure Inspiration und Euer Vorbild brauchen.
II.
Denn die Zeiten sind dabei, sich zu ändern. Das Ansehen der Kirchen in Deutschland schrumpft rapide. Der Reichtum ist gefährdet. Wo sich am Heiligen Abend die Gemeindeglieder in die Bänke pressen, sitzen ab 2. Januar wieder erschreckend wenige. Und für diese wenigen kann die Böhmische Brüderkirche neu inspirierend werden. Denn sie weiß ja, wie der Geist Gottes in kleinen Gruppen, ja in versteckten Zirkeln lebendig bleiben kann.
Die Deutschen gehen langsam den Weg von der Volks- und Staatskirche in eine Bekenntniskirche. Dieser Weg lässt fast niemanden leiden. Doch seufzt hier und da eine Pfarrerin vor Enttäuschung, wenn ihre sorgfältig ausgearbeiteten Einladungen zu Gemeindeseminaren ins Leere laufen.
Die Corona Restriktionen haben uns in West und Ost sehr gleich gemacht: Dürfen wir im Gottesdienst noch singen? Nein. Oder doch durch die Masken hindurch? Nein. Also, Ihr Schwestern und Brüder, wie macht Ihr das? Letzten Sonntag sangen Pfarrer und Organist all die schönen alten Choräle solo. Und bei Euch?
Was müssen wir von Euch alles lernen!
Mit wenig Geld auszukommen als Kirche. Bibelgespräche in kleinen Gruppen führen. Einander wertschätzen: a l l e in der Gemeinde. Gerne miteinander sein...soweit Corona erlaubt. Vor allem: einander helfen. Der Pfarrer begrüßt seine Leute sonntags und weiß genau, dass heute Frau Weidenpesch Geburtstag hat und gestern Frau Krämer aus dem Krankenhaus zurückgekommen ist. Möglichst viel mit den Mitgliedern der Freien Gemeinde, mit den Katholiken, mit den Mitgliedern der Synagogengemeinde zusammen studieren, was in der Heiligen Schrift steht und wie es eigentlich gemeint sein könnte. Wir wenigen Christen werden ausstrahlen in die Welt. Vielleicht werde ich dann auch wieder die Kraft finden, meinen Talar hervorzuholen und zu predigen. Und das Beffchen, das ich umbinde, wird eine Stickerei sein aus Javornik, ein Geschenk an meine Mutter im Jahre 1957.
(Die Autorin ist immer eine treue Freundin der Böhmischen Brüderkirche geblieben. Sie lernte Tschechisch beim Studium an der Comenius-Fakultät 1961, promovierte in Münster über J. L. Hromádka und übersetzte Bücher zum weltanschaulichen Dialog aus dem Tschechischen. Sie lehrte Sozialethik für zukünftige Sozialarbeiter an der Staatlichen Fachhochschule Münster. Sie lebt in Köln.)
Dorothea Kuhrau-Neumärker
DIE DIAKONIE DER EKBB
 Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Tel: (+ 420) 242 487 811 (812); Fax: (+420) 242 487 834
E-mail: info@diakonie.cz
Internet: www.diakonie.cz
Die Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) ist eine gemeinnützige christliche Organisation, die Hilfe und Unterstützung anbietet für ein würdiges und vollwertiges Leben, auch wenn es durch Alter, Krankheit, gesundheitliche Behinderungen, Isolation, schwierige soziale Situationen und andere Lebenskrisen beeinträchtigt ist. Die Dienste der Diakonie der EKBB erfolgen auf der Grundlage der Botschaft des Evangeliums von der Liebe Gottes und nach dem Vorbild des Dienstes Jesu Christi. In ihren Zentren und Spezial-Schulen bietet die Diakonie soziale, gesundheitliche, Bildungs- und Seelsorgedienste an. Unter den nicht-staatlichen Organisationen, die soziale Dienste anbieten, ist die Diakonie der EKBB die zweitgrösste Institution.
Für mich ist die Gemeinschaft wichtig
 Ein Gespräch mit dem Direktor der Diakonie der EKBB über spirituelle Pflege, Aufgaben der Diakonie und über eine Ideologie
Ein Gespräch mit dem Direktor der Diakonie der EKBB über spirituelle Pflege, Aufgaben der Diakonie und über eine Ideologie
Mit der Diakonie ist Jan Soběslavský schon seit seinem Studium verbunden, da er bei der Diakonie in der Rechtsberatung aushalf. Nach seinem Examen in Jura und Theologie bestritt er erfolgreich den Konkurs zum Direktor der Diakonie in Brünn, in dessen Position er zehn Jahre lang wirkte. Seit drei Jahren ist er Direktor der Diakonie der EKBB.
In der Diakonie arbeiten Sie bereits seit 15 Jahren. Wie hat sie sich in dieser Zeit verändert?
Sie hat sich stark verändert. Ich denke, ich selbst habe einen Teil dazu beigetragen, insbesondere im Bereich der Professionalisierung der Führung. In den neunziger Jahren funktionierte in der Diakonie alles etwas improvisiert. Es gab in den Bereichen Personal, Wirtschaft, Kommunikation und Investition der Diakonie keine festgelegten Regelungen, die es einzuhalten galt. Dank des Einsatzes vieler Menschen hat sich das mit der Zeit geändert und ich freue mich, dass wir heute ein funktionierendes Regelwerk haben. In einer Sache ist die Diakonie sich allerdings treu geblieben und das ist gut – in ihrer Fähigkeit Menschen zu helfen, sich für sie einzusetzen und interessante Dinge zu gestalten, eben das, was Sinn ergibt. Jetzt liegt es an uns, die Diakonie professionell und zugleich in gemeinnützigem Geiste zu leiten.
Welche Pläne haben Sie in den nächsten Jahren für die Diakonie?
Ich denke da derzeit viel in Richtung spirituelle Pflege. Der Mensch ist ein bio-psycho-sozio-kulturelles Wesen und deshalb muss man sich meiner Meinung nach auch seiner spirituellen Dimension widmen. Und das vor allem in Situationen, in denen der Mensch belastenden Lebensumständen ausgesetzt ist, zum Beispiel wegen seines Alters, seiner sozialen Situation oder einer Krankheit auch eines Angehörigen, etc.
Sollten in der Diakonie deshalb mehr Geistliche arbeiten?
Das Thema geht noch weiter. Die Diakonie besteht nicht aus einer Einheit gleichartig denkender Menschen, sondern aus zweitausend Angestellten, die über spirituelle Pflege eine Meinung haben und diese wird mit Sicherheit bei jedem unterschiedlich ausfallen. Das gemeinsam durchzudenken, wird auf jeden Fall sehr interessant und spannend und gleichzeitig auch ein bisschen kontrovers. Ich bin allerdings überzeugt davon, dass die Diskussion, die uns erwartet, zu einer qualitativen Verbesserung unserer Dienstleistungen führt.
Inwiefern?
Lassen Sie mich das an einem Beispiel erklären. In den sozialen Dienstleistungen ist eins der großen Themen, dass der Mensch immer irgendwohin vorankommen muss. Stellen Sie sich etwa eine Person mit einer psychischen Störung in einer Klinik vor. Die Vision der Sozialarbeiter ist, dass sich der Zustand dieses Menschen immer weiter verbessert. Das bedeutet, dass er aus der Klinik ins betreute Wohnen kommt, dann in eine Wohnassistenz und idealerweise als selbstständig lebende Person endet, die Arbeit hat und ein „normales“ Leben führt. Ich habe mich gefragt, wie viele von uns die Möglichkeit nutzen würden immer wieder umzusiedeln und weiterzugehen. Ich frage mich, inwiefern das dem Menschen wirklich eigen ist und inwiefern es nur eine von unserer Zivilisation durchwachsene Ideologie ist. In unserem Fall kann das bedeuten, dass das betreute Wohnen für eine Person mit psychischer Störung eine Grenze ist, die wir nicht überschreiten sollten. Man muss diese Person nicht immerfort dem Stress einer nötigen Entwicklung und des Weiterziehens aussetzen. Wenn wir sie dazu zwingen, gelangt sie in einen Kreis des Misserfolgs und am Ende steht wieder die Klinik, von wo sie dann wieder irgendwohin vorankommen muss. Genau das versuchen wir in der Diakonie zu vermeiden. Wir respektieren den einzelnen Klienten und denken über ihn nach. Das spiegelt sich logischerweise auch in der Art und Weise wieder, wie wir unsere Dienste anbieten.
Die Diakonie muss sich dennoch auch bodennahen Dingen widmen. Es soll zum Beispiel viel gebaut werden.
Uns erwartet die Erneuerung der Schule mit speziellem Förderbedarf für Kinder und Jugendliche in Prag, wir bereiten uns auf grundlegende Investitionen in das Zentrum in Valašské Meziříčí vor und werden zwei neue Seniorenheime in Svitavy und Nové Město na Moravě errichten. Ich nutze die Tatsache, dass jetzt das Seniorenheim in Nosislav hinter mir liegt, das haben wir vor ca. fünf Jahren gebaut. Darüber haben wir sehr lange nachgedacht, denn wir wollten, dass die Klienten, die dort wohnen, ein so gewöhnliches Leben wie nur möglich haben. Die Mehrheit der Wohndienste funktioniert nach einem Hotel-Prinzip und den Menschen wird alles serviert, alles wird für sie erledigt. Wir wollten aber eher ein gemeinschaftliches Wohnen erschaffen, in dem die Klienten sich an der Gartenarbeit oder an der Essensvorbereitung gemeinsam mit dem Personal beteiligen. Bei uns war dieses Konzept nicht gerade geläufig, aber es hat sich gezeigt, dass es notwendig ist. Und unseren Klienten gefällt es sehr. Die Wohndienste im Geiste eines gemeinschaftlichen Zusammenlebens bewähren sich und wir wollen sie auch in unseren beiden neuen Seniorenheimen einführen.
Welche weitere Aufgaben stehen vor der Diakonie?
Ein weiteres Thema, das mich beschäftigt, ist die Diakonie als eine Organisation mit Verantwortung für die Umwelt. Wir sollten darüber nachdenken, was wir als sozialer Dienstleister alles tun können, damit wir mit der Umwelt so schonend wie nur möglich umgehen. Wir alle nehmen sicher die Trockenheit im Land war, die globale Klimaerwärmung und die Situation mit der Plastikwirtschaft. Es ist offensichtlich, dass genauso wie Haushalte und Fabriken auch soziale Dienstleister die Umwelt belasten und deshalb müssen wir den laufenden Betrieb so ändern, dass diese Belastung so gering wie möglich ausfällt.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten der Diakonie eine ideale Sache oder einen idealen Dienst mitgeben, was wäre das?
Auf jeden Fall wäre das eine gut geführte Personalarbeit. Ich stelle mir das so vor, dass sich die Mitarbeiter der Diakonie nicht nur nach irgendeinem Handbuch richten, das ihnen genau vorschreibt, was sie zu tun haben, sondern dass ihnen Raum bleibt für persönliche Entwicklung, im Rahmen derer ihnen die Arbeit Spaß macht und sie ihre eigenen Träume und Ideen verwirklichen können. Und wenn es so eine Diakonie gäbe – und ich glaube in einigen Teilen ist sie schon so, und es gelänge, dass alle mehr als 2000 Angestellten das so wahrnehmen, dann hätte ich das Gefühl als Direktor ihnen das größtmögliche Geschenk gemacht zu haben.
Und was die Klienten angeht, so nehme ich diese gar nicht getrennt wahr. Für mich ist die Gemeinschaft wichtig, das ist einer der Werte der Diakonie. Wenn ich ein dreißigjähriger Junge mit einer Behinderung bin und in einer betreuten Wohnform, soweit mein Handicap es mir erlaubt, nach meinen eigenen Vorstellungen leben kann, dann bin ich ein Teil der Diakonie, dann habe ich in der Diakonie meinen Platz. Und die Angestellten sind meine Partner und teilen den Raum mit mir. So denke ich über die Diakonie.
Adam Šůra
Die Diakonie hilft den Bedürftigen in Beirut
 Die Spenden der diakonischen Fastenkollekte ermöglichten nach der tragischen und zerstörenden Explosion in Beirut im Libanon sehr schnelle Hilfe. Die Explosion nahm mehr als 220 Menschen das Leben und ließ 6 Tausend Verletzte zurück. Ungefähr 300 Tausend Menschen verloren ihr Dach über dem Kopf.
Die Spenden der diakonischen Fastenkollekte ermöglichten nach der tragischen und zerstörenden Explosion in Beirut im Libanon sehr schnelle Hilfe. Die Explosion nahm mehr als 220 Menschen das Leben und ließ 6 Tausend Verletzte zurück. Ungefähr 300 Tausend Menschen verloren ihr Dach über dem Kopf.
Am 4. August in den Nachmittagsstunden kam es in Beirut, der Hauptstadt des Libanon, zu einer Explosion eines Lagers für Ammoniumnitrat. Der Hafen, in dem sich die Explosion ereignete und der ein Dreh- und Angelpunkt der Wirtschaft und der Versorgung des Landes ist, wurde komplett zerstört. Die Silos, die dort standen, enthielten beispielsweise 85% der libanesischen Vorräte an Weizen. Auch vier Beiruter Krankenhäuser wurden außer Betrieb gesetzt, die zuvor halfen, die Covid-19 Pandemie einzudämmen.
Der Libanon kämpft dabei schon längere Zeit mit einer tiefen Wirtschaftskrise. Pandemie und Explosion haben sie jetzt noch verstärkt und eskalieren lassen.
Die Diakonie der EKBB schickte unmittelbare Hilfe in Form von 800 Tausend Kronen und rief gleichzeitig eine öffentliche Spendensammlung ins Leben. Sie widmet diese nicht nur der unmittelbaren Beseitigung der Nachwirkungen, sondern auch der langfristigen Unterstützung der Menschen in Beirut. Unterstützende diakonische Projekte finden im Libanon nämlich schon mehrere Jahre statt und richten sich vor allem an Familien aus Beirut, die in Not sind. Sie helfen ihnen, die schwierigen Folgen der Armut und der Flucht vor dem Syrienkrieg zu überwältigen.
Die lokalen Kenntnisse und das langfristige Wirken der Diakonie hier in Beirut verhalfen zu einer sehr schnellen und effektiven Aufteilung der Hilfsmittel. Etwas weniger als die Hälfte (340 Tausend Kronen) wird den ärmsten Familien in dem am meisten betroffenen Stadtviertel Karantina helfen.
Der Beseitigung der Nachwirkungen schließt sich auch das Bildungszentrum Tahaddi in Beirut an, das mit der Diakonie langfristig zusammenarbeitet. Junge Menschen helfen beim Aufräumen nach der Explosion. Auch die Absolventen, die in den Fachrichtungen Zimmermann, Dachdecker und Maler ausgebildet wurden, beteiligen sich an den Aufbauarbeiten. Weitere junge Menschen werden Essen für Familien, Arbeiter und Freiwillige zubereiten und liefern.
Die zweite Hälfte des Geldes in Höhe von 220 Tausend Kronen wird zum Einkauf von Lernhilfsmitteln für Kinder aus den ärmsten Familien benutzt. Hinsichtlich des starken Anstiegs von Covid-19 Fällen in den letzten Wochen wird erwartet, dass die Schulen auch weiterhin geschlossen bleiben und es für Kinder nur Online-Unterricht geben wird.
Die Schule kombiniert mit einer kleinen aber regelmäßigen Essens- oder Geldspende dient dabei in vielen Fällen als Hauptprävention gegen Kinderarbeit, die frühzeitige Heirat junger Mädchen und gegen andere negative Erscheinungen. Sie trägt dazu bei langfristig zu verhindern, dass Kinder in der nie endenden Armutschleife bleiben und hilft den Kindern, noch Kind bleiben zu dürfen.
Den dritten Teil in Höhe von 240 Tausend Kronen gibt die Diakonie für die Unterstützung des Unterrichts und anderer Aktivitäten für Kinder, bei Bedarf auch für psychosoziale Hilfe aus.
Die Diakonie der EKBB unterstützt im Libanon in Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen den Betrieb von Schule, Kindergarten, Ärztezentrum und vermittelt materielle und psychosoziale Hilfe an die Ärmsten, die sonst zu diesen elementaren Diensten keinen Zugang hätten. Das Gemeinschaftszentrum Tahaddi bietet sowohl materielle Hilfe als auch eine langfristige Perspektive, auch wenn es im Moment vor allem ums Überleben geht. Zwanzig Frauen gab sie eine Arbeit in einer sozialen Schneiderei und sie bietet Bildung und Freizeitaktivitäten für 450 Kinder, die sonst keine Chance hätten, überhaupt zur Schule zu gehen.
Jiří Hofman
DIE EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT DER KARLSUNIVERSITÄT IN PRAG (ETF UK)
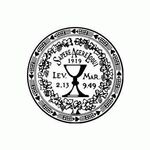 P.O. Box 529, Černá 9,
P.O. Box 529, Černá 9,
CZ 115 55 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 221 988 211; Fax: (+ 420) 221 988 215
E-Mail: intl@etf.cuni.cz
Internet: http://web.etf.cuni.cz/ETFENG-1.html
Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Karlsuniversität (ETF UK) ist die Nachfolgerin der Jan-Hus- Fakultät (1919–1950) und der Comenius-Fakultät (1950–1990). Im Jahr 1990 wurde sie in die Karlsuniversität eingegliedert. Die Verwaltung der Fakultät wird vom Dekan und dem Team der Prodekane geleitet, die auf vier Jahre in ihr Amt gewählt werden. Die Fakultät bietet Bakkalaureats- und Master-Studiengänge an – in evangelischer Theologie, Diakonie (Seelsorge und Sozialarbeit), ökumenische Studien, und verschiedene theologische Bereiche auf Doktoranden-Ebene. Die Fakultät ist ökumenisch für alle offen. Pfarrerinnen und Pfarrer der EKBB erhalten hier ihre Ausbildung.
„Ökumenisches“ Orientierungsprogramm für ausländische Erasmus-Studenten der Prager Theologischen Fakultäten
Die Evangelische und die Katholische Theologische Fakultät vereinen ihre Kräfte
 Jedes Jahr können sich die nach Prag kommenden Erasmus-Studenten an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Karlsuniversität (ETF) auf ein zweiwöchiges Orientierungsprogramm, das kurz vor Semesterbeginn stattfindet und vom International Office der ETF organisiert wird, freuen. Neben praktischen und verwaltungstechnischen Informationen über den Aufenthalt in Prag (Immatrikulation, Einschreibung in Kurse, ÖPNV, Gesundheit, Versicherung, etc.) beinhaltet das Programm einen Intensivkurs Tschechisch (jeden Morgen vier Stunden) und die Besichtigung wichtiger kultureller und historischer Sehenswürdigkeiten in Prag.
Jedes Jahr können sich die nach Prag kommenden Erasmus-Studenten an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Karlsuniversität (ETF) auf ein zweiwöchiges Orientierungsprogramm, das kurz vor Semesterbeginn stattfindet und vom International Office der ETF organisiert wird, freuen. Neben praktischen und verwaltungstechnischen Informationen über den Aufenthalt in Prag (Immatrikulation, Einschreibung in Kurse, ÖPNV, Gesundheit, Versicherung, etc.) beinhaltet das Programm einen Intensivkurs Tschechisch (jeden Morgen vier Stunden) und die Besichtigung wichtiger kultureller und historischer Sehenswürdigkeiten in Prag.
In diesem Jahr meldeten sich aufgrund der Coronapandemie so wenige Erasmus-Studenten für Theologie oder Soziale Arbeit an der ETF an, dass das International Office das Orientierungsprogramm zu kürzen oder ganz abzusagen gedachte. Schließlich kam jedoch die Idee auf das Orientierungsprogramm gemeinsam mit der Katholisch-Theologischen Fakultät (KTF) abzuhalten. Die Kollegen an der KTF nahmen den Vorschlag mit Begeisterung an, denn auch bei ihnen schrieben sich wesentlich weniger Studenten als gewöhnlich ein und so wurde die Idee weiter verfolgt. Als die Anzahl der Coronafälle in Tschechien noch relativ gering war und die Regierungsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie noch nicht so restriktiv, hatten Studenten der ETF und der KTF die Möglichkeit sich gemeinsam auf ihr Studium vorzubereiten, Tschechisch-Grundkenntnisse zu erwerben, das Jüdische Viertel, das Agneskloster und weitere Orte zu besichtigen und einen Tagesausflug im Elbtal zu unternehmen.
Das gemeinsame Projekt war sehr erfolgreich, Studenten freundeten sich über die Fakultäten hinweg an und auch die Mitarbeiter der ETF und der KTF lernten sich besser kennen. Tatsächlich entschlossen sich ETF-Studenten dazu Kurse an der KTF zu belegen und umgekehrt. Bei einem so durchschlagenden Erfolg ist es nicht unwahrscheinlich, dass das Experiment auch im nächsten Jahr wiederholt wird.
Trotz all der Probleme und Unannehmlichkeiten, die aufgrund der Pandemie entstehen, gibt es zumindest eine erfreuliche Auswirkung: die Stärkung der ökumenischen Zusammenarbeit in Prag!
Peter Stephens

