Bulletin 49 – Ostern 2020
Der Leitarikel
Unsere lieben Leser,
unser vorösterliches ökumenisches Bulletin ist für Sie vorbereitet. Ostern – das ist eine konstante Sicherheit, Ostern wird es geben ohne Rücksicht darauf, dass sich über die Welt unverfroren ein freches Virus verbreitet; die Herrschaft Jesu kann es damit nicht bedrohen.
Soweit es um die Texte in dieser Ausgabe geht, würde ich Sie gerne auf das Gespräch mit dem Pfarrer unserer Kirche Tomáš Jun hinweisen. Tomáš Jun hat sich zu einem ziemlich mutigen Schritt entschlossen, er hat sich nämlich der stark vor sich hinsterbenden Gemeinde in Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe) angenommen und die Veränderungen, die sich in der kurzen Zeit seines Wirkens ereigneten, ließen sich beinahe als Wunder bezeichnen. Für Tomáš war es nämlich eine wahrhaftige Herausforderung – wie kann eine Gemeinde in einer Kreisstadt mit 95 000 Einwohnern ganz aussterben? Das ist doch nicht möglich! Sehen Sie also, was dem 34-jährigen Pfarrer schon gelungen ist und was er vorhat weiter zu tun. So sei die Arbeit von Tomáš Ermutigung für unser Wirken, denn er gibt uns die Gewissheit, dass auch scheinbar hoffnungslose Dinge einen Sinn haben, sie können einen gewaltigen Nutzen und Freude bringen.
Und das Zweite, was ich erwähnen möchte und es scheint auch fast unmöglich zu sein, ist das Wirken eines Vereins mit dem Namen „Eine Million Augenblicke….“ Zwei jungen Leuten, Gründern dieses bürgerlichen Widerstands, ist es gelungen, einen Widerspruch des tschechisches Volkes gegen die Regierung in Gang zu bringen, der eigentlich irgendwie nicht mehr in die heutige Zeit zu gehören scheint. Die Teilnahme an Demonstrationen, die von „Eine Million Augenblicke---“ organisiert werden, ist eindeutig am größten seit der Samtenen Revolution im November des Jahres 1989, sie nähert sich zahlenmäßig fast dem November 1989!
 Liebe Freunde, das Virus wird die Welt nicht aus den Angeln heben. Ach dass uns Ostern Frieden und Hoffnung bringe, die die Sorgen unserer Welt weit übersteigen – in allen Richtungen!
Liebe Freunde, das Virus wird die Welt nicht aus den Angeln heben. Ach dass uns Ostern Frieden und Hoffnung bringe, die die Sorgen unserer Welt weit übersteigen – in allen Richtungen!
Für den Redaktionsrat
Jana Plíšková
DIE EVANGELISCHE KIRCHE DER BÖHMISCHEN BRÜDER
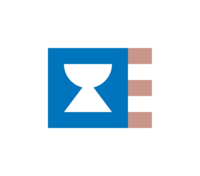 P.O. Box 466, Jungmannova 9,
P.O. Box 466, Jungmannova 9,
CZ 111 21 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 224 999 215(216); Fax: (+ 420) 224 999 219
E-Mail: ekumena@e-cirkev.cz
Internet: www.e-cirkev.cz
Die Grundlagen der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) wurzeln in der Utraquistischen Kirche (1431–1620) und in der Brüderunität ((1457–1620). Die EKBB entstand in ihrer heutigen Gestalt im Jahr 1918 durch den Zusammenschluss der bis dahin selbständigen evangelischen Kirchen Augsburger und Helvetischen Bekenntnisses. Deren Existenz wurde nach dem Ende der harten Gegenreformation, die von 1620 bis zum Erlass des Toleranzpatens durch Kaiser Joself II. im Jahr 1781 dauerte, erlaubt. Die strengen Beschränkungen mussten die Evangelischen freilich auch danach beachten, bis zum Erlass des Protestantenpatentes im Jahr 1861.
In der Zeit ihrer Entstehung hatte die EKBB 250 000 Mitglieder, im Jahre 1938 waren es dann schon 325 000 Mitglieder. Heute ist die Kirche in 14 Seniorate aufgeteilt mit einer Gesamtzahl von 250 Gemeinden und ca. 80 000 Gemeindegliedern. Die Kirche wird vom sechsköpfigen Synodalrat geleitet, der auf sechs Jahre gewählt wird. Repräsentiert wird die Kirche vom Synodalsenior und vom Synodalkurator.
EKBB besucht Partnerkirche in Südkorea
 Der Synodalsenior Daniel Ženatý unternahm im Oktober 2019 einen seit langem vorbereiteten Besuch bei der Presbyterianischen Kirche in Korea, der Presbyterian Church of Korea (PCK). Die EKBB unterhält mit dieser Kirche schon lange freundschaftliche Beziehungen. In Prag versammeln sich regelmäßig in unseren Kirchen in Kobylisy und in Střešovice koreanische Christinnen und Christen.
Der Synodalsenior Daniel Ženatý unternahm im Oktober 2019 einen seit langem vorbereiteten Besuch bei der Presbyterianischen Kirche in Korea, der Presbyterian Church of Korea (PCK). Die EKBB unterhält mit dieser Kirche schon lange freundschaftliche Beziehungen. In Prag versammeln sich regelmäßig in unseren Kirchen in Kobylisy und in Střešovice koreanische Christinnen und Christen.
Der Synodalsenior führte in Korea Gespräche mit der Kirchenleitung und mit den Dozenten der theologischen Hochschulen in Seoul und Gwangju.
Er traf sich mit der Vorsitzenden des Koreanischen Missionswerks, das in 127 Ländern der Erde Einsätze hat. Er besuchte auch eine neu gegründete Gemeinde unweit von Seoul. Daniel Ženatý predigte in zwei Gemeinden in Seoul und an der Universität in Gwangju. An beiden Hochschulen hielt er einen Vortrag zum Thema: „Die EKBB von der Unfreiheit zur Freiheit – der Übergang von einem totalitären Regime zur Freiheit.“
Der Synodalsenior hörte von den Christinnen und Christen in Südkorea, dass ihnen die Situation in Nordkorea am Herzen liegt. Sie beten dafür, dass das Land Freiheit erlangt und dass es zu einer Form der Vereinigung kommt.
Die Koreaner interessieren sich dafür, welche Erfahrungen unsere Kirche gemacht hat, als sie im vergangenen Jahrhundert zwei totalitäre Regime überstand. Unsere Erfahrungen helfen ihnen zu verstehen, was es heißt, in Unfreiheit zu leben. Sie verfolgten auch mit Interesse, wie wir den Übergang zu einer völligen finanziellen Unabhängigkeit in einer Zeit gestalten, in der nach Jahren steigender Mitgliederzahlen die Zahl der Mitglieder zurückgeht.
Dass wir voneinander wissen und für die Freiheit derer beten, die nicht in Freiheit leben, ist unerlässlich, betont der Synodalsenior.
Daniela Ženatá
Sie alle bewegen sich einfach nur
 Es öffnet mir ein etwas legerer, höflicher junger Mann mit einer Zigarette zwischen den Fingern, gefolgt von einem großen, gutmütigen Hund. Tomáš Jun ist ein Pfarrer am Beginn seines Dienstes wie andere. Nur, dass er sich für die Kirchengemeinde in Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe) entschieden hat, deren Situation sich rasant verändert. Alles deutet jedoch gerade darauf hin, dass es die richtige Entscheidung war. Im Vergleich zur Vergangenheit sind die Aussichten ziemlich hoffnungsverheißend. Tomáš Jun hat evangelische Theologie studiert. Das Vikariat absolvierte er im Prager Stadtteil Libeň und 2018 wurde er in Ústí nad Labem in sein Amt eingeführt. Gemeinsam mit ihm zogen seine Frau, Absolventin des Studiums der pastoralen und sozialen Arbeit an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Karlsuniversität, und seine zwei, noch sehr kleinen, Söhne um. Die Villa, welche das evangelische Pfarrhaus beherbergt, ist uralt. Im Amtszimmer hängen ein paar Fotos, eins davon von einer Konfirmation Anfang der 1950er Jahre. Es waren damals 50 Konfirmanden und die Gemeinde hatte insgesamt an die 4000 Gemeindeglieder (!). Zehn Jahre später waren es schon nur noch ein Zehntel so viel.
Es öffnet mir ein etwas legerer, höflicher junger Mann mit einer Zigarette zwischen den Fingern, gefolgt von einem großen, gutmütigen Hund. Tomáš Jun ist ein Pfarrer am Beginn seines Dienstes wie andere. Nur, dass er sich für die Kirchengemeinde in Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe) entschieden hat, deren Situation sich rasant verändert. Alles deutet jedoch gerade darauf hin, dass es die richtige Entscheidung war. Im Vergleich zur Vergangenheit sind die Aussichten ziemlich hoffnungsverheißend. Tomáš Jun hat evangelische Theologie studiert. Das Vikariat absolvierte er im Prager Stadtteil Libeň und 2018 wurde er in Ústí nad Labem in sein Amt eingeführt. Gemeinsam mit ihm zogen seine Frau, Absolventin des Studiums der pastoralen und sozialen Arbeit an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Karlsuniversität, und seine zwei, noch sehr kleinen, Söhne um. Die Villa, welche das evangelische Pfarrhaus beherbergt, ist uralt. Im Amtszimmer hängen ein paar Fotos, eins davon von einer Konfirmation Anfang der 1950er Jahre. Es waren damals 50 Konfirmanden und die Gemeinde hatte insgesamt an die 4000 Gemeindeglieder (!). Zehn Jahre später waren es schon nur noch ein Zehntel so viel.
Wie war Ihr erster Eindruck von der Gemeinde in Ústí?
Der Gemeindekern ist verschwunden. Es gibt seit acht Jahren keinen Ältestenrat und eine Gemeinde ohne Älteste ist keine Gemeinde, denn sie hat keine Leute, die sich um sie kümmern. Es gab da mehrere Negativfaktoren. Zum Beispiel war während der ganzen Ära des Sozialismus das Gebäude der Staatssicherheit direkt gegenüber unserer Kirche, die wir uns mit der hussitischen Gemeinde teilen.
Deshalb hatten wohl einige einfach Angst, überhaupt zu kommen.
Als ich bei einigen Senioren nachgefragt habe, meinten sie, sie wollten damals nicht, dass ihre Kinder Probleme bekommen. Ja, die Gemeinde hatte 4000 Mitglieder, aber diese hatten keinen großen inneren Zusammenhalt, es waren Leute, die nach dem Krieg hergekommen waren, nach der Vertreibung der Deutschen. Sie kannten sich nicht. Kirchenbesuche waren in der Arbeit nicht gern gesehen. Kein Wunder, dass die Mitgliedszahlen gesunken sind.
Und was ist mit der Stadt an sich?
Das kommt auf den genauen Ort an. Einige Örtlichkeiten hier sind grauenhaft. Předlice, Střekov- tausende Leute, die in für uns unverständlich ärmlichen Verhältnissen leben. Die Löhne in Nordböhmen sind um ein Vielfaches niedriger als in Prag, da wohnen außerdem viele Roma, welche nur Hilfsarbeit, Arbeit ohne Bildungsabschluss, zum untersten Mindestlohn leisten. (Anm. der Übersetzerin: seit Januar 2020 erhöht auf 3,40€ pro Stunde) Vor dem Zweiten Weltkrieg war Ústí eine ungeheuer reiche Stadt. Und deshalb gibt es natürlich auch noch wunderschöne alte Villenviertel, wie unsere Pfarrei. Die Stadt hat mehrere Wunden. Eine ist die einschneidend hohe Anzahl von Vertreibungen- von 62 000 Einwohnern wurden 50 000 vertrieben. Es gab hier auch eine große jüdische Gemeinde, die ermordet wurde. Und dann wurde Ústí im April 1945 massiv bombardiert, das ganze Altstadtzentrum lag in Trümmern. Die Hauseigentümer wurden vertrieben und es wurden Neubauten errichtet.
Sie wussten, was Sie hier erwartet. Wie wollen Sie damit umgehen? Haben Sie sich Sorgen gemacht? Oder hat Sie gerade das Risiko gereizt?
Ich bin schon nicht mehr so jung, als dass mich ein Abenteuer reizte. Es geht mir darum, dass es wenige Pfarrer gibt und, meiner Meinung nach, sollten die dorthin, wo es am meisten brennt. Wo sonst sollte man das Evangelium verkünden als in Nordböhmen, wo nur wenige Leute gläubig sind, wo es genug schlechte Neuigkeiten und viel Hoffnungslosigkeit gibt?
Ich möchte nicht in eingefahrene Denkmuster geraten- wie mir der Ort gefällt, wie die Pfarrei ist, wieviel Mitglieder es gibt...es ist nötig, von diesen traditionell evangelischen Positionen wegzukommen, zu einer Kirche, die nach außen hin offen ist, die die Fähigkeit hat, „Suchende“ anzuziehen, wie Tomáš Halík sagt. Ich sage aber nicht, dass ich weiß, wie das geht.
Angebote hatten Sie aber wahrscheinlich mehrere, oder?
Sicher, der Überdruck war riesig, Anfragen kamen aus 17 Kirchengemeinden und bei den anderen Kollegen im Vikariat war das ziemlich ähnlich.
Warum hat die Anzahl der Pfarrer, auch der Theologiestudierenden so abgenommen? In der kommunistischen Ära war es paradoxerweise besser.
Ich würde sagen, dass glauben heute nicht gerade trendy ist. Vor der Revolution ging viel über den Widerstand gegen das Regime. Aber jetzt? Der Meinung vieler Leute nach, ist man als Gläubiger irrational, oder gar dumm. Wenn man in der heutigen konsumorientierten und, zumindest scheinbar, rationalen Zeit diesen Stempel aufgedrückt bekommen hat, ist man abgeschrieben. Es braucht viel Unterstützung- von den Leuten und von Gott. Die Leute haben von der Evangelisch-Theologischen Fakultät ein verzerrtes Bild, es ist wirklich nicht so einfach. Mit dem Studium haben, auch mit Fernstudenten, mit uns 70 angefangen und zehn haben das Studium tatsächlich abgeschlossen.
Studenten schließen ein Theologiestudium ab und dann kommt nichts?
Ja, zu den Studienzeiten meiner Mutter wurden alle Absolventen danach Pfarrer. Heute sind es nur noch die Hälfte. Selbstverständlich hat das auch mit der Bezahlung zu tun. Aber vielleicht auch eine gewisse Verunsicherung - sollte ich Pfarrer werden, wer weiß, wie die Kirche in zehn Jahren aussehen wird? Aber mir erscheint tatsächlich schlimmer als der Pfarrermangel, wie die Evangelische Jugend abnimmt. Als ich auf unserem jährlichen Jugendtreffen war, waren wir um die 1000, heute sind es 500. Ich denke, dass unsere Kirche nicht in der Lage ist, mit jungen Leuten zu arbeiten, sie nimmt sie nicht wahr.
Kann man feststellen, ob es in der Zeit seit Sie da sind, sichtbare Veränderungen gibt? Etwa an der Anzahl der Menschen im Gottesdienst?
In der ersten Hälfte des Jahres 2018 kamen im Durchschnitt acht Leute. Ich bin im Oktober gekommen, zum Jahresende waren es schon 23 im Durchschnitt. Es freut mich auch, dass ich drei neue junge Männer in Taufvorbereitung habe und dass sie mit ihren Familien zu uns kommen. Ich muss dazusagen, dass einige Leute aus anderen Kirchen zu uns gekommen sind. Aber ich meine nicht, dass dies allein mein Verdienst sei.
Die Gemeinde in Usti ist ein „geförderter Ort“. Was genau bedeutet das?
Das betrifft in erster Linie den Personalfonds. Wenn eine Gemeinde nicht in diesen Fonds einzahlen kann, kann sie Unterstützung beantragen, diese muss allerdings von der Synode genehmigt werden. Die Förderung läuft für vier Jahre, danach kann sie weitergenehmigt werden.
Und was ist mit dem fehlenden Ältestenrat?
Dafür haben wir eine Verwaltungskommission gebildet. Sie tagt hier in Ústí nad Labem einmal im Monat, sie hat neun Mitglieder.
Um einen Ältestenrat zu konstituieren, braucht man sechs Leute, die sich über sechs Jahre lang verpflichten und dazu noch zwei Vertreter. Dieses Jahr wird der aber nicht zustande kommen.
Offensichtlich schaffen Sie das hier gut. Gibt es noch etwas, womit Sie nicht gerechnet hatten, was Sie irgendwie stört?
Den Großteil meiner Zeit rauben mir Tätigkeiten, die nichts mit dem Pfarrersein zu tun haben. Das sind Dinge, die das Gemeindeleben schrecklich ausbremsen. Über den Tag telefoniere ich, im Monat an die 40 Stunden, ich bin auf dem Bau und manchmal muss ich auch auf unsere beiden Jungen aufpassen. Und der Papierkram! Das ist wirklich enorm viel. Deshalb schreibe ich meine Predigten meistens Samstagnacht, gehe um fünf Uhr früh schlafen. In der Tat findet die eigentliche Pfarrertätigkeit nachts statt.
Sind Sie froh, dass Sie sich entschlossen haben, hierher zu kommen? Bereuen Sie etwas?
Ganz und gar nicht! Ich denke, ich bin dort, wo ich sein soll.
Als niemand anderes hierher wollte, wollte ich. Und ich sehe, dass es gut ist, Hoffnung liegt in der Luft. Es kommen Leute, die schon lange nicht mehr hierher gekommen sind, es gibt neue Gesichter. Die Hauptsache ist, einen Gemeindekern zu bilden, der sich um die Kirche kümmert. Ich glaube, dass es in 15 Jahren eine starke Kirche geben wird und jeder hierher kommen wird.
Jana Plíšková
Besuch aus Glasgow in Prag
In der zweiten Adventswoche waren bei uns in der Gemeinde Dejvice in Prag 6 sechs Mitglieder der Gemeinde Wellington in Glasgow zu Gast. Ihr Besuch sollte ein erster Schritt zu einer möglichen Partnerschaft zwischen unseren beiden Gemeinden sein. Vor einiger Zeit hatte unser Gemeindevorstand beschlossen, eine Verbindung zwischen uns und einer Gemeinde in einem anderen Land zu prüfen. Es wurde eine kleine Gruppe von vier Freiwilligen gebildet, bestehend aus unseren beiden Pfarrern, unserer Gemeindesekretärin und mir, um diese Angelegenheit voranzutreiben. In Zusammenarbeit mit David Sinclair, einem Pfarrer der Kirche von Schottland, der hier in Prag mit der Abteilung für Ökumene und Internationale Beziehungen der EKBB zusammenarbeitet, kam die Idee auf, mit der Gemeinde Wellington Kontakt aufzunehmen. Der Adventsbesuch war die erste Frucht dieses Kontakts.
Unsere Gäste waren von Freitag bis Montag bei uns. Am ersten Abend stand ein Konzert in unserer Kirche auf dem Programm. Anschließend trafen die Besucher einige Vertreter unserer Gemeinde zum Abendessen in einer örtlichen Brauerei.
Am Samstag wurde das historische Prag erkundet (außerordentlich bereichert dadurch, dass unsere Gemeindesekretärin Martina Študentová uns leitete, die auch professionelle Stadtführerin ist). Es folgten ein Besuch des Karlsbrückenmuseums und eine Bootsfahrt auf der Moldau. Die Bethlehem-Kapelle, eine Nachbildung von Jan Hus’ Predigthaus aus dem 15. Jahrhundert, interessierte unsere Besucher so sehr, dass wir dort über eine Stunde verbrachten, ehe Tee und weitere Konzerte folgten.
Am Sonntag besuchten die Gäste unseren Gottesdienst zum zweiten Advent, den der Kirchenchor umfangreich ausgestaltete und der von unserer Pfarrerin Magdalena Trgalová gehalten wurde. Bei Tee und Kaffee gab es danach für viele unserer Gemeindemitglieder Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen mit den Gästen. Im Anschluss war die Gruppe bei den Sinclairs zum Mittagessen eingeladen.
Am letzten Besuchstag wurde die Gruppe von unserem Pfarrer Pavel Ruml zu einem Besuch des Gefängnisses und des Militärkrankenhauses eingeladen. Schließlich konnten wir gerade noch mit Pavel Ruml und Kamil Trgala das Mahnmal besuchen, das an die Auslöschung des Dorfes Lidice im Zweiten Weltkrieg erinnert, dann wurde es Zeit, unsere schottischen Gäste zum Flughafen zu bringen.
Der Besuch war ein Besuch der Freude und des Segens, unter der Führung des Heiligen Geistes, und vielleicht der Beginn einer neuen Partnerschaft, die, meine ich, wenn sie auch nicht für immer und ewig bestehen muss, unseren beiden Gemeinden großen Segen bringen kann.
Daniel Molnár
(geschrieben für die Kirchennachrichten von Dejvice, Souterrain 1/2020, in denen der vollständige Artikel zu finden ist; bearbeitet von David Sinclair)
DIE DIAKONIE DER EKBB
 Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Tel: (+ 420) 242 487 811 (812); Fax: (+420) 242 487 834
E-mail: info@diakonie.cz
Internet: www.diakonie.cz
Die Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) ist eine gemeinnützige christliche Organisation, die Hilfe und Unterstützung anbietet für ein würdiges und vollwertiges Leben, auch wenn es durch Alter, Krankheit, gesundheitliche Behinderungen, Isolation, schwierige soziale Situationen und andere Lebenskrisen beeinträchtigt ist. Die Dienste der Diakonie der EKBB erfolgen auf der Grundlage der Botschaft des Evangeliums von der Liebe Gottes und nach dem Vorbild des Dienstes Jesu Christi. In ihren Zentren und Spezial-Schulen bietet die Diakonie soziale, gesundheitliche, Bildungs- und Seelsorgedienste an. Unter den nicht-staatlichen Organisationen, die soziale Dienste anbieten, ist die Diakonie der EKBB die zweitgrösste Institution.
Freunde der Diakonie unterstützten Familien und Kinder. Kurz über die Asylheime, denen die Kollekte „Schuhkarton“ geholfen hat
 Fast eine Million tschechische Kronen spendeten am Jahresende vergangenen Jahres Freunde der tschechischen Diakonie für helfende und unterstützende Dienste für Familien und Kinder. Dank dessen können sich im Jahre 2020 unsere diakonischen Institutionen verbessern.
Fast eine Million tschechische Kronen spendeten am Jahresende vergangenen Jahres Freunde der tschechischen Diakonie für helfende und unterstützende Dienste für Familien und Kinder. Dank dessen können sich im Jahre 2020 unsere diakonischen Institutionen verbessern.
Das Asylheim für Mütter mit Kindern – Diakonie Leitmeritz
Die Mütter, die im Asylheim wohnen, sind in einer schlechten finanziellen Lage. Meistens können sie die laufenden Kosten für ihre Kinder nicht bezahlen, in der Regel geht es um Kindergarten- und Schulkosten. Bei Kleinkindern geht es häufig um Verpflegungsgeld, bei größeren Kindern um Schulsachen. Aber es sind auch geeignete Schuhe, Brillen, Schulausflüge oder Säuglingsbedarf, die im strapazierten Familienbudget eine Rolle spielen. Die Spenden helfen Müttern und ihren Kindern wie normale Familien zu leben.
Kinderklub Rubikon – Diakonie Vsetín
In der Stadt Vsetín geht es um einen sehr wichtigen Service. Er bietet eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für Kinder aus Romafamilien, die vor 14 Jahren aus dem Stadtzentrum in die Vorstadt ausgewiesen wurden, wo sie nur schwer zu erreichen sind. Das Leben in diesem neuartigen Ghetto hat auf die Kinder einen schlechten Einfluss. Der Rubikon-Klub versucht dies mit einer bunten Palette von Programmen und Aktivitäten zu ändern. Die Finanzen aus der Kollekte dienen der Ausstattung einer Kunstwerkstatt, auch ein Lektor für die Musikwerkstatt sowie eine Tanzwerkstatt werden dadurch bezahlt.
Klub Robinson des diakonischen Zentrums christlicher Hilfe in Prag
Der Klub hilft Kindern, deren Familien eine Krise durchleben (Scheidung, schlechte finanzielle Situation, unkontrollierbare Probleme der Kinder in der Schule usw.). In Form von regelmäßigen Besuchen kultureller Programme gibt er ihnen therapeutische Unterstützung und arbeitet zugleich mit den Eltern. Ziel ist, dass die Familien die Krise so überwinden, dass sie zusammen bleiben.
Hilfe für sozial benachteiligte Familien der Schüler der diakonischen Spezialschule Rolnička in Soběslav
Die diakonische Schule Rolnička in Soběslav ist sehr gefragt. Schülern mit nicht gerade einfachen körperlichen und geistigen Behinderungen bietet sie vielfältige Programme von hoher Qualität. Die schlechte ökonomische Situation der Familien mancher Schüler ermöglicht es ihnen aber nicht, an finanziell anspruchsvolleren aber sehr beliebten Schulaktivitäten teilzunehmen. Es geht zum Beispiel um einwöchige Kuren, Sommercamps mit Freiwilligen, Tanzkurse für Schüler der Spezial-Mittelschule, Ausflüge, Exkursionen, Theater und Kinobesuche. Dank der Spenden können auch diese Kinder an solchen Aktivitäten teilnehmen.
Streetwork in chat – Diakonie Západ
Im Internet suchen Kinder und Jugendliche heute nicht nur Spaß oder Informationen, sondern auch Rat oder direkte Hilfe. Das originelle Projekt Streetwork in chat der Diakonie Západ kommt diesem entgegen. Es wirkt in der weiten Umgebung der Stadt Pilsen. Im Gegensatz zu konventionellen Internet-Beratungsdiensten, bei denen der Suchende den ersten Schritt machen muss, gibt es in dem Projekt Streetwork in chat einen speziell geschulten Mitarbeiter, der die Menschen vor allem über soziale Medien anspricht, Hilfe anbietet, die virtuelle Kommunikation kultiviert und die Nutzer dazu führt, ihre Probleme mit ruhigem Geist zu lösen – selbstständig oder mit fachlicher Unterstützung.
Adam Šůra
Was im Jahr 2019 in der Diakonie neu entstanden ist. Die Diakonie dankt für Unterstützung aus dem Ausland
 Dem ständigen Mangel an Finanzen für die Leistungen der tschechischen Diakonie aus staatlichen Ressourcen will die Diakonie jetzt mit verstärktem Fundraising entgegenwirken. Pilotversuche gab es schon im Jahre 2019 und sie wurden als erfolgreich und sinnvoll bewertet. Im Jahre 2020 wird das Projekt fortgesetzt. In der Fundraising-Entwicklung ist die Diakonie von ihren ausländischen Freunde unterstützt worden, vor allem von der Presbytarian Church Sewickley, Pennsylvania. Auch weitere Auslandshilfe nahm die Diakonie dankend an. Fortgesetzt wurde zum Beispiel die langjährige Zusammenarbeit mit der italienischen Waldenser Kirche Chiesa Valdese, die traditionell die Hilfsprojekte der Diakonie im Ausland (zum Beispiel in der Ukraine), Investitionen und Innovationen unterstützt. Dieses Jahr helfen die Mittel der Waldenser zum Beispiel bei der Rekonstruktion der Diakonie Rolnička. Danke!
Dem ständigen Mangel an Finanzen für die Leistungen der tschechischen Diakonie aus staatlichen Ressourcen will die Diakonie jetzt mit verstärktem Fundraising entgegenwirken. Pilotversuche gab es schon im Jahre 2019 und sie wurden als erfolgreich und sinnvoll bewertet. Im Jahre 2020 wird das Projekt fortgesetzt. In der Fundraising-Entwicklung ist die Diakonie von ihren ausländischen Freunde unterstützt worden, vor allem von der Presbytarian Church Sewickley, Pennsylvania. Auch weitere Auslandshilfe nahm die Diakonie dankend an. Fortgesetzt wurde zum Beispiel die langjährige Zusammenarbeit mit der italienischen Waldenser Kirche Chiesa Valdese, die traditionell die Hilfsprojekte der Diakonie im Ausland (zum Beispiel in der Ukraine), Investitionen und Innovationen unterstützt. Dieses Jahr helfen die Mittel der Waldenser zum Beispiel bei der Rekonstruktion der Diakonie Rolnička. Danke!
Adam Šůra
Fastenkollekte 2020. Die Diakonie hilft im Ausland
Sámer ist zehn Jahre alt. In den Libanon flüchtete er mit seiner Familie vor dem Syrienkrieg. Sie kamen in das Armenviertel am Rande von Beirut, wie auch viele andere syrische Familien.
Der Vater von Sámer, Ahman, wurde durch den Krieg traumatisiert und bekam Epilepsie. Er versucht zu arbeiten, aber es geht nicht an jedem Tag. Der fünfköpfigen Familie fehlte oft das Geld für Wohnen und Essen. Sámer begann, in einem Friseursalon zu arbeiten. Am Vormittag verdiente er so ungefähr zwei Dollar. Diese kleine Aufbesserung des Familienbudgets war ein viel zu hoher Preis dafür, dass der zehnjährige Junge nicht zur Schule gehen konnte.
Die Mutter von Sámer kontaktierte also Tahaddi, ein Kommunitätszentrum, welches ihr ihre Nachbarinnen empfohlen hatten. Tahaddi hat eine eigene Schule und Sámer fand dort einen Platz. Sámer´s Schulbesuch bedeutet für die Familie aber ein Loch im Budget.
Das Zentrum rechnet jedoch mit solchen Problemen. Sámer ist nicht das einzige Kind aus einer Flüchtlingsfamilie, welches vor dem Dilemma „Tageslohn oder Schule“ steht. Die Familie bekam Förderungen für Essen und auch einen finanziellen Beitrag zum Kauf einer Waschmaschine und einen kleinen Herd. Das alles dank der Unterstützung des tschechischen Außenministeriums, welche im Libanon durch die Diakonie vermittelt wird.
Hoffnung in die Zukunft
Der Wechsel hat Sámer gut getan. Er ist von seinen Mitschülern, den Schulausflügen und der Vielfältigkeit des Schulprogramms begeistert. Er plant Sportlehrer zu werden, fleißig ist er aber auch in den anderen Fächern. Auch Sámer´s zwei Schwestern haben erneut mit ihrer Bildung angefangen. Die ältere besucht Schreib- und Lesestunden und die jüngere wird mit der Unterstützung der Lehrer aus Tahaddi von der Mutter zuhause unterrichtet. Dank der systematischen Hilfe von Tahaddi und der tschechischen Unterstützung geht es der Familie viel besser. Das Essensgeld nahm ihnen frühere tägliche Angst, ob sie überhaupt etwas zu essen bekommen. So können alle Familienmitglieder mit größerer Freude in die Zukunft sehen. Die Situation im Libanon ist aber sehr kompliziert. Das Land mit einer Fläche etwas größer als Südböhmens beherbergt 1,5 Millionen Flüchtlinge, vor allem aus Syrien. Die Regierung kümmert sich derweil nicht sehr gut um das Land. Die miserable ökonomische Situation hat ihre Wurzeln in der Korruption, so meinen die die meisten Einwohner des Libanons. Letztes Jahr im Herbst durchschüttelten deswegen Massenproteste das Land. Dies gefährdet nicht nur Gewerbetreibende, sondern auch Organisationen, die den Familien, wie der von Sámer, helfen.
Für die Kleinsten
Die Spenden der diesjährigen Fastenkollekte widmet die Diakonie deswegen einer weiteren Aktivität des Kommunitätszentrums Tahaddi – dem vorschulischen Bildungszentrum. In den Kommunitätskindergarten gehen nicht nur Flüchtlingskinder, sondern auch die Kinder der Ärmsten im Libanon. Sie können hier ohne Gefahr spielen und lernen die Prinzipien der Hygiene und einer gesunden Ernährung. Sie lernen Farben, Tiere, Buchstaben und Zahlen. Das alles sind Voraussetzungen für den Besuch einer normalen staatlichen Schule, wo sie die so wertvolle Grundbildung erhalten. Der Kindergarten berücksichtigt auch die spezifischen Bedürfnisse der Kinder mit einer Behinderung, die den Kindergarten ebenfalls besuchen.
Falls die Fastenkollekte einen solchen Erfolg wie in den letzten Jahren erlebt, werden so die Gehälter der Kindergartenmitarbeiter für ein ganzes Jahr gedeckt. Das ist für eine Organisation wie Tahaddi eine riesige Unterstützung.
Adam Šůra
DIE EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT DER KARLSUNIVERSITÄT IN PRAG (ETF UK)
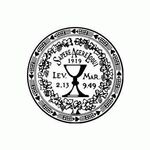 P.O. Box 529, Černá 9,
P.O. Box 529, Černá 9,
CZ 115 55 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 221 988 211; Fax: (+ 420) 221 988 215
E-Mail: intl@etf.cuni.cz
Internet: http://web.etf.cuni.cz/ETFENG-1.html
Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Karlsuniversität (ETF UK) ist die Nachfolgerin der Jan-Hus- Fakultät (1919–1950) und der Comenius-Fakultät (1950–1990). Im Jahr 1990 wurde sie in die Karlsuniversität eingegliedert. Die Verwaltung der Fakultät wird vom Dekan und dem Team der Prodekane geleitet, die auf vier Jahre in ihr Amt gewählt werden. Die Fakultät bietet Bakkalaureats- und Master-Studiengänge an – in evangelischer Theologie, Diakonie (Seelsorge und Sozialarbeit), ökumenische Studien, und verschiedene theologische Bereiche auf Doktoranden-Ebene. Die Fakultät ist ökumenisch für alle offen. Pfarrerinnen und Pfarrer der EKBB erhalten hier ihre Ausbildung.
Ein Rückblick auf die Geschichte der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Prag, 100 Jahre nach ihrer Gründung
Als die Evangelisch-Theologische Fakultät 1919 gegründet wurde, war dies für Studenten seit Jahrhunderten die erste Möglichkeit, in den Ländern der böhmischen Krone offiziell evangelische Theologie zu studieren. Vor dem Ersten Weltkrieg war Böhmen Teil des katholischen Österreichs gewesen, und dort gab es viele Einschränkungen für Protestanten. Wer den Beruf des Pfarrers ausüben wollte, musste zum Studium nach Wien gehen.
Mit der Gründung des neuen tschechoslowakischen Staates nach dem Krieg kam die volle Religionsfreiheit. Reformierte und lutherische Protestanten schlossen sich zur Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) zusammen. Eine ihrer ersten Maßnahmen war die Einrichtung der Evangelisch-Theologischen Fakultät, damit die ihr zugehörigen Theologiestudenten und die anderer Kirchen in Böhmen auf Tschechisch ausgebildet werden konnten ‒ mit einem Studienprogramm, das die spezifisch tschechischen protestantischen Traditionen von Jan Hus und den tschechischen Brüdern berücksichtigte. Die Fakultät (ursprünglich als Tschechoslowakische Evangelisch-Theologische Hus-Fakultät bekannt) wurde durch ein am 8. April 1919 verabschiedetes Gesetz der Tschechoslowakischen Republik als unabhängige Hochschule gegründet. Der Unterricht begann im Oktober 1919 in bescheidener Umgebung in der Sakristei der evangelischen Salvatorkirche in Prag mit nur 14 Studenten, aber die Fakultät zog bald in geeignetere Räumlichkeiten um, und die Zahl der Studenten wuchs stetig. Ab 1922 studierten auch Frauen an der Fakultät; ihre Zahl nahm erheblich zu, nachdem die Synode der EKBB 1953 beschlossen hatte, Frauen zu ordinieren.
Während der Besatzung durch die Nationalsozialisten in den 1940er Jahren wurde die Fakultät zusammen mit den meisten anderen Hochschulen geschlossen, nahm jedoch ihre Aktivitäten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder auf. 1950 beschloss der kommunistische Staat, die Fakultät zu teilen: in die Theologische Hus-Fakultät für Studierende der tschechoslowakischen hussitischen Kirche und die Evangelisch-Theologische Comenius-Fakultät für Studierende der EKBB und der kleineren Kirchen. Unter der kommunistischen Herrschaft hatte die Comenius-Fakultät viele Schwierigkeiten, und die Zahl der Studierenden sank auf unter 100. In den 1950er und 1960er Jahren war der führende tschechische protestantische Theologe Josef Lukl Hromádka Dekan der Fakultät.
Der Sturz des kommunistischen Regimes im Jahr 1989 brachte für die Comenius-Fakultät neue Möglichkeiten und viele Veränderungen mit sich. 1990 wurde sie in die Karlsuniversität eingegliedert und in Evangelisch-Theologische Fakultät umbenannt. 1995 zog die Fakultät in ein größeres Gebäude um, an ihren heutigen Standort in der Černá-Straße. Die Zahl der Studierenden stieg rasch, was eine Abkehr von der früheren familiären Atmosphäre bedeutete. Auch gab es nun einige Studenten ohne kirchlichen Hintergrund. Ein Schwerpunkt wurde zunehmend auf die Forschung gelegt, wodurch die Zahl der Doktoranden anstieg. Die Öffnung der Grenzen innerhalb Europas ermöglichte es der Fakultät, ihre internationalen Kontakte und den Austausch zu intensivieren, die für die kleine tschechische evangelische Gemeinschaft so wichtig sind.
In den späten 1990er Jahren wurden neue Studienprogramme in den Bereichen Seelsorge und Sozialarbeit sowie Theologie christlicher Traditionen ins Leben gerufen. Zuletzt entwickelte die Fakultät ein erfolgreiches Programm für lebenslanges Lernen für Rentner und andere Menschen, die sich für Theologie interessieren. Im Studienjahr 2019/2020 gibt es an der Fakultät rund 550 Studierende, darunter etwa 100 Studenten für lebenslanges Lernen. Trotz der vielen Veränderungen, die sie in den 100 Jahren ihres Bestehens erfahren hat, bemüht sich die Fakultät noch immer, ihrer ursprünglichen Berufung zu folgen und die Studierenden darin anzuleiten, die Herausforderungen ihrer Zeit im Lichte von Gottes Wort und der tschechischen evangelischen Tradition kritisch zu untersuchen.
Peter Stephens
Die Evangelisch-Theologische Fakultät feiert ihr hundertjähriges Bestehen
Unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Gründung des neuen tschechoslowakischen Staates schlossen sich die lutherischen und die reformierten Christen in der Tschechoslowakei zur Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder zusammen. Und eines der ersten Dinge, die die neue Kirche tat, war die Einrichtung einer Fakultät für evangelische Theologie, damit ihre Theologiestudenten in Böhmen in tschechischer Sprache ausgebildet werden konnten.
Hundert Jahre später ist die Fakultät immer noch stark und feierte im November 2019 den 100. Jahrestag ihrer Gründung mit einer Reihe verschiedener Veranstaltungen.
en Auftakt zu den Feierlichkeiten bildete die Jahresversammlung des Vereins der Freunde der Fakultät am Freitag, dem 8., und Sonnabend, dem 9. November. Die Mitglieder des Vereins, der selbst sein 20-jähriges Bestehen feierte, hörten von einer Reihe ehemaliger Studenten der Fakultät, welchen Beruf sie jetzt ausüben und wie ihr Theologiestudium sie darauf vorbereitet hat. Es gab eine breite Palette interessanter Beiträge, nicht nur von jenen, die jetzt in der Kirche arbeiten, sondern auch von einem Hochschullehrer für Philosophie, einem Anwalt, einem Schriftsteller, einem Regierungsbeamten und einem derzeitigen Studenten, der an Aktivitäten gegen den Abbau der Rechtsstaatlichkeit im Land beteiligt ist.
Am Sonntag, dem 10. November, fand in der Kirche St. Martin in der Mauer ein Abendgottesdienst zum Dank für die hundert Jahre des Bestehens der Fakultät statt. Die Predigt wurde vom Doyen ihrer Hochschullehrer, Prof. Petr Pokorný, gehalten, der leider nur zwei Monate später starb.
Anlässlich des Jubiläums beschloss die Karlsuniversität, Manfred Oeming, Professor für Alttestamentliche Studien an der Universität Heidelberg, die Ehrendoktorwürde zu verleihen. Prof. Oeming ist ein alter Freund der Prager Fakultät, mit der er in den letzten 20 Jahren an einer Reihe gemeinsamer Projekte gearbeitet hat, darunter Blockseminare und kürzlich archäologische Ausgrabungen in Israel. Offiziell wurde die Doktorwürde am Montagnachmittag in der Großen Aula im zentralen Universitätsgebäude verliehen. Im Anschluss fand eine große Zusammenkunft statt, an der der Rektor der Karlsuniversität, Gäste aus dem Ausland, Vertreter anderer Fakultäten der Universität, anderer akademischer Institutionen und der Kirchen sowie der breiten Öffentlichkeit teilnahmen. Der Zeremonie folgte eine festliche Feier zum 100-jährigen Jubiläum der Fakultät, bei der Vertreter der Kirchen und der internationalen akademischen Gemeinschaft ein paar Grußworte sagten und Ehrenmedaillen an langjährige Freunde und Unterstützer der Fakultät aus dem akademischen, kirchlichen und publizistischen Bereich verliehen wurden.
Abgerundet wurden die Feierlichkeiten am Dienstag, dem 12. November, durch ein Symposium an der Fakultät. Der Hauptvortragssaal war gefüllt mit Gästen, die eine Reihe von kurzen Vorträgen hörten, von denen einige unterschiedliche Aspekte der Fakultätsgeschichte abdeckten, während andere einen kritischen Blick auf die Beziehungen der Fakultät zur Universität, zur Kirche und zur Gesellschaft warfen. Alle waren sich einig, dass die Vorträge, die hauptsächlich von jüngeren Lehrenden gehalten wurden, zum Nachdenken anregten und aufschlussreich und somit für die Entwicklung der Fakultät in den nächsten hundert Jahren vielversprechend waren.
Peter Stephens
Positive Energie für die Gesellschaft
 Am 25. Februar 2018 – fast 70 Jahre nachdem die Kommunisten in der Tschechoslowakei die Macht ergriffen, gründeten zwei Studenten der Evangelischen Theologischen Fakultät der Prager Karlsuniversität Mikuláš Minář und Benjamin Roll eine Organisation, deren Ziel es ist, die Demokratie in der Tschechischen Republik zu schützen. Die beiden merkten, dass die Demokratie in Gefahr ist, vorrangig durch die Person des Premierministers der Republik Andrej Babiš.
Am 25. Februar 2018 – fast 70 Jahre nachdem die Kommunisten in der Tschechoslowakei die Macht ergriffen, gründeten zwei Studenten der Evangelischen Theologischen Fakultät der Prager Karlsuniversität Mikuláš Minář und Benjamin Roll eine Organisation, deren Ziel es ist, die Demokratie in der Tschechischen Republik zu schützen. Die beiden merkten, dass die Demokratie in Gefahr ist, vorrangig durch die Person des Premierministers der Republik Andrej Babiš.
So entstand die Kampagne mit dem Titel „Millionen Momente für die Demokratie“, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Stimmen einer großen Mehrheit von Menschen zu vereinen, für die der Premierminister nicht tragbar ist. Die Organisatoren der Kampagne äußerten ihren Respekt vor dem Ausgang der demokratischen Wahlen, sie sehen ein, dass der Premierminister aus der Partei ANO gestellt werden würde, da ANO die meisten Stimmen hatte. Aber sie erachten es als untragbar, dass gerade ein strafrechtlich verfolgter Mensch Premier wird. Er ist angeklagt, weil er Fördermittel der EU unrechtmäßig erschlichen haben soll. Außerdem war er früher ein Agent der kommunistischen Staatssicherheit (tschechisch: StB).
Die Zahl der Unterschriften unter dem Slogan „Moment zum Zurücktreten“ wuchs in unerwarteter Schnelligkeit. Die Unterzeichner des Aufrufs kamen aus allen Gesellschaftsschichten, es waren unter ihnen auch bekannte und berühmte Persönlichkeiten. Zum 20. November 2018 waren unter der Petition 310.000 Unterschriften, im Mai 2019 waren es über 340.000 Unterschriften (zum Vergleich: die Tschechische Republik hat 10.300.000 Einwohner).
Als Unterstützung der Forderung „Millionen Momente“ begannen über die gesamte Republik verteilt Demonstrationen, die viel Druck erzeugten. Am Sonntag 23. Juni 2019 kamen in Prag über 280.000 Menschen zusammen, am 6. Dezember 2019 wurden Proteste in 220 Gemeinden und Städten in der gesamten Republik gezählt. Auch im Jahr 2020 sollen die Proteste weiter in den Kreisstädten stattfinden und am 1. März sind wieder weitere große Demonstrationen in Prag geplant.
Wir haben einen der Gründer der Kampagne, Benjamin Roll, gefragt, wie die Initiative weitergehen wird und was die letzte Zeit in Bezug auf ihre Forderungen brachte.
Ihre Initiative, die die Demokratie stärken will, ist sehr erfolgreich. Hunderttausende folgen ihr. Wie würden Sie Menschen in Westeuropa, den Leserinnen und Lesern des Bulletins, erklären, dass ihre Demokratie in Gefahr ist?
Unser Premierminister ist ein Mensch, der in einem Interessenkonflikt ist, was auch die EU-Kommission bestätigt hat. Er hat den größten medialen Einfluss und dank seines hervorragenden Teams für Öffentlichkeitsarbeit hat er großen Einfluss auf die öffentliche Meinung.
Im Abgeordnetenhaus des Tschechischen Parlaments stellt seine Partei die größte Anzahl an Abgeordneten, aber weil sie trotz einer Koalition mit den Sozialisten (ČSSD) keine Mehrheit haben, arbeiten sie mit den Kommunisten (KSČM) zusammen und nichtoffiziell auch mit der rechtsextremen Partei (SPD, deutsch: Freiheit und direkte Demokratie). Dadurch wird einem gefährlichen Rechtsruck die Tür geöffnet und so werden antidemokratische Ideologien gefördert. So wird es ihnen ermöglicht, entschieden die tschechische Politik zu beeinflussen.
Ein bedeutendes Problem ist auch, dass die Mehrzahl der Bürger auch dank der Babiš -Propaganda aufgehört hat, den staatlichen Institutionen zu trauen, den öffentlich-rechtlichen Medien und schließlich der Demokratie selbst. Sie haben aufgehört, sich zu interessieren, sich zu kümmern und sie hören auf, die Politik zu kontrollieren. Diese Richtung fördert auch der Pro-Kreml-Präsident der Republik Miloš Zeman, der in seinem Wahlkampf die Angst vor Fremden und Immigranten schürte.
Sie reagieren sehr flexibel auf das, was Sie als neue Gefahren für die Demokratie sehen. Trotzdem bleibt für Sie der Missbrauch der EU-Fördermittel durch den Premierminister eines Ihrer Hauptthemen. Warum?
Ein Interessenskonflikt ist das verständlichste Beispiel dafür, dass der Premierminister in seiner Hand zu viel Macht hält.
Andrej Babiš gehört praktisch die Firma Agrofert, eine der größten tschechischen Firmen, die dank seiner Position Vorteile hat. Die EU-Kommission hat klar festgestellt, dass die Firma von Babiš unrechtmäßig Fördergelder bezogen hat.
Jetzt droht uns, dass wir seine Firma aus dem Staatsetat bezahlen. Das betrifft jeden von uns. Und die tschechische Staatsverwaltung reagiert nicht angemessen und trifft keine Maßnahmen. Jetzt scheint es so, dass der Staat schon mehr den Interessen von Andrej Babiš dient, als andersrum.
Dennoch ist Andrej Babiš nicht unser einziges Thema. Wir wollen die Zivilgesellschaft aufwecken und miteinander vernetzen, weil wir in ihr einen wichtigen Pfeiler der Demokratie sehen, der auch nach dem Rücktritt von Babiš noch da sein wird. Uns geht es darum, eine politische Landschaft zu kultivieren, in der Politiker wie Babiš, Zeman und Konsorten keine Chance haben, an Macht zu gewinnen.
Was ist es, das Sie bei dieser Arbeit motiviert?
Wir kennen viele ausgezeichnete und sehr aktive Menschen in der gesamten Republik, wir formulieren Grundwerte, auf denen die Demokratie fußt. Und es freut uns, Hoffnung weiterzugeben und positive Energie für die Gesellschaft.
Ondřej Lukáš
Professor Petr Pokorný (1933–2020)
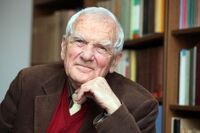 In den frühen Morgenstunden des 18. Januar 2020 starb Petr Pokorný, Professor für Neutestamentliche Studien an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Karlsuniversität, im Alter von 86 Jahren im Kreise seiner Familie. Mit ihm verloren die Fakultät und die Kirche einen herausragenden und beliebten Lehrer, einen scharfsinnigen Forscher von internationalem Ruf und einen unermüdlichen Organisator wissenschaftlicher Arbeit, dessen tiefgreifende Gelehrsamkeit in Bibelstudien, Theologie, Philologie und Philosophie mit der freundlichen und offenen Gewissheit eines Zeugen des christlichen Glaubens verbunden war.
In den frühen Morgenstunden des 18. Januar 2020 starb Petr Pokorný, Professor für Neutestamentliche Studien an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Karlsuniversität, im Alter von 86 Jahren im Kreise seiner Familie. Mit ihm verloren die Fakultät und die Kirche einen herausragenden und beliebten Lehrer, einen scharfsinnigen Forscher von internationalem Ruf und einen unermüdlichen Organisator wissenschaftlicher Arbeit, dessen tiefgreifende Gelehrsamkeit in Bibelstudien, Theologie, Philologie und Philosophie mit der freundlichen und offenen Gewissheit eines Zeugen des christlichen Glaubens verbunden war.
Petr Pokorný wurde am 21. April 1933 in Brünn geboren. Nach seinem Theologiestudium an der Evangelisch-Theologischen Comenius-Fakultät (heute Evangelisch-Theologische Fakultät der Karlsuniversität) wurde er 1958 ins Amt eines Pfarrers der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder eingesetzt, und von da an diente er bis 1967 der Kirche als Hilfspfarrer und Pfarrer in Prager Gemeinden. Während dieser Zeit studierte er auch koptische Sprache und griechische Literatur in Prag und Wien und verbrachte ein Semester zu einem Aufbaustudium in Oxford. 1963 verteidigte er seine Doktorarbeit und 1967 seine Habilitationsschrift, in beiden Fällen nach mehrjähriger Verzögerung seitens der kommunistischen Behörden.
Ab 1968 unterrichtete er als Assistent und späterer Nachfolger seines Lehrers Josef Bohumil Souček neutestamentliche Bibelkunde an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Prag und wurde 1972 zum Professor ernannt. In der Zeit von 1996 bis 1999 war er Dekan der Fakultät. Er war Gastprofessor an mehreren ausländischen Universitäten (Greifswald, Pittsburgh, Tübingen, St. Petersburg) und wurde von den Universitäten in Bonn, Budapest und St. Petersburg mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. Er war aktives Mitglied in einer Reihe führender akademischer Organisationen, insbesondere der Studiorum Novi Testamenti Societas und der Gelehrten Gesellschaft der Tschechischen Republik, deren Präsident er war. Ein wichtiges Ergebnis seiner Bemühungen um eine Zusammenarbeit in der Forschung ist das Zentrum für Bibelstudien, das der Karlsuniversität sowie der Tschechischen Akademie der Wissenschaften angehört, das er 1998 gründete und von 2001 bis 2010 leitete.
Die Forschungsinteressen von Professor Pokorný waren breit gefächert. Allgemein umschlossen sie die literarische und theologische Interpretation der neutestamentlichen Schriften und anderer zeitgenössischer Texte, im Speziellen die synoptischen Evangelien und deuteropaulinischen Briefe, den Gnostizismus sowie die Person und Bedeutung Jesu von Nazareth. Er war Mitglied des Übersetzerteams, das in den 1970er Jahren die tschechische ökumenische Übersetzung der Bibel erstellte.
Neben seiner Lehr- und Forschungsarbeit hörte Petr Pokorný nicht auf, praktizierender Theologe zu sein. Er war nicht nur ein akademischer Lehrer, sondern auch ein Prediger und zum Nachdenken anregender Interpret biblischer Texte, der Vorträge über theologische, historische und philosophische Fragen für kirchliche Kreise und die breite Öffentlichkeit hielt. In seiner eigenen Kirche war er Mitglied des theologischen Komitees und trug zum Gesangbuch seiner Kirche bei, indem er Texte für mehrere Kirchenlieder verfasste.
Als er vor einigen Jahren in den Ruhestand ging, sah er dies als Rücktritt von leitenden Funktionen und nicht als Rücktritt von der Arbeit. Bis zu seinem Tod spielte er eine aktive Rolle im Leben der Fakultät, hielt Vorlesungen und betreute mehrere Doktoranden. Im November 2019 hielt er die Predigt beim Festgottesdienst zum hundertsten Jahrestag der Gründung der Fakultät.
Er wird der Fakultät, seiner Kirche und natürlich seiner Familie sehr fehlen.
Daniela Ženatá
