Bulletin 47 – Sommer 2019
Der Leitarikel
Verehrte Leserinnen und Leser,
wirklich große Jubiläen wurden in unserer Kirche von 2015 bis 2018 fast ununterbrochen gefeiert. Und es ist kein völliges Ende in Sicht. Im Juni dieses Jahres feiert die Diakonie der EKBB 30 Jahre, da sie paradoxerweise knapp vor der Samtenen Revolution und dem Regimewechsel gegründet wurde. Die Diakonie ist auf soziale Dienste spezialisiert und in diesen 30 Jahren ist ihr wirklich viel gelungen; sie wurde zu einer kompetenten und bekannten NGO, hat auch ein Zentrum für humanitäre Hilfe, das in Ländern, die von Hunger, Fluten und weiteren Katastrophen betroffen sind, aktiv ist. Es arbeitet auch in Flüchtlingslagern, die von Mitteleuropa weit entfernt sind. Und man muss auch sagen, dass die Diakonie nach der katholischen Caritas die zweitgrößte Organisation dieser Art in der Tschechischen Republik ist. Von diesem Jubiläum werden Sie sicherlich in der nächsten Ausgabe unserer Nachrichten lesen, aber wie es der Diakonie gelungen ist, fünf Schulen für junge Schüler im fernen Myanmar zu renovieren, können Sie schon in dieser Ausgabe lesen; wir freuen uns darüber.
Die Schulen der Evangelischen Akademie – auch darauf kann unsere Kirche stolz sein. Der Wirkungskreis geht hier zwar nicht über Mitteleuropa hinaus, aber diese Schulen sind nicht weniger wichtig. In Brünn ist eine neue, siebte Schule entstanden, die den ansprechenden Namen Filipka trägt. Mehr darüber im Interview mit ihrer Direktorin.
Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder steht für diejenigen ein, die aufgrund ihrer Überzeugungen oder ihres Glaubens an verschiedenen Orten der Welt unterdrückt werden. Auch wenn wir nicht die Möglichkeiten oder die Macht haben, aktiv einzugreifen, können wir auf diese Situationen hinweisen, Diskussionen veranstalten oder demonstrativ widerständige Versammlungen. Auch dazu lesen Sie mehr in unseren Nachrichten – sicherlich nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal. Glauben wir, dass Zeiten kommen, in denen keine Protestaktionen mehr notwendig sind! Wenn nicht hier und jetzt, dann doch einst im Reich Gottes. Daran halten wir fest.
Mit den besten Wünschen für einen friedlichen und möglichst frischen Sommer
Im Namen des Redaktionsrats
Jana Plíšková
DIE EVANGELISCHE KIRCHE DER BÖHMISCHEN BRÜDER
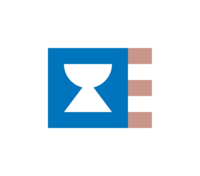 P.O. Box 466, Jungmannova 9,
P.O. Box 466, Jungmannova 9,
CZ 111 21 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 224 999 215(216); Fax: (+ 420) 224 999 219
E-Mail: ekumena@e-cirkev.cz
Internet: www.e-cirkev.cz
Die Grundlagen der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) wurzeln in der Utraquistischen Kirche (1431–1620) und in der Brüderunität ((1457–1620). Die EKBB entstand in ihrer heutigen Gestalt im Jahr 1918 durch den Zusammenschluss der bis dahin selbständigen evangelischen Kirchen Augsburger und Helvetischen Bekenntnisses. Deren Existenz wurde nach dem Ende der harten Gegenreformation, die von 1620 bis zum Erlass des Toleranzpatens durch Kaiser Joself II. im Jahr 1781 dauerte, erlaubt. Die strengen Beschränkungen mussten die Evangelischen freilich auch danach beachten, bis zum Erlass des Protestantenpatentes im Jahr 1861.
In der Zeit ihrer Entstehung hatte die EKBB 250 000 Mitglieder, im Jahre 1938 waren es dann schon 325 000 Mitglieder. Heute ist die Kirche in 14 Seniorate aufgeteilt mit einer Gesamtzahl von 250 Gemeinden und ca. 80 000 Gemeindegliedern. Die Kirche wird vom sechsköpfigen Synodalrat geleitet, der auf sechs Jahre gewählt wird. Repräsentiert wird die Kirche vom Synodalsenior und vom Synodalkurator.
Eine Stimme zur Unterstützung der Gedemütigten erklang im Zentrum Prags
An die lange Tradition der Tage für Kuba, die die Kommission für Menschenrechte des Synodalrates der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) veranstaltete, knüpfte in diesem Jahr eine neue Aktion an mit dem Titel „Wir geben den Gedemütigten eine Stimme“.
Außer nach Lateinamerika richtete sich der Blick auf weitere Weltregionen, wo Menschen wegen ihres Glaubens und ihrer Überzeugung unterdrückt werden.
Am Donnerstag, den 21. März 2019, versammelten sich am späten Nachmittag am Újezd, am Mahnmal für die Opfer des Kommunismus, Dutzende von Menschen, um mit ihrer Stimme, ihrem Gebet und in stillem Gedenken die sog. Gewissensgefangenen zu unterstützen. Dieser Begriff wird allgemein für Männer und Frauen gebraucht, deren Gewissen ihnen nicht erlaubt zu schweigen und sich der staatlichen Politik zu unterwerfen, die laut ihre Meinung sagen und ihren Glauben bekennen, und dafür, in der Regel mit ihren Familien, hart verfolgt werden.
Zu Beginn sprachen der emeritierte Synodalsenior der EKBB Joel Ruml und der ehemalige Kulturminister Daniel Hermann. Musikalisch wurden die einführenden Worte vom Posaunenchor Consonare umrahmt. In seiner kurzen Ansprache brachte Daniel Hermann in Erinnerung: Vor 30 Jahren hat die tschechische Gesellschaft die Freiheit erlangt. Die Freiheit gewährt einen bestimmten Raum und es liegt nur an uns, wie wir ihn ausfüllen. Ob wir uns miteinander verbinden und diesen Raum mit positiven, konstruktiven und guten Beziehungen und Taten ausfüllen. Es gibt immer noch viele Orte auf der Welt, wo es keine Freiheit gibt. Denken wir an Nordkorea, China oder Venezuela.“
Vom Újezd machten sich die Versammelten auf den Weg über die Karlsbrücke in Richtung Václav-Havel Bibliothek, mit weißen Luftballons und Schirmen, in Erinnerung an die „Damen in Weiß“ auf Kuba. An den einzelnen Stationen des Marsches erinnerten sich die Teilnehmenden an zehn Gewissensgefangene aus der ganzen Welt. Der zehnte Name, obwohl vorbereitet, erklang nicht unter den anderen Namen, denn der Gefangene aus Azerbajdschan war gerade in diesen Tagen aus dem Gefängnis entlassen worden. „Auch dank solcher Aktionen wie dieser“ sagte Joel Ruml. „Es hat Sinn, das sehen wir jetzt alle“ fügte er hinzu.
„Das Ziel des Marsches war die Václav Havel Bibliothek, wo um 19 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema Menschenrechte in der Welt begann. Wir haben uns sehr über die tollen Podiumsteilnehmer gefreut. Auch der Außenminister Tomáš Petříček hatte sein Interesse an der Aktion zum Ausdruck gebracht, aber wegen seines überfüllten Terminkalenders musste er seine Teilnahme dann doch absagen. Sein Interesse betrachten wir als ein gutes Signal, dass das Thema der Einhaltung der Menschenrechte wieder ein untrennbarer Bestandteil unserer außenpolitischen Beziehungen wird, was sehr positiv ist,“ bemerkte die Leiterin der Kommission für Menschenrechte Jitka Klubalová.
Die Diskussion war sehr anregend. Ondřej Klimes vom Orientalischen Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik berichtete über die aktuelle Situation in China. Der Filmemacher aus Venezuela Valerio Mendoza arbeitet mit der Organisation „Mensch in Not“ zusammen, regelmäßig bildet er Journalisten aus und während des Abends vermittelte er einen Einblick in das aktuelle Geschehen in Venezuela im weiteren Kontext des lateinamerikanischen Kontinents. Der Reporter der Zeitung „Hospodářské noviny“ (Wirtschaftszeitung) Ondřej Soukup erweitere noch die Skala der problematischen Regionen um Russland. Für den Synodalrat widmet sich der Problematik der Menschenrechte der Stellvertreter des Synodalseniors Pavel Pokorný, der auch die Einladung zur Diskussion annahm. Die Debatte wurde von der Redakteurin des Tschechischen Rundfunks Plus Lucie Vopálenská moderiert.
Jiří Hofman
Strategieplan der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder
Allgemeine Informationen über die Tschechische Republik:
Einwohner: 10 580 000
Katholiken: ca. 20 %
Andere Kirchen, vor allem protestantische: ca. 2 %
Andere Religionen insgesamt: bis zu 2 %
(Bei der letzten Volkszählung (Zensus) wurde auch nach dem religiösen Bekenntnis gefragt. Die Beantwortung dieser Frage war aber freiwillig und fast die Hälfte der Bevölkerung beantwortete die Frage nicht, weshalb die Zahlen nur geschätzt sind.)
Allgemeine Informationen über die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB):
Anzahl der Gemeinden: 250
Anzahl der Mitglieder nach den Verzeichnissen der Gemeinden: 71 000
Anzahl der Mitglieder, die mindestens einmal im Jahr einen finanziellen Beitrag leisten: 21 000–25 000
Durchschnittliche Teilnehmerzahl im sonntäglichen Gottesdienst (gesamtkirchlich): 10 100
Durchschnittliche Teilnehmerzahl im sonntäglichen Gottesdienst (pro Gemeinde): 40
Strategischer Plan bis zum Jahr 2030
Dieser Plan wurde nach dreijähriger Arbeit auf der Synode der EKBB im Mai 2019 angenommen. Er ist das erste Dokument dieser Art, das in der EKBB erstellt wurde.
Die hauptsächlichen Anstöße zu seiner Vorbereitung, Diskussion und Annahme waren:
1. Die Unzufriedenheit eines Teils der Kirche mit einigen Aspekten im Leben der EKBB
Viele Gemeinden der EKBB sind lebendig und offen, sind aktiv im Bereich Gottesdienst, Katechese, Treffen kleinerer Gruppen, Seelsorge, ehrenamtlicher und institutioneller Diakonie, Mission …
Der Zuwachs an neuen Mitgliedern in diesen (v. a. städtischen) Gemeinden ist jedoch geringer als der Mitgliederverlust in anderen (meist ländlichen) Gemeinden.
Dabei nimmt in der heutigen Zeit das Interesse an verschiedensten (oft alternativen, esoterischen, neo-heidnischen oder eklektischen) Formen der Spiritualität in der tschechischen Gesellschaft stark zu. Auf diese spirituelle Sehnsucht im Umkreis unserer Gemeinden gelingt es uns mit unserer christlichen Botschaft jedoch nicht so zu antworten, wie wir uns das wünschen.
2. Die finanzielle Trennung vom Staat
Die EKBB befindet sich derzeit in einer außergewöhnlichen wirtschaftlichen Situation. Bis 2012 bestand etwa die Hälfte ihres Budgets aus einem staatlichen Beitrag. Das war ein Überbleibsel der Regelungen aus kommunistischer Zeit. Schon um 1950 herum hatte der totalitäre Staat den größten Teil des kirchlichen, insbesondere des katholischen Eigentums beschlagnahmt. „Im Gegenzug“ verpflichteten sich die Kommunisten, einen Teil der Ausgaben der Kirche zu decken, in erster Linie die Gehälter der Geistlichen; natürlich waren diese Gehälter sehr niedrig.
Im Jahr 2013 trat ein neues Gesetz über die Beziehungen zwischen Staat und Kirchen in Kraft. Der Staat verpflichtete sich, den Teil des einst von den Kommunisten gestohlenen Kirchenbesitzes, der noch zurückgegeben werden konnte, so bald wie möglich zurückzugeben. Das betraf in erster Linie die römisch-katholische Kirche. Für das Eigentum, das nicht mehr zurückgegeben werden kann, zahlt der Staat im Zeitraum 2013 bis 2042 schrittweise in 30 Raten eine Entschädigung an die Kirchen. Die römisch-katholische Kirche verzichtete zugunsten anderer, kleiner Kirchen auf einen Teil dieses Geldes. Nur aus diesem Grund fand die Lösung (also die Restitution und gleichzeitig die finanzielle Trennung von Staat und Kirchen) ökumenische und politische Unterstützung. Der Staat bezahlt also den gestohlenen Kirchenbesitz, verringert allerdings gleichzeitig den bisherigen Zuschuss an die Kirchen, insbesondere zu den Gehältern der Geistlichen.
Somit verfügt die EKBB vorübergehend über mehr Ressourcen. Es ist jedoch klar, dass sie ab 2030 weniger Geld vom Staat erhalten wird und ab 2042 gar nichts mehr. Und das macht es sehr schwierig, das Dasein der Kirche und den kirchlichen Dienst langfristig zu planen: Soll man schneller zur Eigenfinanzierung gelangen und damit zwar ein größeres Investitionspolster für die Zukunft mit vollständiger Eigenfinanzierung gewinnen, gleichzeitig aber die Unabhängigkeit kleinerer Gemeinden und ihrer Pfarrstellen verlieren? Oder soll man langsamer zur Selbstfinanzierung übergehen, um kleineren Gemeinden die Möglichkeit zu geben, ihre Pfarrstellen länger zu erhalten, aber in Zukunft nur noch mit den laufenden Beiträgen der aktiven Mitglieder wirtschaften?
Die zentralen Themen des Strategieplans
In diesen Zeiten des Umbruchs legt der Strategieplan sieben Hauptthemen fest. Jedem Thema ordnet er Teilziele und Aufgaben zu:
- Die lebendige Gemeinde
- Religiosität als Pflege des Glaubens
- Klarheit und missionarische Offenheit
- Schlüsselpersonen
- Der Übergang zur Eigenfinanzierung
- Diakonie, Kapläne und Evangelische Akademie
- Effektive Leitung und Wirtschaftsführung
zu 1) Die lebendige Gemeinde
Nach protestantischer Auffassung hat die Gemeinde vor Ort für den christlichen Glauben entscheidende Bedeutung. Deren grundlegende Aufgaben und Funktionen sind folgende (frei nach Apostelgeschichte 2,41–47): Gottesdienste feiern und Katechese, eine Glaubensgemeinschaft bilden, diakonisch dienen und Zeugnis ablegen. Im ersten Punkt des Planes werden Maßnahmen vorgeschlagen, um das Leben und den Dienst in unseren 250 Gemeinden zu unterstützen. Hier werden Beispiele und Erfahrungen für gut Gelingendes aus der ganzen Kirche zusammengetragen. Außerdem geht es um die Stärkung der Kompetenzen von Pfarrern und Kirchvorstehern für den Gemeindeaufbau.
zu 4) Schlüsselpersonen
Dieser Punkt ist den Menschen gewidmet, die in den Gemeinden am wichtigsten sind: Presbyter und Kuratoren, Hilfsprediger und Pfarrer. Jedes Seniorat und auch die ganze Kirche sollte mehr und dauerhaft Hilfsprediger (theologische Laien) unterstützen, deren Zahl deutlich steigt.
Für die Pfarrer planen wir:
- mit der aktiven evangelischen Jugend mehr über die Schönheit und Bedeutung der Arbeit eines Pfarrers zu kommunizieren, um die Zahl der Theologiestudenten zu erhöhen,
- mit der Theologischen Fakultät der Karlsuniversität über eine mögliche inhaltliche Änderung des Theologiestudiums zu verhandeln, um den Bedürfnissen und der Praxis der Kirche näherzukommen,
- die Pfarrgehälter zu ordnen und auf das Niveau des Durchschnittsgehalts in der Tschechischen Republik anzuheben.
zu 5, 6) Die Ebenen der Seniorate und Kirchen
In Punkt 5 des Strategieplans werden die grundlegenden Herausforderungen für den Übergang zur Eigenfinanzierung umrissen: Information der Leiter der Gemeinden über verschiedene Finanzierungsquellen und Festlegung angemessener Regeln für unterschiedliche Konstellationen von pastoralen Arbeitsverhältnissen. In Punkt 6 widmen wir uns der weiteren Zusammenarbeit mit den 34 diakonischen Zentren, sieben evangelischen Schulen und mit Institutionen, in die wir Kapläne senden (Gefängnisse, Krankenhäuser, Armee).
Was erwarten wir vom Strategieplan?
Der Strategieplan ist ein neues Instrument für die Leitung und Verwaltung der EKBB. Von selbst bietet er freilich keine Lösung für alle gegenwärtigen Sorgen unserer Kirche, aber er kann eine gute Hilfe für die Arbeit der Kirchenleitung und für die Unterstützung des Lebens in den Gemeinden sein. Ob er sich bewährt und in Zukunft weiterhin verwendet wird, werden wir erst in einigen Jahren beurteilen können.
Roman Mazur, Vorsitzender der Strategischen Kommission
Flaggen am Hus-Haus erinnerten an den internationalen Tag der Roma
Am Montag, den achten April, kleidete sich das Gebäude der EKBB (Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder) im Zentrum von Prag symbolisch für den Feiertag, indem es sich mit zwei Roma-Flaggen schmückte, die auf den internationalen Tag der Roma hinweisen sollten. Die Roma-Flaggen blieben den ganzen Tag im Stadtzentrum hängen. Bei ihrer symbolischen Darstellung betete der Pfarrer für humanitäre Hilfe, Minderheiten und sozial Benachteiligte, Mikuláš Vymětal, das Vaterunser auf Romanes.
Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder widmet sich schon lange den Themen der Minderheiten und Unterdrückten und versucht auf die ungesunden Vorurteile in der Gesellschaft hinzuweisen. Deshalb wurden zu den Feierlichkeiten des internationalen Tages der Roma neben dem Hissen der Flaggen auch weniger traditionelle Formen des gemeinsamen Feierns gewählt: auf der offiziellen Facebookseite der EKBB wurden die Follower dazu aufgefordert, mit einen positiven Kommetar und Unterstützung angemessener Posts dabei zu helfen, den Umgangston in einer konkreten Internetdiskussion zu verbessern. In dieser Internetdiskussion ging es um einen Beitrag des tschechischen Fernsehens über ein Romafestival am Wochenende. Die Diskussion enthielt viele angreifende Beiträge, Fremdenfeindlichkeit und bösartige Kommentare. Wir danken allen, die mit uns gemeinsam geholfen haben, durch ihre respektvollen Kommentare Unterstützung für nichtfeindliche Beiträge zu kultivieren. Es gab dadurch eine anständige und nicht-aggressive Stimme in der Diskussion- gegenseitiger Respekt und Verständnis sind die beste Art zu feiern!
Jiří Hofman
Die Schulen der Evangelischen Akademie
Vor einem Jahr genehmigte das tschechische Schulministerium die Gründung einer neuen evangelischen Grundschule in Brünn: Filipka. Der Direktorin mit ihrem Team an Mitarbeitenden gelang es, alle die nicht so leicht zu erfüllenden staatlichen Bedingungen – Mietverträge in passenden Räumen auszuhandeln und sie für die erste Stufe der Grundschule umzubauen – zu erfüllen. Zugleich wurde zur Unterstützung der Filipka-Schule eine erfolgreiche Öffentlichkeitskampagne ins Leben gerufen.
Nach den letzten Informationen direkt aus Brünn hat die zukünftige Schule schon jetzt interessierte Eltern, die ihre Kinder dort einschulen lassen wollen sowie ältere Kinder, die ab dem 1. September auf die neue Schule gehen könnten. Es gelingt auch mit Lehrern zu sprechen, die Lust haben, eine alternative kirchliche Schule mitaufzubauen. Das alles wäre nicht möglich gewesen ohne den großen Einsatz des Ehepaars Konvalinka, ihren Freunden aus der Gemeinde Husovice und weiteren Freiwilligen, die beim Verhandeln mit den örtlichen Behörden helfen oder bei praktischen Bauarbeiten anpacken. Es halfen auch die Leiter der anderen evangelischen Schulen. Der Synodalrat der EKBB entschied, die neue Schule zu unterstützen und genehmigte einen nicht geringen Betrag aus dem Etat für Diakonie- und Entwicklungsprojekte für die Grundausstattung der Schule. Umbauten von Räumen, Lohnkosten der Rektorin in der Vorbereitungszeit und Einkauf des benötigten Inventars – ohne die finanzielle Unterstützung könnte die Schule die Anmeldung der Kinder nicht vorbereiten. Wir sind sehr dankbar, dass die Vorbereitungen für die neue – die siebte Schule unter dem Dach der Evangelischen Akademie – so gut nach Plan verlaufen!
Der Fond für die Unterstützung kirchlicher Schulen hilft wo er kann
Dank der großzügigen Spenden der Gemeindemitglieder konnte der Synodalrat auch den Erlös der Spenden, zusammengefasst im Fond für die Unterstützung kirchlicher Schule, verteilen. Für die Schulen bedeuten diese Gelder eine Unterstützung ihrer Projekte und Programme, die aus den laufenden Mitteln, die über die normierten staatlichen Beiträge finanziert werden, nicht bezahlt werden können. Wir sind froh, dass auf diese Weise auch in Zukunft bewährte, sinnvolle Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler bezuschusst werden.
Und was konnte konkret dank dieses Fonds umgesetzt werden?
Die Gemeindemitglieder können sich auf weitere musikalische Auftritte der Studenten des Olmützer Konservatoriums der Evang. Akademie freuen, die gerade geplant werden und auch in der Olmützer Region aufgeführt werden sollen. Außerdem sollen im Advent ausgewählte Instrumentalwerke und Gesangstücke auch bei Konzerten in Brünn und Prag die Zuhörenden erfreuen.
Die Fachschule für Berufe im Sozialwesen und im Gesundheitswesen in Nachod kann dank des Fonds ihre Labore für die Fächer Physik, Chemie und Biologie neu ausstatten. Die Kinder der Brüderschule können schöne Tage im Johann-Amos-Comenius-Camp in Běleč nad Orlicí verbringen. Und die Prager und Brünner Evangelische Akademie erhielten Mittel für Studienfahrten und Praxisaufenthalte ihrer Schüler und Lehrer in Deutschland; in Dresden, Potsdam und Stuttgart, in Partnereinrichtungen der Diakonie in Deutschland, werden sie kennen lernen, was es im Bereich der sozialen Dienste Neues gibt. Die langjährige Zusammenarbeit ermöglicht nicht nur die sprachlichen Fähigkeiten der Studenten zu verbessern, sondern kann sie auch zu kreativen Formen der Pflege motivieren.
Die Mittel, die aus diesen Geldern kommen, sind für die Rektoren und Lehrer, die diese nicht-staatlichen Schulen leiten, sehr ermutigend, in Zeiten, in denen solche Schulen missgünstigen und sogar diskriminierenden Einstellungen von Spitzenpolitikern gegenüberstehen.
Über die neue Brünner Schule Filipka haben wir mit ihrer Gründerin Ruth Konvalikova, die auch zur ersten Rektorin ernannt wurde, gesprochen.
Um was für eine Schule handelt es sich?
Es geht um eine evangelische Grundschule in Brünn. Offiziell heißt sie „Schule mit Geschichte“, aber wir sagen meistens Filipka, denn die Schule ist in der Filipinska Straße in Brünn.
Was brachte Sie auf den Gedanken eine Schule zu gründen?
Ich bin Lehrerin am Gymnasium, mein Mann ist stellvertretende Schulleiter an einer Mittelschule, unter unseren nahen Familienangehörigen sind vier weitere Lehrer. Über Schulen – das wage ich zu sagen – wissen wir relativ viel. Wir sind auch Eltern dreier Kinder, also kennen wir auch die andere Seite. Je länger ich unterrichtete, desto mehr habe ich gemerkt, dass sich manche Dinge im Rahmen der existierenden Schulinstitutionen nur sehr schwer „verbessern“ lassen. Und schrittweise habe ich festgestellt, dass eine ähnliche Sicht der Dinge viele Kollegen und Schulexperten haben. Nach vielen mehr oder weniger vergeblichen Versuchen kam es uns effektiver vor, eine neue Schule zu gründen, als zu versuchen die alten umzukrempeln.
Was stört sie am tschechischen Schulsystem?
Das sind schwer zu verändernde Probleme, die im System liegen. Ich kann nur kurz und unvollständig auf manche eingehen: die tschechische Schule ist sehr rigide, nur sehr behäbig reagiert sie auf die turbulenten Zeiten, die die Bildung vor Herausforderungen stellt. Ein Lehrer, der neu und interessant unterrichten will, bekommt häufig den Widerstand aller Beteiligten (Kollegen, Eltern, Kinder) zu spüren. Die Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen geht sehr langsam – dabei ist sie so wichtig! Meine Vorwürfe gelten natürlich nicht für alle Schulen – es gibt selbstverständlich eine große Vielfalt an Lehrern und Schulen, die eine vorbildliche Praxis haben.
Und wie sind Sie auf den Gedanken einer kirchlichen Schule gekommen?
Als Tschechischlehrerin soll ich die Textkenntnis der Kinder beurteilen, wenn sie aus der Grundschule auf das Gymnasium kommen – manchmal ist diese so niedrig, dass man erschrickt, besonders wenn man bedenkt, dass wir in Zeiten leben, in denen es unglaublich wichtig ist, Informationen bewerten zu können (Stichwort: fake news). Dagegen habe ich den sprachlichen Entwicklungsstand der Kinder beobachtet, die aus einem kirchlichen Hintergrund kommen. Und da ist es mir irgendwann aufgefallen: In unserer Kirche hat das Wort eine große Bedeutung. Es gibt auf einem hohen Niveau ausgearbeitete Katechese und Materialien für die Sonntagsschule, die Kirche hat eine reiche Erfahrung in der Arbeit mit Kindern. Außerdem hat sie eine riesige Bildungstradition, ihr Beitrag für die frühere Gesellschaft bestand in der Ausbildung. Die Brüderunität hat auf diesem Feld Wichtiges geleistet, das bedeutend die Zukunft der gesamten Nation beeinflusst hat. Trotzdem hat unsere Kirche nur eine Grundschule (außer den speziellen diakonischen Schulen) und 5 weiterführende Schulen. Ich habe die Entstehung verschiedener interessanter Schulinitiativen beobachtet und nach einigen Jahren habe ich meinen Freunden und hauptsächlich Menschen aus der Gemeinde ringsum erzählt, dass es gut wäre, eine weitere evangelische Schule zu gründen. Es hat lange gedauert, bis sie Gefallen an diesem Gedanken fanden und sie begannen, mich darin zu ermutigen. In dem Moment, als sich auch mein Mann für die Idee hat begeistern lassen, war es entschieden: Wir probieren das.
Wie haben Sie davon erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, Geld aus dem kirchlichen Förderprogramm für Diakonie- und Entwicklungsprojekte (DaRP) zu bekommen?
Ich habe davon von einem Mitglied unseres Ältestenrats erfahren, der unsere Gemeinde im Konvent vertritt. Er machte mich auf eine Schulung aufmerksam, die damals im Jahr 2017 im Blahoslav-Haus in Brünn unter der Leitung des Synodalkurators Vladimir Zikmund stattfand.
Mit welchen Schwierigkeiten haben Sie zu tun?
Erstens haben wir innerhalb der Gemeinde mit einem geringen Interesse an unserem Schulprojekt Filipka zu kämpfen, es ist zum Beispiel schwierig, Mitarbeiter zu finden. Zweitens sehen wir das Misstrauen und eine gewisse Skepsis, mit denen das Projekt beäugt wird. Aber die Arbeit geht Schritt für Schritt weiter, beide Schwierigkeiten ändern sich langsam zum Besseren.
Wie sieht das in der Praxis aus?
Im Juli letzten Jahres haben wir den Synodalrat um seine Zustimmung gebeten, dass wir unsere Schule unter dem Dach der Evangelischen Akademie gründen können. Im September 2017 haben wir Unterstützung aus dem Programm für Diakonie- und Entwicklungsprojekte (DaRP) beantragt, die uns bewilligt wurde. Ende September haben wir dann im Namen der Kirche unseren Antrag, ins offizielle Schulregister aufgenommen zu werden, beim Ministerium gestellt.
Der größte Brocken schien die Aufgabe für die neue Schule geeignete Räume zu finden. Dann tat sich die Möglichkeit auf, vom Rathaus in Židenice die Hälfte eines alten Schulhauses zu mieten, aus dem eine Berufsschule ausgezogen war. Als wir dann dem Ministerium eine passende Adresse vorlegen konnten, mussten wir eine Hygienebestätigung einholen, dass die Räumlichkeiten allen Anforderungen entsprechen. Das hieß, dass wir die Sanitäreinrichtungen erneuern mussten, die Renovierung haben wir mit Kirchenkrediten beglichen. Alles wurde bis zum erforderlichen Termin fertig, und zum 1.9.2018 trat in voller Gültigkeit die Einschreibung der Schule in das Schulregister im Ministerium für Schule, Jugend und Sport in Kraft, das bedeutet, dass die Schule schon vollgültig existiert.
Wie wird das weitere Verfahren? Wie begrüßen Sie die ersten Schülerinnen und Schüler?
Nun haben wir also, lapidar gesprochen, ein Gebäude, eine Registernummer und Anspruch auf staatliche Unterstützung. Die Öffnung für die Kinder planen wir für den 1.9.2019. Ich werde ab dem 1.9. für die Filipka eine halbe Stelle haben, dank der Unterstützung aus dem DaRP-Fördergeld: zusammen mit tatkräftiger Unterstützung meines Mannes werde ich mich um das Schulgebäude kümmern, um die Ausstattung. Außerdem halte ich den Kontakt mit der Leitung der Evangelischen Akademie, mit dem Rathaus und weiteren Akteuren. Vor allem aber will ich das pädagogische Team zusammenbringen.
Das Projekt bleibt finanziell anspruchsvoll. Wie wollen Sie das schultern?
Geld werden wir noch viel brauchen, weil die Räumlichkeiten der Schule innen auch weiter renoviert werden müssen. Außerdem hat eine Schule einen großen Ausstattungsstandard; es fehlen uns immer noch die Einrichtung des Speisesaals, der Garderobe, verschiedene Schulmöbel, Musikinstrumente, Sportgeräte, Kopierer – um nur manches zu nennen. Wir wollen auch den Schulhof wiederbeleben und dort einen Spielplatz einrichten. Darum haben wir dieses Jahr einen weiteren Antrag um Unterstützung beim Förderprogramm DaRP eingereicht, und wir versuchen woanders auch weitere Anträge zu stellen.
Wir haben einen Stiftungsfond angelegt, der öffentliche Spenden erlaubt. Der Vorteil unseres Projekts ist es, dass mit Schulbeginn die finanziellen Ausgaben geringer werden – die Registrierung im Schulregister bedeutet, dass wir staatliche Gelder bekommen, die wir mit dem Eintritt der Schüler in die Schule bekommen. Die Gelder decken den Großteil der Ausgaben ab, weiteres fehlendes Geld werden wir von den Eltern durch ein kleines Schulgeld einsammeln.
Und welches ist ihr höchstes Ziel?
Wir haben vor, dafür zu kämpfen, dass wir mit Gottes Hilfe ein gutes Werk aufbauen werden, das auch unserer Kirche Ehre macht.
Jana Plíšková
Grenzen – Gesichter – Geschwister. Mehr als eine Ausstellung
Als die EKBB im Jahr 2018 den hundertsten Jahrestag ihrer Gründung in der heutigen Form feierte, wurde auch andernorts an die neuen Ordnungen nach dem Ende des 1. Weltkriegs erinnert. In Mittel- und Südosteuropa veränderten sich Staatsgrenzen und auch die evangelischen Kirchen in diesen Ländern gliederten sich neu. Die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien hat dies als Impuls genommen, ein längerfristiges Projekt unter dem Namen Grenzen – Gesichter – Geschwister zu starten, das im November 2018 in Bukarest eröffnet wurde.
Mittelpunkt des Projekts ist eine Ausstellung, die anhand von ausgewählten Persönlichkeiten die verschiedenen evangelischen Kirchen in Mittel- und Südosteuropa vorstellt. Die EKBB ist durch Pfarrer Alfred Kocáb vertreten, einen aus Wien stammenden ökumenisch offenen Theologen, der als politischer Dissident seinen Pfarrberuf nicht mehr ausüben durfte und erst nach der Wende als Pfarrer in Prag wirkte. Er verstarb Anfang 2018.
Neben den Gesichtern in der Ausstellung sollen bei den Begleitveranstaltungen Begegnungen von Menschen der beteiligten Kirchen stattfinden. Die Kirche der Siebenbürger Sachsen hat dies in der Auftaktveranstaltung bereits vorgemacht: aus sechs Länder und noch mehr Kirchen kamen die Teilnehmer nach Bukarest, um die Evang. Kirche A.B. in Rumänien direkt, als Gesichter und Geschwister, kennenzulernen.
Seitdem wird die Ausstellung nun an verschiedenen Orten der Region gezeigt und lenkt dabei die Aufmerksamkeit auch auf Gegenden, die selten im Rampenlicht einer größeren Öffentlichkeit stehen. Zuletzt war die Ausstellung mit einer Reihe von Veranstaltung im österreichisch-slowenisch-ungarischen Grenzgebiet unterwegs. Im November 2019 soll Grenzen – Gesichter – Geschwister nach Tschechien kommen. Außer der EKBB, die die Ausstellung in der Prager Salvátorkirche, der Wirkungsstätte von Alfred Kocáb, zeigen möchte, wird auch die Schlesische Evangelische Kirche A.B. am Projekt teilnehmen und die Ausstellung nach Český Těšín bringen.
Oliver Engelhardt
Wege zu Verständigung und Versöhnung. Ehepaar Chamrád erhält den „Brückenbauer- Preis“
Für die Vertiefung der deutsch-tschechischen Verständigung wurde Anfang April die prestigeträchtige Auszeichnung Brückenbauer/Stavitel mostů im bayrischen Schönsee an die Eheleute Cordula Winzer-Chamrád und Petr Chamrád verliehen.
Die Chamráds lernten sich in Prag kennen, wo Cordula zu einem einjährigen Studienaufenthalt war. 1993 heirateten sie und ihre beiden Kinder wuchsen zweisprachig auf und lebten im südböhmischen Písek. Im Jahr 2001 siedelten sie ins bayrische Selb über und schließlich nach Hohenberg, wo Cordula als Pfarrerin arbeitete. Petr half in der evangelischen Gemeinde in Cheb und kümmerte sich um die Kurgäste in dem westtschechischen Kurort im Rahmen eines Projekts der tschechisch-deutschen Zusammenarbeit. Jetzt leben die Eheleute in Regensburg und widmen sich weiterhin ihrer Lebensaufgabe, der tschechisch-deutschen Verständigung und Aussöhnung.
Sie organisieren Ortspartnerschaften, zweisprachige Gottesdienste, tschechisch-deutsche Kirchentage für Kinder in Marktredwitz (Reportage im Bulletin 2/2019) oder Programme zum Thema tschechisch-deutsche Geschichte. Vor zwei Jahren gab Petr Chamrád zusammen mit dem Musiker Jörg Wöltche ein interaktives Liederbuch mit Weihnachtsliedern in beiden Sprachen heraus. (Über dieses Liederbuch haben wir im Bulletin 9/2017 berichtet.) Die Nachfrage ist phänomenal- bisher wurden 15 000 in vierter Auflage gedruckt.
Die feierliche Verleihung des Brückenbauerpreises fand in den Räumen des Vereins „Bavaria Bohemia“ in Schönsee statt. Auf diesem Treffen sprachen die Bürgermeisterin der Stadt Schönsee, der Oberbürgermeister von Pilsen und weitere Redner. Jeder der Preisträger wurde mit einem kurzen Film vorgestellt, den die Studierenden der westböhmischen Universität in Pilsen gedreht hatten. Der Brückenbauerpreis hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Veränderung des kulturellen und partnerschaftlichen Lebens in den tschechischen und bayrischen Grenzregionen anzuregen, zu einem Welchsel von einem „Leben nebeneinander her“ zu einem „gemeinschaftlichen Leben“ beizutragen und die gute Nachbarschaft zu fördern.
An der Preisverleihung nahmen auch der Synodalsenior der EKBB, Daniel Ženatý und der stellvertretende Senior des westböhmischen Seniorats Jan Satke teil, welche dem Ehepaar Chamrád im Namen der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder für ihren lebenslangen Einsatz dankten.
Daniela Ženatá
Förderung der Auszubildenden der Gesundheitsschule in Náchod und neue Unterrichtsräume
Die Schwesternausbildung hat Zukunft
Ende Februar besuchten der Bürgermeister und Abgeordnete des tschechischen Parlaments, Jan Birke und die Leiterin des regionalen Krankenhauses Náchod, Ivana Urešová, die Berufsschule für Soziales und Gesundheit der Evangelischen Akademie in Náchod. Beide kamen, um ihr Interesse an den Absolventen unserer Schule zu bekunden, vornehmlich auch an den Krankenpflegeschülerinnen.
Das Krankenhaus in Náchod, so die Direktorin, hat momentan nicht genug Pflegefachkräfte. Der Bürgermeister erklärte den Schülerinnen, dass gerade ein modernes Krankenhaus für 1,2 Mrd. Kč gebaut werde, in welchem man seine berufliche Zukunft gestalten könne. Er versuchte, die Schülerinnen dazu zu motivieren, nach der Ausbildung im Krankenhaus in Náchod einzusteigen. Er informierte über die Möglichkeiten, nach der Ausbildung ein Stipendium zu erhalten und über die Bemühungen der Stadt, die Schülerpraktika im Krankenhaus in einem gewissen Maß finanziell zu entlohnen. Der Bürgermeister versprach der Evangelischen Akademie Investitionen in das Schulgebäude, da in Zukunft eine steigende Auszubildendenzahl im Gesundheitsbereich erwartet wird.
Ein neuer Fachunterrichtsraum für Biologie, Physik und Chemie
Die Berufsschule für Gesundheit und Soziales der Evangelischen Akademie in Náchod hat einen neuen Fachraum für den Biologie-, Physik- und Chemieunterricht. Dieser neu ausgestatte Unterrichtsraum wurde am 27. März, dem „Tag des Lehrers“ feierlich eröffnet. Schüler und Lehrer erhielten außerdem ein neues Labor, das durch eine gesamtkirchliche Kollekte finanziert wurde.
Als erstes nutzten die Schwesternschülerinnen des ersten Jahres das Labor. „Ich glaube, dass der Unterrichtsraum die Qualität des Unterrichts verbessert und dass die Lehrenden die neuen Möglichkeiten nutzen werden, die uns die Räumlichkeiten bieten,“ erläuterte der Schulleiter David Hanuš bei der feierlichen Eröffnung. Bei dieser Gelegenheit dankten Vertreter der Schule den Gemeinden der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder, welche für den Fond für die Unterstützung kirchlicher Bildungseinrichtungen gesammelt haben. Durch diese Sammlung wurde der Bau des Unterrichtsraums in Teilen finanziert.
Daniela Ženatá
Die Partnerschaftskonferenz der Presbyterianischen Kirche der USA und der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder 2019
In der ersten Aprilwoche trafen sich Mitglieder der Presbyterianischen Kirche der USA (PCUSA) und der EKBB am Theologischen Seminar von Columbia zu einer Konferenz zum Thema „Gemeinsam hoffen“, der vierten Konferenz dieser Art. Von der EKBB nahmen Vertreter von Gemeinden, der Theologischen Fakultät, der Diakonie und der Abteilung für Ökumene und internationale Beziehungen teil. Uns schlossen sich zudem Gäste der Kirche von Schottland und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Amerika (ELCA) an, speziell von unseren Partnern des Kirchenkreises La Crosse.
Wir wurden begeistert willkommen geheißen, extravagant untergebracht, reichlich verpflegt und noch mehr von Betty, Mark I, Mark II und all jenen, die ihnen zur Seite standen. Wir erlebten Liebe an Freund und Fremdem, sowohl in der Gemeinde von Athens, die die meisten von uns am Wochenende vor der Konferenz beherbergte, als auch am Seminar von Columbia in Decatur. Unser Thema „Gemeinsam hoffen“ erinnerte uns daran, dass wir nicht bloß unsere persönlichen Hoffnungen zusammenbrachten, sondern vergegenwärtigte uns die Hoffnung, die durch das Zusammenkommen erzeugt wird, durch die Begegnung, das Zusammensein, das Teilen, durch das Sehen mit den Augen des Anderen.
Viele von uns kannten einander schon oder hatten E-Mails ausgetauscht oder zumindest voneinander gehört. Für manche von uns war der Besuch ein bisschen wie Nachhausekommen. Für uns alle war der Platz an einem üppigen Tisch willkommen und wunderbar. Ob wir nun aus den USA, aus Schottland oder der Tschechischen Republik kamen, wir waren eins. Wir erinnerten uns an gemeinsame Vergangenheiten, planten gemeinsame Zukünfte, tauschten Gegenwärtiges aus. Wir teilten Zweifel und Sorgen, feierten Erwartungen und Hoffnungen, erfuhren manches übereinander, lernten einander kennen – und wuchsen infolgedessen in Glauben und in Liebe und in Hoffnung. Unser aller Frage ist nun, was wir mit dem Erlebten anfangen, wie wir es kommunizieren, wie wir es verbreiten.
Wir dachten auch an Orte und Situationen, wo Hoffnung weniger gewiss ist, weil das Willkommen weniger sichtbar ist. Im Martin-Luther-King-Zentrum erinnerten wir uns an die Kämpfe für Rassengleichheit und Bürgerrechte in den Südstaaten; wir riefen uns jene ins Gedächtnis, die anderen sagten, sie sollten ihren Platz kennen, und ihr Platz sei nicht an ihrem Tisch. Wir sprachen davon, wie leicht es für Länder und Völker sei zu denken, sie hätten nichts zu teilen, keine Verpflichtung, sich zu kümmern, keine Notwendigkeit des Mitgefühls, keinen Wunsch, willkommen zu heißen. Und solche Erinnerungen legten die Notwendigkeit von Hoffnung und das Fehlen von Hoffnung bloß in einer Welt, die ihren Glauben mehr und mehr in Schranken und Grenzen legt.
Einmal sprachen wir darüber, wer in unserer Versammlung zum Tisch geladen war, wer nicht da war und wer noch hätte dabei sein können. Wir sprachen als Menschen, denen der Tisch gehörte, die entscheiden konnten, wer daran Platz nehmen durfte. Vielleicht ist das ein gefährliches Gedankenspiel, eines, das jene in der reichen Welt, jene, deren Tisch reichlich gedeckt und manchmal sogar überladen ist, ohne Zweifel mit Leichtigkeit anstellen. Dennoch – wenn wir uns so etwas vorstellen, bringt das eine Verantwortung für die Ordnung der Welt mit sich, nicht notwendigerweise speziell bei diesem Treffen, aber in unserem Glaubensleben allgemein.
Im Jahr 2022 werden wir wieder zusammenkommen, irgendwo in der Tschechischen Republik, um unsere gemeinsame Reise fortzusetzen.
David Sinclair
DIE DIAKONIE DER EKBB
 Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Tel: (+ 420) 242 487 811 (812); Fax: (+420) 242 487 834
E-mail: info@diakonie.cz
Internet: www.diakonie.cz
Die Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) ist eine gemeinnützige christliche Organisation, die Hilfe und Unterstützung anbietet für ein würdiges und vollwertiges Leben, auch wenn es durch Alter, Krankheit, gesundheitliche Behinderungen, Isolation, schwierige soziale Situationen und andere Lebenskrisen beeinträchtigt ist. Die Dienste der Diakonie der EKBB erfolgen auf der Grundlage der Botschaft des Evangeliums von der Liebe Gottes und nach dem Vorbild des Dienstes Jesu Christi. In ihren Zentren und Spezial-Schulen bietet die Diakonie soziale, gesundheitliche, Bildungs- und Seelsorgedienste an. Unter den nicht-staatlichen Organisationen, die soziale Dienste anbieten, ist die Diakonie der EKBB die zweitgrösste Institution.
Schule auch im Regen
In Myanmar (früher Burma) half die Diakonie fünf Schulen aufzubauen, die von über 1000 Schülern besucht werden. Bildung ist für sie die Basis für alles. Sie kann sie aus der Armut befreien, in der ihre Eltern heute leben.
Da ist zum Beispiel das Mädchen Shwe Hla Sein (11 Jahre), die in die sechste Klasse der Grundschule in der Stadt Mrauk, im Staat Rakhaing, geht. Sie hat fünf Geschwister, drei von ihnen besuchen die gleiche Schule wie sie. Die Eltern unterstützen ihre Kinder in der Ausbildung, auch wenn sie das an die Grenzen ihrer finanziellen Möglichkeiten bringt. Die ganze Familie lebt nur von einer kleinen Landwirtschaft in einem Dorf.
Oft konnten die Kinder gar nicht zu Schule gehen. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil die Gebäude unbenutzbar waren. Die Schule war nur ein provisorischer Bau aus Bambus und in der Regenzeit (im tropischen Myanmar kann die Regenzeit von Mai bis Oktober gehen) hat es dort stark reingeregnet. Es fehlten auch entsprechende Toiletten und befestigte Zufahrtswege.
Mit der Hilfe der Diakonie wurden die Schulgebäude wieder in Stand gesetzt, das bedeutete vor allem, der Bau von Sanitäranlagen. Die Schule, die die kleine Shwe Hla Sein mit ihren Geschwistern besucht, wurde schließlich komplett neu gebaut. Es entstand ein neues solides Gebäude, in dem die Kinder das ganze Jahr über lernen können, egal bei welchem Wetter. Sie hat außer den neuen Schulräumen auch ein Trinkwasserbecken, das es früher auf dem Gelände nicht gab.
Die Eltern von Shwe Hla Sein haben auch ihren großen Dank bekundet, dass alle ihre schulpflichtigen Kinder von der Diakonie eine Schulausstattung bekommen haben (Uniform, Schuhe, Regenschirm, Hefte, Schreibmaterialien und weitere Hilfsmittel) und einen Kulturbeutel für die tägliche Hygiene (mit Seife, Nagelschere, Kamm, Handtuch, Zahnbürste, Zahnpasta).
An den Projekten in Myanmar beteiligte sich die Diakonie zusammen mit dem tschechischen Außenministerium und dem Lutherischen Weltbund.
Adam Šůra
Wir sind auf einer Wellenlänge. Mit Jan Kaloš darüber, was Freiwilligenarbeit in der Diakonie dem Menschen geben kann
Das ganze Leben war er im ökonomischen Sektor tätig und vor seiner Pensionierung stellte er sich die Frage, wie er die freie Zeit nutzen möchte. Er entschied sich dafür, anderen zu helfen. So hilft er schon seit sechs Jahren im Rahmen eines der Programme für Freiwillige unter dem Dach der Diakonie in Familien, und zwar Kindern bei der Schulvorbereitung. Und er ergänzt sich darin sehr gut mit seinen um einiges jüngeren Kollegen.
Wie haben Sie als Freiwilliger den Weg zur Diakonie gefunden?
Das ist ganz zufällig passiert. Ich wollte ehrenamtlich helfen und ich habe irgendwo gelesen, dass es eine Ausbildung für Freiwillige geben soll. Mehrere Tätigkeiten wurden dort erwähnt – darunter auch Nachhilfe für Schüler, was mich interessierte. Ich habe mich angemeldet, aber wegen meiner Rückenprobleme konnte ich nicht teilnehmen. Sie waren so nett zu mir und haben mich in den nächsten Kurs angemeldet. Den absolvierte ich und so kam ich zur Diakonie.
Wieso fanden Sie gerade Nachhilfe-Geben interessant?
Ich habe meinen Kindern früher mit dem Lernen geholfen, und einigen Kindern meiner Bekannten. Es machte mir Spaß, einem Kind zuzusehen, das über verschiedene Fähigkeiten verfügt, und Wege zu finden, wie man ihm den Lehrstoff so beibringen kann, dass es ihn versteht.
Macht es Ihnen nach sechs Jahren immer noch Spaß? Sie arbeiten ja mit Kindern, denen das Lernen manchmal schwer fällt. Kam es bei Ihnen nie zu einer Krise?
Zu einer Krise kam es nicht. Wahrscheinlich habe ich mit den Jahren schon eine gewisse Gelassenheit erlangt. Aber die jüngeren Kollegen aus dem Freiwilligenteam haben manchmal mit Frustration zu kämpfen. Meistens sind es Studenten, junge Menschen. Sie kommen mit riesiger Begeisterung an und manchmal sieht man, dass sie enttäuscht sind. Sie wollen schnell Ergebnisse ihrer Arbeit sehen, doch die lassen auf sich warten. Ich weiß, wie es in den Familien meiner Bekannten aussieht, deren Kinder sehr gute Ergebnisse zeigen. Ihre Eltern kümmern sich fast täglich um sie. Sie kontrollieren ihre Hausaufgaben, wiederholen den Lernstoff. Wir arbeiten mit Kindern, denen ihre Familie aus verschiedenen Gründen nicht helfen kann. Man merkt schnell, dass eineinhalb Stunden in der Woche, die wir zur Nachhilfe zu Verfügung haben, nicht ausreichen. Aber es geht doch nicht nur um ein Zeugnis mit lauter Einsen. Ich denke, dass es für ein Kind – und ich unterrichte jetzt schon das vierte – einen Wert hat, wenn sich jemand regelmäßig um es kümmert. In der Regel freuen sich die Kinder. Also finde ich meinen Freiwilligendienst befriedigend.
Was kann die Freiwilligenarbeit einem Menschen darüber hinaus geben?
Ich sehe zwei weitere Pluspunkte für mich. Ich habe mich mit anderen Freiwilligen angefreundet, prima Leute, die helfen wollen. Der zweite Bonus ist die Arbeit mit dem Lernstoff. Ich bin Ökonom, jahrelang habe ich mich detailliert mit Buchhaltung beschäftigt, vieles ist mir bekannt. Aber so manche Kenntnisse aus dem Lernstoff muss man doch auffrischen, erneut überdenken – Formeln, die Zerlegung geometrischer Körper, Physik, Fremdsprachen … Ich für meinen Teil finde das wertvoll, der Geist wird dadurch fit gehalten.
Erzählen Sie uns etwas über die Kinder, denen Sie Nachhilfe gegeben haben.
Es waren vier und jedes war anders. Ládík war mit seinen Kenntnissen irgendwo zwischen der ersten, zweiten und dritten Klasse. Die Nachhilfe konnte nicht bei ihm stattfinden, dazu war es dort zu laut. Wir trafen uns in der Nähe seiner Wohnung in einem Büro der Kinder- und Jugendhilfe. Für´s erste hatten wir einen leeren Raum zur Verfügung, dann nur noch einen freien Platz am Tisch und später nicht einmal das. Also lernten wir direkt in der Diakonie im Zentrum Prags, was für Láďa aber schwierig war. Das Pendeln ermüdete ihn ziemlich. Wir haben auch zwei Ausflüge zusammen unternommen und wir konnten uns, denke ich, ziemlich gut leiden. Bis heute denke ich manchmal an ihn. Mein weiterer Schüler war Ibrahim, ein Viertklässler – eine ganz andere Situation. Seine familiären Wurzeln hatte er irgendwo in einer der postsowjetischen Republiken, in einer muslimischen Familie. Sein Vater war irgendwo in Russland, Ibrahim lebte hier mit seiner Mutter und zwei jüngeren Schwestern. Die Familie funktionierte gut, Ibrahim war klug – aber ein Schlendrian und nicht einmal seine aufopferungsvolle Mutter wusste sich damit Rat. Wir trafen uns bei ihm in der Schule, was für den Nachhilfeunterricht wahrscheinlich die beste Möglichkeit ist. Wir haben uns viel mit der tschechischen Sprache auseinandergesetzt. Er sprach schön fließend, aber mit manchen sprachlichen Nuancen kam er nicht zurecht. Es war spannend, sie mit ihm zu erörtern. Wir spielten auch Schach zusammen, das konnte er sehr gut, und lernten Physik. Sein Faulenzen konnte ich wahrscheinlich nicht überwinden, aber Angst um ihn habe ich nicht, er wird in der Welt schon nicht verloren gehen. Und jetzt helfe ich einem Mädchen, das die achte Klasse wiederholt, vor allem deswegen, weil sie oft krank war. Sie ist sehr motiviert, in die neunte Klasse zu kommen. Wenn manchmal eine Stunde ausfällt, möchte sie sie schnell nachholen, so sehen wir uns manchmal zweimal die Woche. Wir machen zusammen Hausaufgaben, vor allem in Mathematik und Englisch. Es ist gar nicht einfach, besonders Mathematik in der achten Klasse ist ziemlich schwierig. Dem Kind fehlen leider die Grundlagen – sie versteht die Aufgabe, errechnet dann aber nicht wie viel acht mal neun ist. In Englisch ist es ähnlich – ihre Aussprache ist besser als die meine, aber die grundlegenden Vokabeln kennt sie nicht. Aber uns geht es nicht um Einsen und ich denke, sie wird dieses Jahr weiter kommen.
Sie sprachen von vier Kindern, eines haben Sie noch nicht erwähnt.
Es ging nämlich eher um einen jungen Mann. Er kam aus Afrika und nach der Mittelschule wollte er bei uns an einer Kunsthochschule studieren und wollte seine Kulturkenntnisse erweitern. Es ging hier wieder um einen komplett anderen Stil der Zusammenarbeit. Wir trafen uns im Café und plauderten beispielsweise über Impressionismus. Nach einiger Zeit bekam ich von ihm eine SMS, dass er die Prüfungen erfolgreich abgelegt hat.
Wie viel Zeit brauchen Sie für die ehrenamtliche Arbeit für die Diakonie?
In der Regel einmal die Woche 90 Minuten Nachhilfe und 90 Minuten Pendeln. Also um die drei Stunden pro Woche. Einmal im Jahr haben wir eine Art Auswertungstreffen, das ist ein Treffen mit dem Kind, seinen Eltern und einem Vertreter der Diakonie.
Mit den anderen Kollegen treffen Sie sich aber auch noch auf speziellen Supervisionstreffen. Wie läuft das ab?
Ein Supervisionstreffen findet einmal aller zwei Monate statt. Das Freiwilligenteam trifft sich und in Gegenwart eines Psychologen tauschen wir uns über unsere Erfahrungen aus. Bei der Arbeit in den Familien müssen wir nämlich vorsichtig sein, damit wir nicht unsere Mission verfehlen. Wir sind dort, um dem Kind Nachhilfe zu geben, nicht um die Probleme der Familie zu lösen. Ein Psychologe berät uns deshalb, wie wir uns da verhalten sollen. Für die Anfänger unter den Freiwilligen ist diese Supervision sicher entlastend. Sie sehen, dass sie bei ihrer Arbeit mit dem Kind die gleichen Probleme lösen wie ihre erfahreneren Kollegen. Diese Treffen finden in freundlicher Atmosphäre und mit sympathischen Menschen statt. Die meisten sind um einiges jünger als ich, aber ich fühle, dass wir auf gleicher Wellenlänge sind. So bin ich mit allem sehr zufrieden.
Adam Šůra
DIE EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT DER KARLSUNIVERSITÄT IN PRAG (ETF UK)
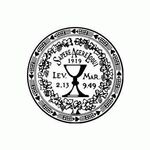 P.O. Box 529, Černá 9,
P.O. Box 529, Černá 9,
CZ 115 55 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 221 988 211; Fax: (+ 420) 221 988 215
E-Mail: intl@etf.cuni.cz
Internet: http://web.etf.cuni.cz/ETFENG-1.html
Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Karlsuniversität (ETF UK) ist die Nachfolgerin der Jan-Hus- Fakultät (1919–1950) und der Comenius-Fakultät (1950–1990). Im Jahr 1990 wurde sie in die Karlsuniversität eingegliedert. Die Verwaltung der Fakultät wird vom Dekan und dem Team der Prodekane geleitet, die auf vier Jahre in ihr Amt gewählt werden. Die Fakultät bietet Bakkalaureats- und Master-Studiengänge an – in evangelischer Theologie, Diakonie (Seelsorge und Sozialarbeit), ökumenische Studien, und verschiedene theologische Bereiche auf Doktoranden-Ebene. Die Fakultät ist ökumenisch für alle offen. Pfarrerinnen und Pfarrer der EKBB erhalten hier ihre Ausbildung.
Das Internationale Büro der Prager Theologischen Fakultät
Das Internationale Büro ist für Besucher häufig der erste Berührungspunkt mit der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Prag. Wer arbeitet dort und was sind die Aufgaben des Büros? Hier finden Sie kurze Porträts der Mitarbeiter und erfahren Näheres über die Arbeit des Internationalen Büros.
Ich heiße Věra Fritzová und bin seit dem Akademischen Jahr 1998/1999 Leiterin des Internationalen Büros. Ich bin in Prag aufgewachsen und habe mein ganzes Leben hier verbracht. Auch studiert habe ich in Prag, an der Karlsuniversität, und zwar Soziologie. Selbst nach 20Jahren in diesem Job habe ich noch Freude an der Kommunikation und der Zusammenarbeit mit Leuten, die an Universitäten im Ausland und an internationalen akademischen Einrichtungen auf verschiedensten Arbeitsgebieten tätig sind (Studium, Forschung, Fundraising …). Ich genieße es, Menschen aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichem Glauben zu treffen. Das inspiriert mich noch heute. Meine Arbeit gibt mir die Gelegenheit, meine Erfahrungen an die Studierenden und Lehrenden an unserer Fakultät weiterzugeben und an die, die aus dem Ausland hierher kommen. Ich bemühe mich auch darum, unseren internationalen Besuchern etwas von unserem Land zu vermitteln, von seiner Geschichte, von der hiesigen Art zu denken. Neben Englisch, der Sprache, in der heute nahezu die gesamte internationale Kommunikation abläuft, kann ich Deutsch, Französisch und Russisch lesen und verstehen.
Ich heiße Kristýna Kadlecová, und ich komme aus einer Gegend der Tschechischen Republik, die die Böhmisch-Mährische Höhe genannt wird. Ich studierte an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Prag Theologie. Als Austauschstudentin war ich auch an der Universität von Leeds in Großbritannien und am Theologischen Seminar von Columbia in Decatur in den USA. Das waren phantastische Erfahrungen, die mir die Richtung zeigten, die ich in meinem Leben einschlagen wollte, und ich fasste den Entschluss, mit Leuten von überallher arbeiten zu wollen. Da ich selbst Austauschstudentin war, weiß ich, wie sich Studierende fühlen, die in ein fremdes Land kommen, und deshalb hoffe ich, dass ich ihnen helfen kann, sich an der Fakultät und auch in Prag einzugewöhnen, damit sie diese wunderschöne Stadt genießen können. Im September 2018 habe ich mein Studium abgeschlossen und arbeite seit Oktober 2018 im Internationalen Büro der Evangelisch-Theologischen Fakultät. Das Büro kenne ich aber schon gut, denn bereits als Studentin half ich hier bei der Organisation vieler Veranstaltungen, Feiern und Konferenzen.
Ich heiße Peter Stephens und ich arbeite seit 1995 im Internationalen Büro, also seit dem Jahr, in dem die Fakultät von der Jungmannova-Straße in ihre heutigen Räumlichkeiten umgezogen ist. Seitdem habe ich viele Veränderungen erlebt: Sechs Dekane kamen und gingen, aber nur drei Vize-Dekane für Internationale Beziehungen – vielleicht ein Hinweis darauf, dass Kontinuität für internationale Kontakte wichtig ist. Ursprünglich stamme ich aus England, wo ich Geschichte und Soziale Arbeit studiert habe, doch wegen des Brexits beantragte ich die tschechische Staatsbürgerschaft, die ich 2017 erhielt. Neben Englisch und Tschechisch spreche ich auch Deutsch und Französisch. Ich hoffe, dass ich durch meine eigene Erfahrung, fern der Heimat zu leben, die Besucher von Prag darin unterstützen kann, sich hier wie zu Hause zu fühlen.
Im Internationalen Büro arbeitet ein kleines Team, das dem Vize-Dekan für Internationale Beziehungen unterstellt ist. Die Aufgabe des Teams ist es, die internationalen und ökumenischen Kontakte der Fakultät herzustellen, zu koordinieren, zu entwickeln und zu beleben – in Zusammenarbeit mit den Lehrenden und mit der Verwaltung, mit den Studierenden und den Repräsentationsorganen der Fakultät.
Zu seinen Aufgaben gehören:
- das Organisieren von Studierenden- und Mitarbeiteraustausch, beispielsweise durch das Erasmus-Programm
- das Betreuen der internationalen Studierenden an der Fakultät, wozu Orientierungsprogramme für neue Studenten gehören, Exkursionen zu Orten, die im Zusammenhang mit der tschechischen Geschichte und der tschechischen Reformation von Interesse sind, Hilfe bei Verwaltungsformalitäten sowie Rat und Auskunft, wenn nötig
- die Betreuung von Besuchern und Gästen der Fakultät (sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen), falls nötig Unterstützung bei der Suche nach einer Unterkunft
- die Pflege von Kontakten mit anderen Theologischen Seminaren, ökumenischen Organisationen und Kirchen
- die Koordination der Beteiligung der Fakultät an EU-Programmen
- Hilfe beim Organisieren von ökumenischen und internationalen Veranstaltungen und Konferenzen
- die Koordination der ökumenischen und internationalen Aktivitäten der Fakultät
Peter Stephens
„Am Limit“ – Prague-Marburg Summer School of Theology
Vom 6. bis 9. Mai dieses Jahres fand an der Evangelischen theologischen Fakultät in Prag die erste Prague-Marburg Summer School of Theology statt. Vier tschechische und fünf deutsche StudentInnen trafen sich unter der Leitung von Prof. Dr. Malte D. Krüger (Marburg) und Dr. Petr Gallus (Prag), um sich mit dem vielfältigen Thema von Grenzen auseinanderzusetzen. Und zwar nicht nur auf der theoretischen Ebene. Neben ausführlichen Diskussionen über theologische, philosophische und politische Texte zum Thema, die von den einzelnen Teilnehmern referiert wurden, erlebten die StudentInnen einige Grenzüberschreitungen auch empirisch, soz. am eigenen Leib: Die Deutschen mussten die Staatsgrenze überschreiten – für einige von ihnen war es Richtung Tschechien das erste Mal; alle mussten gegenseitig die Sprachgrenzen überwinden (das Seminar verlief hauptsächlich auf Deutsch, teilweise auf Englisch) und im Rahmen des Programms unternahm die ganze Gruppe auch zwei Besichtigungen: zuerst in das Prager jüdische Viertel, das andere Mal dann eine Führung durch das protestantische Prag mit fachlichen Kommentaren von Kirchenhistoriker Doz. Ota Halama.
Das Projekt der Prague-Marburg Summer School ist als ein regelmäßiges Treffen geplant. Das Thema der Grenze zeigte sich als gut gewählt, es wird das ganze Projekt auch weiterhin begleiten und verspricht interessante Punkte für eine weitere Beschäftigung mit ihm. Während diesmal eher eine Phänomenologie oder Topographie der Grenzthematik im Blick war, wird das Thema für das nächste Mal konkreter fokussiert. Es steht schon fest, dass das nächste Treffen zum gemeinsamen Seminar im Oktober 2020 in Marburg stattfinden wird. Das Prager Seminar legte einen guten Grund und lässt für die Zukunft auf ebenso interessante und freundliche Begegnungen und Diskussionen hoffen.
Petr Gallus
