Bulletin 46 – Ostern 2019
Der Leitartikel
Wir freuen uns, liebe Leser, dass wir Ihnen zu Ostern eine neue Ausgabe unserer Evangelischen Nachrichten aus Tschechien vorstellen dürfen. Wir müssen in ihr zu zwei Ereignissen zurückblicken, die nicht mehr nagelneu sind, für uns aber eine große Bedeutung haben.
Über das hundertste Jubiläum unserer Kirche haben wir bereits in früheren Ausgaben geschrieben, die große Jubiläumsfeier fand jedoch fast auf den Tag genau an dem gleichen Ort statt, an dem unsere Kirche im Dezember 1918 gegründet wurde. Einen Bericht davon sowie Links zu Photos und Video bringen wir also in dieser Ausgabe.
Jan Palach. Dieser Name ist unauslöschbar in die tschechische Geschichte eingegangen. Im Januar 1969 hat sich dieser Student knapp ein halbes Jahr nach der Besetzung der Tschechoslowakei durch die sowjetische Armee und weitere Warschauer-Pakt-Truppen aus Protest gegen die Resignation der tschechischen Gesellschaft verbrannt. Nach einer Trauerfeier im Karolinum, der Aula der Prager Karlsuniversität, wo die akademische Gemeinde aber auch tausende weiterer Bürger von dem Verstorbenen Abschied nahm, wurde Jan Palach am Olšany Friedhof von Jakub Trojan, dem späteren Professor der Evangelisch-Theologischen Fakultät beerdigt. Ein Gespräch mit Prof. Trojan, in dem er an den Januar 69 zurückdenkt, können Sie auch in diesem Bulletin lesen. Ich möchte noch gerne darauf hinweisen, dass die Gedenkfeiern, die im Januar diesen Jahres in Prag am Nationalmuseum, wo sich Palach verbrannt hatte, stattfanden, würdig und angemessen waren und dass Synodalsenior Daniel Ženatý und weitere Vertreter des tschechischen ökumenischen Rats dabei zu Wort kamen.
Liebe Freunde, Gott hat uns mit Ostern große Freude, Hoffnung und Frieden geschenkt. Mögen uns diese Gaben auch in der kommenden Zeit erhalten bleiben.
Mit besten Wünschen
Jana Plíšková
DIE EVANGELISCHE KIRCHE DER BÖHMISCHEN BRÜDER
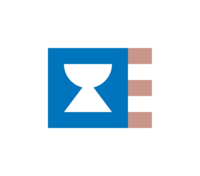 P.O. Box 466, Jungmannova 9,
P.O. Box 466, Jungmannova 9,
CZ 111 21 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 224 999 215(216); Fax: (+ 420) 224 999 219
E-Mail: ekumena@e-cirkev.cz
Internet: www.e-cirkev.cz
Die Grundlagen der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) wurzeln in der Utraquistischen Kirche (1431–1620) und in der Brüderunität ((1457–1620). Die EKBB entstand in ihrer heutigen Gestalt im Jahr 1918 durch den Zusammenschluss der bis dahin selbständigen evangelischen Kirchen Augsburger und Helvetischen Bekenntnisses. Deren Existenz wurde nach dem Ende der harten Gegenreformation, die von 1620 bis zum Erlass des Toleranzpatens durch Kaiser Joself II. im Jahr 1781 dauerte, erlaubt. Die strengen Beschränkungen mussten die Evangelischen freilich auch danach beachten, bis zum Erlass des Protestantenpatentes im Jahr 1861.
In der Zeit ihrer Entstehung hatte die EKBB 250 000 Mitglieder, im Jahre 1938 waren es dann schon 325 000 Mitglieder. Heute ist die Kirche in 14 Seniorate aufgeteilt mit einer Gesamtzahl von 250 Gemeinden und ca. 80 000 Gemeindegliedern. Die Kirche wird vom sechsköpfigen Synodalrat geleitet, der auf sechs Jahre gewählt wird. Repräsentiert wird die Kirche vom Synodalsenior und vom Synodalkurator.
Wir bekennen und sind dankbar. Erklärung des Synodalrates der EKBB zum 100. Jahrestag seit der Entstehung der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder
Unsere Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) gedenkt in diesem Jahr der 100 Jahre seit ihrem Entstehen durch den Zusammenschluss der tschechischen Gemeinden der reformierten und der lutherischen Kirche in den Böhmischen Ländern zu einer Gemeinschaft. Die EKBB hat die Lehre beider Traditionen übernommen, und darüber hinaus hat sie sich bewusst und mit Freude zur böhmischen Reformation des 15. Jahrhunderts und zur „alten Brüderunität“ bekannt. Sie hat damit den Weg gedanklicher Vielfalt und Offenheit beschritten. Wir sind dankbar dafür, dass wir in unserer Kirche regelmäßig die biblische Botschaft vom Reich Gottes hören konnten, das für diese Welt bestimmt ist und Hoffnung gibt, die über unser Leben hinausreicht. Wir sind dankbar dafür, dass sich Evangelische in bedeutendem Maße und verständlicher Weise an der Ausbreitung des Evangeliums beteiligen konnten, unter anderem auch bei der Arbeit an der neuen tschechischen ökumenischen Übersetzung der Bibel.
Die heutige Gestalt der EKBB ist freilich von einer Reihe gesellschaftlicher Veränderungen und politischer Umwälzungen in den vergangenen 100 Jahren beeinflusst worden. Die Begeisterung über den neuen selbständigen Staat ging mit einem aufstrebenden nationalen Bewusstsein einher, das, auch wenn es mit dem Evangelium nicht viel gemeinsam hatte, stark in das Selbstbewusstsein der neuen Kirchengemeinschaft Einzug gehalten hat. Die Erwartung, dass „die tschechische Nation zur Nation von Jan Hus wird“ und sich alle unter den Flügeln der evangelischen Kirche versammeln, hat sich alsbald als irrig und naiv erwiesen. Die folgende Enttäuschung hat wohl zur schrittweisen Erkenntnis beigetragen, dass die Kirche nicht aus der Tradition wächst und lebt, selbst wenn diese hervorragend ist, auch nicht aus allgemeiner Begeisterung, nicht aus Nationalismus, nicht aus der Negation des Vorherigen, sondern aus dem Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes und aus dem Vertrauen in Gottes Verheißungen.
Nach zwanzig Jahren freier Entwicklung folgten fünfzig Jahre Unfreiheit. Das nazistische Regime traf in grausamer Weiser vor allem unsere jüdischen Mitbürger. In der bedrückenden Atmosphäre drohender schwerer Strafen und allgegenwärtiger Angst lebten auch die Kirchen. Wir gedenken mit Hochachtung der Kirchenglieder, die im Kampf für Freiheit und Würde ihre Leben gaben, wie auch derer, die ihnen und ihren Familien beigestanden sind. Viele im Widerstand Engagierte bezahlten dies mit ihrem Leben. Wir bekennen, dass unsere Kirche nach der Niederlage des Nazismus nicht fähig war, den allgemein geteilten Drang nach Vergeltung abzulehnen, was zur Abschiebung der Deutschen führte.
An diese Atmosphäre in der Gesellschaft knüpfte die kommunistische „Diktatur der Arbeiterklasse“ an mit Klassenhass und Verfolgung der „nichtwissenschaftlichen Meinungen“, mit dem Kampf gegen das religiöse „Dunkelmännertum“. Menschen verließen die Kirche aus Angst um den Arbeitsplatz, um einen Studienplatz für ihre Kinder, viele legten ihre Kirchenzugehörigkeit sehr leicht ab. Wir sind dankbar für die, die trotz aller Erniedrigungen, Schikanen und Verhöhnung in den Gemeinden geblieben sind und auch ihre Kinder zur Gemeinde geführt haben. Mit Hochachtung gedenken wir aller Opfer des „Klassenhasses“ und der gewaltsamen Kollektivierung, die inhaftiert wurden, ihres ganzen Eigentums beraubt, vertrieben von ihren Höfen, und ganz besonders derer, die dies alles ihres Glaubens wegen ertragen haben. Nicht immer fanden sie ihn ihren Gemeinden Unterstützung und Solidarität. Im Jahr 1968 hat die Synode der EKBB das Versagen der Kirche bekannt, aber gegen den Druck der „Normalisierung“ haben ihre Kräfte wieder nicht gereicht.
Die Aussichten auf einen Sturz des Regimes waren nicht besonders real. Wir schätzen diejenigen, die sich an die Hoffnung hielten, dass es möglich ist, „die sozialistische Ordnung“ zu reformieren, zu humanisieren und Freiheit forderten und die Einhaltung der bestehenden Gesetze und internationalen Verpflichtungen. Für die Kirchenleitung stellten sie eine Komplikation dar, und auch in den Gemeinden fanden sie nicht immer Verständnis. Ihr Verständnis christlicher Engagiertheit fand später Widerhall in der Erklärung und dem Wirken der Charta 77, an dem sich einige von ihnen beteiligten.
Wenn wir des 100. Jahrestages der Gründung der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder gedenken, tun wir das nicht, weil wir sie feiern wollen. Es gibt nichts zu feiern außer unserem Gott. Wir sind dankbar dafür, dass wir schon fast 30 Jahre in Freiheit leben, und für die Möglichkeiten, die die freien Bedingungen gebracht haben für unsere evangelischen Schulen, für die Arbeit unserer Diakonie. Ständig und in allem vertrauen wir auf Gottes Barmherzigkeit. Unsere Gemeinden sind kleiner, schwächer, viele einst lebendige Gemeinden siechen vor sich hin, einige sind schon verschwunden. Die Aussicht in die Zukunft verdunkeln Sorgen. Bitten wir um das Geschenk zu verstehen, was unser Herr von uns will in der heutigen sich verändernden Welt. Hoffentlich betrachten wir nicht etwas Unwichtiges als rechtes Christentum und das Wesentliche sehen wir nicht oder haben keinen Mut dazu? Wie sollen wir die Völker in Bewegung verstehen, das Gewirr von Religionen, Glauben und Aberglauben, die Flut von Informationen über Ereignisse in Ländern, die für uns bis vor Kurzem weit weg waren und heute wie vor unserer Haustür liegen? In erster Linie geht es nicht darum, wie unsere Vergangenheit war, sondern es geht darum, was unsere Aufgabe heute ist. Wohin bewegt sich die Welt heute und was ist unser Ort darin? Es geht nicht nur um unsere Gemeinden, es geht um die Gesellschaft, in der wir leben. Es geht um die Welt, die Gott liebt und in die er uns gestellt hat, damit wir mitten in ihr leben als Kirche Christi und in sie Verständnis und Offenheit für einander bringen, Mitgefühl und Solidarität, Wahrheit und Liebe, Freude und Hoffnung.
Mit der feierlichen Versammlung im Obecni dum in Prag ging das Jubiläumsjahr zum 100-jährigen Bestehen der EKBB zu Ende
Wir sind glücklich und dankbar über ein Jahr der Feierlichkeiten, die wir gemeinsam erleben konnten. Bei den Zusammenkünften, in Gottesdiensten, bei Filmvorführungen und Diskussionen in der Vaclav-Havel-Bibliothek, in zahlreichen Publikationen, bei Konzerten, in Gesprächsrunden, und Gebeten... All das gipfelte in einem 4-tägigen Festival in Pardubice, wo sich Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden aus allen Ecken des Landes trafen.
Zum Ende des Jahres gehörte der Dank all jenen, die in der EKBB ihren Dienst tun, sei es als Pfarrerinnen und Pfarrer oder Kuratoren der Gemeinden. Symbolisch geschah das am 16.12.2018 im Prager Repräsentationshaus, also an dem Ort, an dem vor 100 Jahren die Generalversammlung entschied, die tschechischen Gemeinden der zwei evangelischen Kirchen (lutherischen und reformierten) zu einer gemeinsamen Kirche, der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder zusammenzuschließen.
Durch den Abend begleiteten auf humorvolle Weise Jan Blahosav (gespielt von Luboš P. Veselý) und a Jan Amos Komenský (Vladimír Hauser). Die Anwesenden grüßte über eine Videobotschaft Bruder Jan Pokorný, der 100-jährige „Altersgenosse“ der Kirche und langjährige Brünner Pfarrer.
Neben Gästen der nationalen und internationalen Ökumene und des öffentlichen Lebens war auch der Generalsekretär des Ökumenischen Rats der Kirchen Olav Fykse Tveit zu Gast bei den Feierlichkeiten. Er erwähnte in seinem Grußwort, was wir aus dem Mund von tschechischen und internationalen Gästen selten hören: auch wenn die EKBB relativ klein ist, ist sie doch eine bedeutende und sichtbare Gemeinschaft, der es gelingt durch ihre Aktivitäten und ihr Zeugnis für andere Kirchen in Tschechien und weltweit Vorbild und Inspiration zu sein.
Pfarrerin Marta Židková hielt eine Andacht und in zahlreichen musikalischen Beiträgen des Evangelischen Chores unter der Leitung des Ehepaars Moravetz konnte man sich geistlich erbauen lassen. Eine historische Reflexion bot Pavel Hošek in seinem Vortrag über die vergangenen 100 Jahre der Kirche. Der gesamte Abend stand unter der sorgfältigen Leitung und der Dramaturgie durch Hana Mikolášková, der für die Vorbereitung und für die Regie großer Dank gebührt.
Zum Ende erklang die 9. Sinfonie von Antonin Dvorak „aus der neuen Welt“, aufgeführt durch das Sinfonieorchester der Hauptstadt Prag FOK.
Eigentlich hätten auch vielen tausend Anderen, die sich in der Kirche außer den Pfarrerinnen, Pfarrern und Kuratoren engagieren, der Dank gebührt. Lehrer der Sonntagsschule, Jugendleiter, Gemeindeschwestern, Seelsorger, Mitarbeitende der Diakonie, Freiwillige, Ehrenamtliche Mitarbeitende... kurz: alle, die durch ihr Leben und ihren Dienst das Evangelium verkündigen und sich darum sorgen, was (nicht erst seit 100 Jahren) unser Auftrag ist.
Jiří Hofman
Das Epochenjahr 1918 aus Sicht der mitteleuropäischen Kirchen. Konferenz im Senat
Ende letzten Jahres fand in Prag eine internationale Konferenz über das Jahr 1918 statt. Teilnehmende aus mehreren evangelischen Kirchen in Mitteleuropa kamen zusammen, um der Umbrüche, die im Jahr 1918 nicht nur zu neuen Staatsgrenzen führten, sondern auch Auswirkungen auf Veränderungen in der Ordnung und Zusammenarbeit der Kirchen hatte, zu gedenken.
In Mitteleuropa entstanden damals neue Staaten, für die nun das hundertjährige Bestehen ein Grund zum Feiern ist, weil das Ende des Krieges ihnen Souveränität in einem modernen Staat brachte. Für andere Staaten sind die Folgen der Kriege jedoch bis heute traumatische Erlebnisse, denn sie erlebten 1918 als herben Verlust von Landesteilen und als Beschädigung ihres nationalen Stolzes. Die Teilnehmenden der Konferenz diskutierten diese unterschiedlichen Perspektiven und hinterfragten, welche Rolle ähnliche Erfahrungen in der heutigen Zusammenarbeit spielen und wie sich die Positionen des Staates oder der Gesellschaft von denen der Kirche unterscheiden.
Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) veranstaltete diese Konferenz gemeinsam mit dem Senat des Parlaments der Tschechischen Republik. Darüber hinaus gehörten die Evangelisch- Theologische Fakultät der Karlsuniversität, der Ökumenische Rat der Kirchen in der Tschechischen Republik und die Evangelische Kirche Deutschland (EKD) auch zu den Veranstaltern.
Jiří Hofman
Der Glaube beansprucht keine definitiven Antworten. Interview mit Jakub S. Trojan
Jakub S. Trojan ist Theologe, Pfarrer der EKBB und ehemaliger Dekan der ETK UK. Am 25. 1. 69 bestattete er Jan Palach, den Studenten der Karlsuniversität, der sich selbst angezündet hatte, aus Protest gegen die Gleichgültigkeit, die die tschechische Gesellschaft nach der Okkupation der sowjetischen Armee im August 1969 gefangen hielt. Seit dieser Begebenheit sind 50 Jahre vergangen.
Sie stammen aus einer nichtgläubigen Familie. Wie war Ihr Weg zu Gott?
Entscheidend für mich waren die Jahre auf dem Gymnasium. Später habe ich eine Einladung zu einer christlichen Jugendkonferenz bekommen, die der YMCA ausgerichtet hat. Mit Überraschung habe ich dort festgestellt, dass die christlichen Studenten hoch gebildet sind und über interessante Themen diskutierten und Sport trieben. Ich sah ihre Einstellung, ihren Glauben, sie waren zu mir unglaublich höflich und freundlich. Das hat mich angesprochen. So war der Beginn. Als ich dann an der Theologischen Fakultät angefangen hatte, auf Pfarramt zu studieren, rief man mich ab, zum „technischen Hilfsbataillon“ (eine Umerziehungsmaßnahme für regimekritische Geistliche). Ich war unter 154 katholischen Brüdern unterschiedlicher Orden der einzige Protestant. Und das war ein Geschenk des Himmels. Dort habe ich drei Jahre meines Lebens verbracht.
In der Zeit des Prager Frühlings waren Sie Pfarrer der EKBB und in diesem Amt haben Sie im Januar 1969 Jan Palach bestattet. Er gehörte zu Ihrem Gemeindegebiet. Kannten Sie ihn persönlich?
Ich kannte ihn kaum. Als ich in Libiš (30 km nördlichen von Prag) Pfarrer wurde, studierte er bereits in Prag. Seine Mutter wohnte in Všetaty, einem Ort der zur Gemeinde Libiš gehörte. Sie kam häufig mit dem Zug in unsere Gottesdienste. Aber am Sonntag vor seiner Tat kam auch Jan in den Gottesdienst. Ich fand ihn interessant, er hatte ein konzentriertes Gesicht und einen herrlichen Blick. Nach dem Gottesdienst unterhielten wir uns. Man merkte, dass er ein geistreicher Mensch war.
Worüber sprachen sie denn?
Es störte ihn, dass sich die Menschen anpassen und resignieren. Er war der Meinung, dass es nötig ist, sie aufzurütteln. Er wäre glücklich, wenn sich die Kirche mehr am Kampf mitten im Besatzungssystem beteiligen würde. Es schien ihm, dass die Kirche nicht darauf reagierte, wie die Menschen sich anpassten und die Hoffnung auf Wandel zum Besseren verlören. Ich gab ihm da Recht.
Ließ sich da etwas machen – aus Ihrer Situation eines seelsorglichen Predigers, der selbst mit dem System seine Schwierigkeiten hatte?
Die Kommunisten hatten die Meinung, dass die Kirche und die Religion nicht mehr lange überleben würde und aussterbe. Sie lehnten es ab, dass die Kirche auf die Geschehen in der Gesellschaft reagierte. Ich war damit nicht einverstanden. Ich war überzeugt, dass das Evangelium eine Botschaft ist, die nicht nur das Individuum und seine Lebensrichtung betrifft, sondern die ganze Gesellschaft. Im Hinblick auf Jan Palach: Er beging seine Tat kurz nach unserem Gespräch, für eine tieferes Gespräch war keine Zeit. Ich habe ihn nicht mehr getroffen.
Im Jahr 1977 waren Sie unter den Ersten, die die Charta 77 unterschrieben. Hatte das etwas mit dem Tod von Jan Palach zu tun?
Ja, unter anderem. Aber ich habe mehrere solcher Texte unterschrieben, wenn mir der Inhalt entsprechend anregend erschien. Es gab etwa 10 solcher Veröffentlichungen. Niemand ahnte, dass das Papier Charta 77 solch eine Wirkung haben sollte.
Die Mutter von Palach kam nach seinem Tod zu Ihnen, dass Sie ihren Sohn bestatten. Haben Sie erwartet, dass sie Sie bittet?
Nachdem Jan Palach sich durch die Selbstverbrennung das Leben genommen hat, sprach ich lange mit Palachs Mutter. Direkt nach Palachs Tod habe ich nicht gewusst, dass es sich um ein Mitglied aus meiner Gemeinde handelt. In der Zeitung schrieben sie nur J.P. Ich wusste nicht, dass das Kürzel für Jan Palach stand. Wir haben es erst durch unsere Tochter erfahren, die mit Jans Cousin zur Schule ging. Das hat uns alle erschüttert. Aber da wusste ich noch nicht, dass ich ihn bestatten würde.
In der kirchlichen Agende zur Bestattung unterscheidet man zwischen einem selbstherbeigeführten und einem natürlichen Tod. Die Frage, ob der Tod Palachs ein Suizid war, mussten Sie sich vor seiner Bestattung stellen. War die Antwort auf diese Frage schwierig?
Ja, das war ein Problem, das ich erst theologisch lösen musste. Die Mehrheit von Suiziden ist ein Akt der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. War der Tod von Jan ein Selbstmord oder ein Opfer? Ich sagte mir: Das war keine Verzweiflungstat. Er wollte mit seiner Tat die ganze Gesellschaft aufrütteln. Er wollte Menschen mobilisieren, dass sie darüber nachdenken, wie sie mit der aktuellen Besatzungssituation umgehen. Er dachte nicht an sich, sondern an den Nächsten. Und er wählte ein Mittel, das unvorstellbar wirkungsvoll ist.
Sie sagen „wirkungsvoll“. Wie haben die Menschen denn auf den Tod von Jan Palach reagiert?
Es war unglaublich, was für eine Welle sein Tod nicht nur in Prag, sondern im ganzen Land ausgelöst hat. Sogar die Köpfe des Regimes waren aus der Bahn geworfen, das Regime war einige Wochen wie betäubt. Es war auch deswegen ein Schock, weil es kein feindlicher Akt war. Es war eine Selbstvernichtung, die eine Botschaft hatte. Palach hat sich, glaube ich, vorgestellt, dass sich die Leute sagen: „Wenn so ein junger Mensch so weit geht, sein Leben zu opfern, was muss dann ich erst machen?“ Nicht das nachzuahmen, aber kleinere Opfer zu bringen. Die Situation, in der die Gesellschaft steckte, zu ändern, in kleinen Dosen. Bei seiner Bestattung zog eine unglaublich große Menge Menschen durch die Prager Straßen. Es war still, die Menschen weinten. Sie waren betroffen, und zugleich war es eine würdevolle Stimmung.
Wie ging es dann weiter, wenn Sie sagen, das Regime war „aus der Bahn geworfen“?
Einige Tage waren sie vollkommen ratlos. Die „Normalisierung“ hatte begonnen, viele Politiker waren unsicher. Die würdevolle Bestattung mit dem Beerdigungszug durch Prag haben sie noch erlaubt. Als sich die Regierung wieder gefasst hatte und die gesamte Begebenheit etwas verhallt war, versuchte die Regierung eine neue Deutung für die Tat zu finden. Sie begannen zu sagen, dass Palachs Tod ein tragischer Unfall war.
Vilem Novy, kam damals mit der Erklärung, dass der Tod von Jan Palach ein Unfall bei dem Versuch mit der sogenannten „kalten Flamme“, mit der auch Feuerschlucker ihre Tricks machen, war. Dass er sich gar nicht verbrennen wollte, es ihm aber nicht gelungen war, die richtige Mischung der „kalten Flamme“ zu mischen. Glaubte das damals jemand?
Niemand.
Welche Reaktion rief Palachs Tod in der Kirche hervor?
In der Kirche begann eine Diskussion darüber, ob es ein Opfer war. Auch die Katholiken stimmten mit dieser Sichtweise überein. Der katholische Bischof bot der Familie sogar an, dass er die Bestattung machen würde. Aber die Palachs waren evangelisch.
Sehen Sie eine Gemeinsamkeit zwischen Palachs Selbstverbrennung und Jan Hus Tod 1415?
Palach liebte die tschechische Geschichte. Der Unterschied liegt aber darin, dass Hus verbrannt wurde, es handelte sich bei Jan Hus um eine Strafe. Während Palach sich eine Frage stellen musste – bzw. ich hoffe, dass er sie sich gestellt hat - ob diese Selbstzerstörung einen Sinn hat.
Jan Hus musste nicht sterben, es war sein Opfer für Gottes Wahrheit. Bei Palach scheint es, als ob Gott in Palachs Sterben keine Rolle spielt. Dass es ein Opfer für die Gesellschaft war. Was denken Sie, wie Gott auf Palachs Tat blickt?
Palachs Motive haben wir schon oben besprochen, aber niemand weiß es mit Sicherheit. Ich möchte keine definitive Antwort geben. Es gehört zum Glauben, dass er nicht den Anspruch hat, definitive Antworten zu geben. Und Palach hat das Ganze bis zu dem Punkt verschoben, wo wir mit unseren theologischen und biblischen Antworten an unsere Grenzen kommen. Aber das ist gut. Denn unser ganzes Sein stellt uns immer wieder von Neuem vor Fragen, auf die wir keine Antwort haben. Wir sind dazu berufen, dass wir die Fragen stellen, damit wir uns im Angesicht der Probleme vorwärts bewegen.
Das führt uns zurück zu Palachs Mutter. Sie musste damit zurechtkommen, dass sie nicht nur ihren Sohn verloren hatte, sondern dass auch weitere Mütter ihre Kinder verloren. Palachs Tod zog eine Welle von Selbstverbrennungen nach sich. Von Januar bis April 1969 haben sich sieben weitere Menschen selbst verbrannt und 19 zogen sich schwere Brandverletzungen zu. Wie hat sie das ertragen?
Über die weiteren Verbrennungsopfer berichtete die Presse schon gar nicht mehr und viele Menschen wusste davon gar nichts. Nur Jan Zajic ist noch bekannt. Der Tod von ihrem Sohn hat Frau Palach in eine tiefe Krise gestürzt. Aber jeden Tag hat sie viele Briefe bekommen, in denen Menschen ihre Solidarität und ihren Dank aussprachen. Sie begann zu begreifen, dass die Familie den Tod von Jan überstehen wird. Es war für sie wie eine Erscheinung – dass die gesamte Gesellschaft zu so einer Anteilnahme erwachte. Sie erhielt auch von der jungen Frau Unterstützung, die mit Jan zusammen war.
Die geheime Staatspolizei setzte dann Frau Palach unter Druck. Hatten Sie auch Probleme dieser Sorte nach der Bestattung?
Nicht sofort. Aber im September, neun Monate nach der Beerdigung kamen sie damit, dass Palach diese Tat nur durchführen hatte können, weil er von jemandem vorbereitet worden war. Und dass das der Pfarrer gewesen sein musste. Sie hätten Zeugen, die sagen, dass ich es gewesen sei. Sie wollten das deswegen so drehen, damit sie hätten sagen können: „Seht, die Kirche hat eine schlimme Wirkung auf unsere Jugend!“ Ich bat darum, dass sie mir die Zeugen vorführten. Aber sie meinten, das könnten sie nicht. Sie wollten meinen Kalender sehen, um zu sehen, ob es nicht Notizen zu einem Treffen mit Palach gäbe. Ich hatte keine, weil ich außer dem Gespräch im Anschluss an den Gottesdienst Palach nicht getroffen hatte. Dann wollten sie mein Tagebuch sehen, aber ich gab es ihnen nicht. Direkt im Anschluss bin ich zum Synodalrat gegangen und habe mein Tagebuch in meiner Aktentasche fest unter meinen Arm geklemmt. Ich hatte Angst, dass jemand sie mir wegnahm. Drei Jahre später bekam ich dann die staatliche Erlaubnis entzogen, als Pfarrer zu arbeiten.
Jan Palach wurde, nachdem Sie ihn auf dem Olšany Friedhof in Prag bestattet haben, kurze Zeit später nochmal umgelegt, auf den Heimatfriedhof in Všetaty.
Ja, die Familie kam zu mir und fragte, was sie machen sollten. Man hatten ihnen gesagt, dass sie ihn entweder auf dem Friedhof in Všetaty begraben werden oder dass sie ihn in einem Gemeinschaftsgrab verscharren ohne Angabe des Ortes. Also lag er dann bis 1989 in Všetaty.
Damit hatten die Kommunisten nicht viel gewonnen, die Menschen pilgerten jetzt zu zwei Gräbern...
Auf dem Prager Olšany- Friedhof haben sie das Grab von Palach umbenannt, der Name einer fremden Frau stand dort. Aber die Leute stellten trotzdem dort Kerzen ab. In seinem Heimatort Všetaty hatte es die geheime Staatssicherheit einfacher. Dort fingen sie die Menge an jungen Leuten, die am Jahrestag zum Grab wollten, schon am Bahnhof ab.
Auch wenn das Opfer Jan Palachs die Nation erschütterte, das System änderte es nicht. Das, was Palach bezwecken wollte, geschah erst 20 Jahre später – 1989. Die Samtene Revolution begann im Januar mit der Palach-Woche. Haben Sie sich dabei an Jan erinnert? Was dachten Sie?
Ich dachte, er ist tot und er spricht doch noch immer zu uns. Das ist wie in der Bibel. Die Bindung zu seiner Tat war unverkennbar. In den Menschen war sie geblieben, die Menschen hatten sie die ganze Zeit in ihren Herzen getragen. Für mich ergab sich daraus, dass wir unser Leben jeden Tag verantwortungsvoll führen sollen. Und so wächst der Mensch. Es kultiviert ihn, es macht ihn einfühlungsvoll in die Probleme anderer in der Gesellschaft. Verantwortung ist für mich der Eckstein des Glaubens. Im Wort „Verantwortung“ kann man das Wort „Beantwortung“ hören – Antwort auf das, was uns in diesem Spruch überliefert ist: „Du sollst so handeln.“. So spricht uns Gott an, durch seinen heiligen Geist.
Kann man in der Bibel ähnliche Opfer finden, wie das von Palach?
Als ich die Beerdigungspredigt für Jan Palach vorbereitet habe, habe ich so ein Opfer bei Samson gefunden. Es war auch kein Suizid – er gab sich hin, damit seine Brüder leben könnten. Suizid ist ein Akt aus Hoffnungslosigkeit, Palach hatte aber Hoffnung, dass Menschen seiner Tat eine Bedeutung zumessen. Jan Palach habe ich nicht als jemand verstanden, der sein Leben zerstört, sondern der ein Zeuge ist.
Das Interview wurde aus der Zeitschrift „Brana 1/19“ übernommen, die von der EKBB herausgegeben wird. Redaktionell gekürzt.
Licht im Riesengebirger Fischerhaus
Wie jedes Jahr fand der Frühjahrseinsatz statt, und in der letzten Juniwoche bereits der fünfte Jahrgang der tschechisch-deutschen Woche, verbunden mit der Kirchweihfeier der Hackelsdorfer Kirche.
Die Kirchweihfeier der Hackelsdorfer Kirche wurde traditionsgemäß mit dem tschechisch-deutschen Gottesdienst eröffnet, und mit dem vorzüglichen Mittagessen aus der Küche von Olga und Ben Klinecký im Bergheim/Horský domov abgerundet. Wie immer fand auch ein Konzert statt: Betreits am Freitag trat die Band „Pláče kočka“ (Es weint die Katze) auf.
Um das Licht im Fischerhaus/Kunzárna (dem herkömmlichen Riesengebirgshaus – einst im Besitz von Laurenz Fischer) bemühten wir uns bei dem Arbeitseinsatz im August, als an der neuen Elektroleitung gearbeitet wurde. Der künftige Museumsraum ist hergestellt, zuletzt wurde der neue Holzboden gestrichen. Unser Ziel ist, das Haus als eine einfache Gebirgsherberge mit einer kleinen Exposition zur deutschen und tschechischen Geschichte des Ortes zu erneuern. Das geistliche Programm des Treffens im August wurde von dem aus Angola stammenden evangelischen Pfarrer Leonardo Teca geleitet. Die Teilnehmenden bereiteten Brennholz für Horský domov vor, nachdem sie eine schuppenartige Obdachung fürs Holz gebaut hatten.
Neben anderen Wochenendarbeiten und Wintervorbereitungen am Fischerhaus ist noch eine Aktion zu nennen: unsere Teilnahme am regelmäßigen Heimattreffen des Heimatkreises Hohenelbe in der Lutherstadt Wittenberg am 1.-2. September 2018. Der Heimatkreis unterstützte finanziell die tschechisch-deutsche Woche und fördert auch weitere Vereinsaktivitäten.
Unser Antrag, das Fischerhaus/Kunzárna zum Kulturdenkmal zu erklären, wird zur Zeit vom Kulturministerium in Prag bearbeitet. Wir begrüßen diese positive Entwicklung.
Pläne für Jahr 2019
In diesem Jahr wollen wir mit Hilfe eines erfahrenen Zimmermanns den ganzen Juli am Auswechseln der beschädigten unteren Hausbalken am Fischerhaus/Kunzárna arbeiten. Dies stellt die Schlüsseletappe der Rekonstruierung dar, an die alle weiteren Maßnahmen in den nächsten 2 – 3 Jahren anschließen können. Falls wir zusätzliche Finanzierungsquellen finden, möchten wir noch in diesem Jahr mit dem Bau des Schornsteins beginnen. Nach vielen Jahren wäre es dann wieder möglich, im Ofen zu heizen.
Bei unseren Aktionen arbeiten wir mit der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste – Servitus zusammen, unterstützt vom Heimatkreis Hohenelbe; des weiteren mit dem Verein der evangelischen Jugend SEM, der evangelischen Pfarrgemeinde in Vrchlabí und mit den Pächtern des Bergheims/Horský domov Olga und Benjamin Klinecký. Für Förderung danken wir auch dem Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds und dem Förderfonds der Evangelischen Kirche der böhmischen Brüder.
Jan Kirschner
Nachträgliche Steuer für die Kirchen. Falls dem Vorschlag zugestimmt wird, zahlen die Kirchen hunderte Millionen Kronen für den rückerstatteten Besitz
Die kommunistischen Abgeordneten haben eine Besteuerung der Ausgleichszahlungen für den Besitz, der den Kirchen im Jahre 1948 vom kommunistischen Regime unrechtmäßig genommen wurde, vorgeschlagen. Ende Januar diesen Jahres stimmten die Abgeordneten des Unterhauses des Parlaments der Gesetzesänderung zu.
Die Kirchen sollen dieser Änderung zufolge dem Staat eine Steuer für das zahlen, was ihnen vom Staat gestohlen wurde und jetzt wieder zurückgegeben wird. Rechtsexperten und Senatoren sind sich einig, dass es sich hierbei um einen verfassungswidrigen Schritt handelt.
Kontroverse Diskussionen ruft bereits der Fakt hervor, dass es hierbei um einen Vorschlag der Abgeordneten derjenigen Partei geht, die den Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg ihr Eigentum wegnahm. Mit der Machtübernahme durch die Kommunisten wurde der Besitz verstaatlicht, wodurch die Kirchen abhängig vom Staat wurden. Es ging um ein wirkungsvolles Werkzeug, mit dessen Hilfe die staatliche Macht ökonomischen Druck auf Geistliche und Gläubige ausübte und die Kirchen in ihrem freien Wirken einschränkte.
Nach dem Fall des kommunistischen Regimes im Jahre 1989 war klar, dass es zu einem Schadensausgleich und zur finanziellen Trennung der Kirchen vom Staat kommen muss. Der Weg zur Einigung war nicht leicht und dauerte lange 23 Jahre. Einen Großteil der beschlagnahmten Gebäude und Grundstücke nutzte der Staat während der kommunistischen Ära nämlich zu eigenen Zwecken, verkaufte, bebaute oder entwertete sie auf andere Weise. Im Rahmen der Restitution war es größtenteils nicht mehr möglich, den Besitz in seiner eigentlichen Form zurückzugeben.
Im Jahre 2012 verabschiedeten die Gesetzesgeber endlich das Gesetz über den Eigentumsausgleich mit den Kirchen und religiösen Gruppen, demzufolge 56 % der Immobilien im Wert von ungefähr 2,9 Milliarden Euro zurückgegeben werden sollten.
Weitere cca 2,3 Milliarden Euro zahlt der Staat den Kirchen bis zum Jahr 2043 in Form eines sogenannten finanziellen Ausgleichs für den Besitz, der nicht mehr in seiner eigentlichen Form zurückgegeben werden kann. Hand in Hand mit den Ausgleichszahlungen soll der Staat während dieser Etappe langsam die staatliche Unterstützung kirchlicher Tätigkeiten reduzieren, bis es zur kompletten Trennung kommt.
Die Ausgleichszahlungen teilen die Empfänger untereinander auf. Obwohl ganze 98 % aller finanziellen Ansprüche der Römisch-katholischen Kirche zufallen, weil vor allem ihr das Eigentum beschlagnahmt wurde, ging aus den Beratungen dank ihrer Benevolanz ein Kompromiss hervor, nach dem sie nur 80 % bekommt. Das restliche Fünftel wird unter den nichtkatholischen Kirchen aufgeteilt.
Und gerade um die nachträgliche Besteuerung dieser Entschädigungszahlungen spielt man nun im Parlament ein politisches Spiel. Die Minderheitsregierung des Unternehmers Andrej Babiš ist auf die Unterstützung der Stimmen der Kommunisten und Rechtspopulisten angewiesen und hat im Tausch dafür die Verabschiedung dieses populistisch–kommunistischen Gesetzes versprochen. So wurde der Gesetzesentwurf tatsächlich angenommen. Im Oberhaus des Parlaments ist der Entwurf jedoch auf harten Widerstand gestoßen. Die Senatoren lehnten den Gesetzesvorschlag bei ihrer Sitzung Ende Februar ab, dagegen stimmten 64 von 74 der anwesenden Gesetzgeber.
Der Senat beschrieb den kommunistischen Vorschlag als „schamlos und unrechtmäßig“. Diese Änderung verstoße grob gegen das Besitzrecht und gegen das Rechtssystem generell. Der Senatsvorsitzende Jaroslav Kubera nannte den Vorschlag eine „außergewöhnliche Unverschämtheit“. Weitere Senatoren merkten an, dass der Staat in der kommunistischen Ära viel mit dem verstaatlichten Besitz verdient, aber nichts für seinen Erhalt getan hat. So sind rund 251,5 Milliarden Kronen in die Staatskasse geflossen, derweil den Kirchen für ihre Tätigkeiten nur 60 Milliarden gezahlt wurden. Und nun gibt der Staat nur noch Ruinen und ausgebeutete Wälder zurück.
Im weiteren Gesetzgebungsverfahren wandert der vom Senat abgelehnte Vorschlag also zurück in das Unterhaus des Parlaments. Da er hier aber schon beim ersten Mal eine mehrheitliche Zustimmung erlangt hat, wird er wahrscheinlich auch dieses Mal die Unterstützung der Parlamentarier bekommen. Falls es so geschehen sollte und auch der Präsident keinen Einspruch gegen das Gesetz einlegt, erwägen die Senatoren eine Beschwerde beim Verfassungsgericht. Die Kirchen selbst können sich hier nämlich nicht verteidigen.
Jiří Hofman
Direkt im Gespräch. Der Synodalrat der EKBB trifft Kirchenleitungen aus drei Ländern
In den ersten drei Monaten 2019 hat der Synodalrat die Kirchenleitungen dreier Schwesterkirchen aus dem Ausland zu Gesprächen getroffen. Bei den bilateralen Gesprächen geht es um viele aktuelle und gemeinsame Themen – und immer wieder um Mission.
Mit der Reformierten Christlichen Kirche in der Slowakei (RKSK) verbindet die EKBB die Geschichte in einem gemeinsamen Staat, der Tschechoslowakei. Mehrere Mitglieder der Kirchenleitung der RKSK haben in Prag Theologie studiert und obgleich die Mehrheit der Kirche ungarischsprachig ist, konnten die bilateralen Gespräche in tschechischer bzw. slowakischer Sprache geführt werden. Ende Januar 2019 fuhr der Synodalrat der EKBB nach Rimavská Sobota, wo die RSKS im neu gebauten Sternhaus das Zentrum ihrer Synode unterhält. Aufgrund der Unterstützung durch die Regierung von Ungarn ist die Kirche mit vielen Bauprojekten beschäftigt. Neben Kirchen und Gemeindegebäuden handelt es sich vor allem um Schulen. Die Gespräche behandelten außerdem Themen wie Liturgie, Gesangbuch (die EKBB will nächstes Jahr ein neues Gesangbuch herausgeben) und den Mangel an jungen Pfarrern. Beide Kirchenleitungen betonten, wie wichtig Ihnen die gegenseitigen Kontakte und Gespräche sind.
Ende Februar stand für den Synodalrat der EKBB ein weiteres Kirchenleitungstreffen an. Die Leitung der Evangelisch-lutherischen Kirche in Ungarn hatte den Synodalrat nach Győr eingeladen. Nach einem ersten derartigen Treffen Anfang 2018 in Brünn war dies die zweite Begegnung. Im Laufe diesen Jahres war in der ELKU Peter Kondor als neuer Bischof des Süddistrikts der ELKU eingeführt worden. In Győr besuchten die Kirchenleitungen die neu renovierten Gebäude der „Insula Lutherana“ mit der alten evangelischen Stadtkirche sowie den schulischen und diakonischen Einrichtungen der ELKU. Bei den Gesprächen haben beide Kirchenleitungen eine Reihe von Anregungen für künftige konkretere Zusammenarbeit gesammelt und wollen diese intensivieren.
Anfang März war die EKBB Gastgeber für ein weiteres großes Treffen. Mit 17 Personen war fast die ganze Kirchenleitung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz zu Besuch in Prag. Das Programm begann mit einem gemeinsamen Besuch der Deutschen Botschaft und einem Gespräch mit Botschafter Dr. Christoph Israng. Neben Themen zu missionarischer Gemeindearbeit, Bildung und Kirchenfinanzierung waren auch gesellschaftliche Fragen wie Extremismusprävention und der Beitrag der Kirchen für eine offene Gesellschaft wichtige Gesprächsinhalte. In der EKBB-Gemeinde in Prag-Strašnice hielt Bischof Dröge eine beeindruckende Predigt über die verbindende Macht der Liebe in der heutigen von Trennungen geprägten Welt.
Oliver Engelhardt
DIE DIAKONIE DER EKBB
 Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Tel: (+ 420) 242 487 811 (812); Fax: (+420) 242 487 834
E-mail: info@diakonie.cz
Internet: www.diakonie.cz
Die Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) ist eine gemeinnützige christliche Organisation, die Hilfe und Unterstützung anbietet für ein würdiges und vollwertiges Leben, auch wenn es durch Alter, Krankheit, gesundheitliche Behinderungen, Isolation, schwierige soziale Situationen und andere Lebenskrisen beeinträchtigt ist. Die Dienste der Diakonie der EKBB erfolgen auf der Grundlage der Botschaft des Evangeliums von der Liebe Gottes und nach dem Vorbild des Dienstes Jesu Christi. In ihren Zentren und Spezial-Schulen bietet die Diakonie soziale, gesundheitliche, Bildungs- und Seelsorgedienste an. Unter den nicht-staatlichen Organisationen, die soziale Dienste anbieten, ist die Diakonie der EKBB die zweitgrösste Institution.
Wie wird das dreißigjährige Jubiläum der Diakonie in diesem Jahr gefeiert?
Im Juni 1989 nahm die Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder ihre Tätigkeit wieder auf. An dieses bedeutsame Jubiläum erinnern verschiedene Geburtstagsfeiern, deren Höhepunkt ein gemeinsames Treffen am 20. Juni um 15 Uhr in der Salvatorkirche in Prag sein wird. Wir bereiten ein Festprogramm mit vielen Gästen vor, das in einigen Stationen durch drei Jahrzehnte des Daseins der Diakonie führt, von den nachrevolutionären Anfängen bis in die heutigen Tage. Auch Musik wird nicht fehlen, ebenso wenig wie Raum für Begegnungen und Gespräche bei Kaffee oder einem Glas Wein. Wir laden alle ein, die gemeinsam mit uns den Geburtstag der Diakonie feiern möchten: Angestellte, Freunde, Partner der Diakonie und andere. Wir freuen uns auf Sie! Zur Feier der Diakonie haben wir zudem eine eigene Webseite erstellt: www.diakonie30.cz. Sie finden dort einen Veranstaltungskalender der Zentren und Schulen, aber auch Geschichten aus dem Leben der Diakonie, Informationen zu ihrer Geschichte bzw. ihren Werten oder die Möglichkeit, der Diakonie zum Dreißigsten ein Geschenk zu kaufen.
Und wie sahen die Anfänge der wiedererstandenen Diakonie aus? Darüber können Sie im Folgenden ein Gespräch mit einem der „Gründerväter“ lesen, mit Zdeněk Bárta.
Zdeněk Bárta (*1949) gelang es, in seinem Leben Pfarrer, Wasserstandsableser, Abgeordneter und Senator zu sein. Und er war bei der Geburt der Diakonie der EKBB dabei. Sein Leben ist bis heute eng mit der Diakonie Leitmeritz (Litoměřice) verknüpft, wo er dem Aufsichtsrat vorsteht und ehrenamtlich wirkt.
Wir waren vorbereitet und zugleich ganz fürchterlich uninformiert
Das kommunistische Regime hatte die diakonische Arbeit für eine lange Zeit verboten. Trotzdem musste sie 1989 nicht bei Null anfangen.
Was wussten Sie vor dem Jahr ’89 über die Diakonie?
Ich hatte mitbekommen, dass die Diakonie eine große soziale Organisation im damaligen Westdeutschland war. Und ich sagte mir, dass die Deutschen es gut hätten. In Tschechien hatten die Kommunisten die Diakonie verboten und die Gläubigen in die Gotteshäuser verbannt, damit sie aus der Kirche einen Klub der Frömmler machen konnten. Das ging weitgehend auf. Die Deutschen habe ich im Stillen beneidet. Wenn nämlich die Kirche keinen Sozialdienst ausübt, erfüllt sie eine ihrer zentralen Bestimmungen nicht.
Wie haben Sie nähere Informationen über die Arbeit der Diakonie bekommen?
In der Kirche gehörte ich zu der Gruppe von Leuten, die sich an den Menschenrechten orientierten. Deshalb hatte ich auch die Charta 77 unterzeichnet. Bestandteil der Menschenrechte sind auch die sozialen Rechte, das lässt sich nicht trennen. Und selbst in diesem Bereich ging das kommunistische Regime nicht gut vor. Besonders betraf das Menschen mit Behinderung. Sie waren verbannt in Anstalten, ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Es gab keine barrierefreien Gebäude. Es gab keine Pflegefamilien. Wir wussten, dass sich das ändern muss, wir waren in Kontakt mit westlichen Theologen, Pfarrern, manchmal auch mit Mitarbeitern der Diakonie, und über diese Dinge haben wir mit ihnen gesprochen. Sie kamen inoffiziell zu uns, oft als Touristen. Gegen Ende der achtziger Jahre ließ auch das kommunistische Regime eine öffentliche Debatte über die Notwendigkeit von Veränderungen in der Sozialarbeit zu.
Wohl auch dank diesem Umstand entstand die Diakonie schon vor dem 17. November ’89.
Die Jahre der öffentlichen Debatten zahlten sich aus, wir waren vorbereitet. Als offensichtlich wurde, dass das Regime nicht mehr die Kraft und den Willen hat, unabhängige Initiativen zu liquidieren, machten wir uns an die Organisation. Das erste größere Vorbereitungstreffen zur Gründung der Diakonie wurde in Prag in der evangelischen Kirche in Smíchov verwirklicht. Wir waren uns einig, dass die Kirche Träger der Diakonie sein sollte, aber dienen sollte sie allen, nicht nur Menschen aus der Kirche. Wir waren uns außerdem einig, dass die Tätigkeit der Diakonie nicht im Stile „eines fürs andere“ sein sollte – wir helfen dir, und dafür gehst du ab jetzt immer in die Kirche. Heute hört sich das selbstverständlich an, aber damals war das so selbstverständlich nicht.
Sie waren damals evangelischer Pfarrer?
Schon wieder ja, aber lange Zeit hatte ich mein Amt nicht ausüben können, wegen meiner Unterschrift unter die Charta 77, dadurch wurde ich für das Regime ein Feind, sie entzogen mir die sogenannte staatliche Genehmigung zur Ausübung des Pfarrdienstes. Ein Jahr lang war ich arbeitslos, alle hatten Angst, mich Dissidenten einzustellen. Dann habe ich als Wasserstandsableser gearbeitet. Ich wurde aber nicht so stark verfolgt wie einige meiner Kollegen. Mich schützten Protestanten aus Kuttendorf (Chotiněves), wo ich tätig war. Es handelte sich um ukrainische Tschechen, die unser Land von den Nazis befreit hatten, zusammen mit der Roten Armee. Dann blieben sie. Sie waren Christen, aber auch Soldaten, antifaschistische Kämpfer – im damaligen Regime so etwas wie die höchste Kaste. Sie bildeten um mich so etwas wie einen Schutzring. Die tschechoslowakische Stasi traute sich nicht so recht an mich heran. Als sich die Verhältnisse langsam entspannten, bekam ich die staatliche Genehmigung wieder. Am 1. Januar 1987 kehrte ich auf die Kanzel zurück. Ich bedankte mich bei den staatlichen Ämtern, dass das genau zehn Jahre nach der Gründungserklärung der Charta 77 geschah. Gleich am nächsten Tag saß ich wieder im Verhör, und die Stasi-Mitarbeiter knurrten mich an, dass das so nicht gehe …
Haben Sie sich der Diakonie gleich nach der Revolution im November ’89 gewidmet?
Das war der Plan. Im Jahr 1990 jedoch fanden die ersten freien Wahlen statt und es ging die große Furcht um, dass die wieder von den Kommunisten beherrscht würden. Für die demokratischen Kräfte mussten bekannte Persönlichkeiten kandidieren. Ich war bekannt, ich hatte die Samtene Revolution in Leitmeritz angeführt. So wurde ich bis zu den nächsten Wahlen im Jahr 1992 Abgeordneter. Zur gleichen Zeit renovierten wir in Leitmeritz ein Haus, das den dortigen Protestanten gehörte, in dem wir die Arbeit der Diakonie aufnehmen wollten. Die Renovierung kostete fünf Millionen Kronen, was damals eine immense Summe war. Einen Großteil bekamen wir von der schweizerischen kirchlichen Stiftung Hex, einen weiteren Teil deckte ein Darlehen der „Jeronymova jednota“, einer Stiftung tschechischer Protestanten. 1992 wechselte ich als Pfarrer von Kuttendorf nach Leitmeritz, und die Diakonie nahm ihre Tätigkeit auf.
Wie haben Sie ermittelt, wer Ihre Klienten sein sollen und was sie brauchen?
Wir waren Feuer und Flamme, aber zugleich entsetzlich uninformiert, eigentlich völlig dumm. Wir schufen Räumlichkeiten, wählten eine Frau Direktorin und eine Frau, die sich um die Finanzen kümmerte, das waren die ersten beiden Angestellten … und wir gingen zur Stadtverwaltung, aufs Sozialamt, um zu fragen, wem wir also helfen könnten. Dort dachten sie eingehend nach und meinten dann, am besten wäre wohl ein Klub für Rollstuhlfahrer. Wir schrieben alle Rollstuhlfahrer des Bezirks Leitmeritz an, und niemand reagierte! Sich in Leitmeritz zu treffen, war wohl das Letzte, wonach sich die Rollstuhlfahrer sehnten. Wir begannen unsere Arbeit stattdessen mit Krisenprävention. Unter den Kommunisten galt, dass sich der Staat immer um Menschen in Not kümmerte: Er schickte sie in eine Anstalt oder ins Gefängnis. Das galt nun nicht mehr länger, und auf einmal tauchten Obdachlose auf den Straßen auf. So haben wir diesen geholfen. Allmählich lief es wie von selbst darauf hinaus, dass die Hauptgruppe der Klienten der Leitmeritzer Diakonie geistig Behinderte wurden. Wir haben auch eine Asylunterkunft für Mütter mit Kindern. Und geschützte Werkstätten, wo eher körperlich Behinderte arbeiten.
Von wem haben Sie in der Anfangszeit der Diakonie gelernt?
Wir sammelten im Westen Erfahrungen in verschiedenen Einrichtungen, kirchlichen und nichtkirchlichen. Ich lernte dabei vor allem, dass wir über unsere Arbeit auch reden können müssen, dass wir Gelegenheiten finden müssen, sie zu propagieren. Dabei spielt eine konkrete Geschichte eine Rolle. Im Jahre 1997 wurde die Tschechische Republik zum ersten Mal von einem großen Hochwasser getroffen, wie es sich seit Jahrzehnten nicht ereignet hatte. Als soziale Organisation beteiligte sich die Diakonie an der Hochwasserhilfe eher symbolisch. Unsere Kirche aber rief zu einer Sammlung auf und erzielte eine Million Kronen. Wir übergaben aber dann das ganze Geld der Organisation Adra, einer bekannten und während der Flut sehr aktiven humanitären Hilfsorganisation.
Was hat das mit der Werbung für die Diakonie zu tun?
Darüber klärte uns der damalige Chef der holländischen Stiftung Wilde Ganzen auf, als wir ihn besuchten. Wir hatten ihm von unserem Vorgehen während des Hochwassers erzählt, wir wollten damit prahlen, wie geschickt wir gewesen seien. Seine Reaktion hat uns ordentlich überrascht – er wurde richtig ärgerlich, er hat uns regelrecht angeschrien. Was hätten wir angeblich getan? Eine einzigartige Chance vergeben! Durch die Hochwasserhilfe hätte sich unsere Diakonie wie nie zuvor bemerkbar machen können! Wie sei es möglich, dass wir das nicht begriffen hatten?
In Holland haben Sie also Schimpfe gekriegt.
Uns kam das damals wie eine unzulässige Denkart vor. Aber mit der Zeit mussten wir erkennen, dass sie berechtigt war. Damit ein Mensch für seine Arbeit Unterstützung bekommt, muss er auf sich aufmerksam machen. Die Belehrung aus Holland hat uns beim zweiten Hochwasser im Jahr 2002 immens geholfen. Wir kamen auch in engen Kontakt mit der Katastrophenhilfe, der humanitären Hilfsorganisation der deutschen Diakonie. In Deutschland kam bei Sammlungen für die Fluthilfe mehr zusammen, als gebraucht wurde, und 40 Millionen Kronen widmeten sie uns. Die Leitmeritzer Diakonie war auch im nahen Theresienstadt (Terezín) tätig, so konnten wir dort jetzt Häuser renovieren und die Dienste der Diakonie ausweiten. Bis heute sind wir dafür ausgesprochen dankbar.
Wie hat sich die Diakonie in den Anfängen entwickelt? Als Vorsitzender des damaligen Vorstands der gesamten Diakonie konnten Sie das ja sehr detailliert verfolgen.
Es war richtig, dass wir rechtzeitig begonnen hatten und uns trotz der riesigen Unerfahrenheit einige grundlegende Dinge überlegt hatten. Dank dem haben wir uns unter den neuen Voraussetzungen nach der Revolution schnell etabliert, der Staat rechnete mit uns. Mithilfe des ersten Direktors der Diakonie, Karel Schwarz, gelang es immer, Zuschüsse für unsere Aktivität zu gewinnen, und die Diakonie wuchs relativ schnell. Schmerzvoll war – vornehmlich für uns Leute aus der Kirche – dass unser Bemühen um die Diakonie in der Kirche selbst aneckte. Für uns war völlig klar, dass die Kirche diakonische Arbeit tun sollte. Und es überraschte uns, dass das nicht für alle so klar ist. Wir begegneten Misstrauen, das für uns unverständlich war. Die Leute unterschätzten die Tatsache, dass die Diakonie, was die Finanzen betrifft, im Vergleich zur Kirche ganz woanders stand. Die Kirche war wirklich arm, sie sparte jede Krone. Im Gegensatz dazu wurden in der Diakonie Millionenbeträge bewegt. Das erregte wohl eine gewisse Eifersucht. Sie abzubauen dauerte lange.
Aber es gelang?
Heute ist ‒ so meine ich ‒ klarer, dass die Diakonie nicht mit der Kirche konkurriert, im Gegenteil. Dank der Diakonie ist die Kirche sichtbarer, und auch die Nichtgläubigen verstehen besser, worum es in der Kirche geht. Als ich Anfang der neunziger Jahre nach Leitmeritz kam, war die evangelische Gemeinde dort winzig. Sie bestand aus fünfzehn Leuten und schrumpfte noch weiter. Heute sind wir so um die vierzig Leute, in der Gemeinde ist einiges los, wir haben da Kinder, die Gemeinde wurde lebendig. Die Stadt weiß, dass es die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder gibt.
Adam Šůra
Die Diakonie ist die Nummer eins im Förderschulwesen
Fünfzehn Schulen und über vierhundert Schüler – im Förderschulwesen ist die Diakonie der EKBB in der Tschechischen Republik auf dem Spitzenplatz. Aber es geht ja nicht nur um die Anzahl. Die Schulen der Diakonie gelangten auch dadurch auf den ersten Platz, dass sie für Kinder mit schwersten Formen von gesundheitlicher Einschränkung offen sind, einschließlich des niedrigfunktionalen Autismus. In zwei Fällen, nämlich in Merklín bei Pilsen und in Prag, bietet die Diakonie den Schülern unter der Woche außerdem die Unterbringung in Internaten an. In den Förderschulen der Diakonie gehen wir davon aus, dass jeder unserer Schüler einzigartig ist. Der eine sitzt ordentlich in der Bank, der zweite muss sich ständig bewegen, der nächste ist so empfindlich, dass ihn selbst eine winzige Abweichung von der eingeführten Ordnung unkontrollierbar erschüttert: Es löst solch ein Geschrei aus, dass es durch die ganze Schule hallt. Allerdings ist klar, dass auch Menschen mit schwersten Behinderungen zu Bildung fähig sind. Sie müssen nicht gleich lesen und schreiben lernen. Fortschritte lassen sich auch darin machen, wie man Hunger, ein Unruhegefühl oder die Sehnsucht nach Gesellschaft verständlich zum Ausdruck bringt. Für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen ist das keine Kleinigkeit, sondern ein grundlegender Schritt nach vorn. Wir verlassen uns dabei auf Fachkenntnis, Erfahrung und auch den guten Willen unserer Pädagogen. Und auch auf den individuellen Zugang, also wenige Schüler pro Klasse. Unsere Schulen sind recht familiär. Darauf stützen wir uns in der Diakonie.
Bedeutende Momente im Jahr 2018
Die Diakonie Vsetín eröffnete das funkelnagelneue Seniorenheim Vyhlídka (Aussicht). Die wohnliche Atmosphäre des Heims und der durchdacht gestaltete Garten trugen sicher dazu bei, dass die Diakonie Vsetín beim nationalen Preis „Neziskovka roku“ („Gemeinnützige Organisation des Jahres“) den zweiten Platz belegt hat.
Die Anzahl der Gaststätten und Cafés der Diakonie, wo Menschen mit Behinderung arbeiten, ist um ein Café im historischen Zentrum von Kolín gewachsen. Die Diakonie in Valašské Meziříčí hat eine Pralinenfabrik eröffnet. Auch dort sind die Angestellten Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen.
Gleich sieben Mitarbeiter der Diakonie wurden mit dem Nationalen Preis für die besten Mitarbeiter sozialer Dienste ausgezeichnet. Den Hauptpreis gewannen zwei von ihnen: Karel Novák, der Direktor der Diakonie Rolnička in Soběslav, und die Sozialarbeiterin Helena Hingarová von der Diakonie Leitmeritz, die überdies verdientermaßen Medienstar der Diakonie wurde.
Die gesamtstaatliche, vorweihnachtliche Sammlung der Diakonie „Krabice od bot“ („Schuhkarton“) brach alle Rekorde. Für die Kinder der ärmsten Familien in der ganzen Tschechischen Republik wurden 38 822 Geschenke gesammelt. Dieser Sammlung schloss sich auch eine größere Zahl von Gemeinden der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder an.
Besonders in den Gemeinden der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder wurde auch die „Fastensammlung“ durchgeführt. Der Erlös von 1,1 Millionen Kronen floss in die Errichtung eines Spielplatzes und eines kommunalen Zentrums im Flüchtlingslager im jordanischen Zátarí.
Des 25. Jahrestages ihrer Gründung gedachten die Zentren in Brno, Soběslav, Rýmařov und Valašské Meziříčí. Die Diakonie beteiligte sich auch gern und aktiv an der Hundertjahrfeier der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder.
Adam Šůra
China, Vietnam, Brasilien, Singapur. Eine Sonderschule in Michle unterrichtet auch ausländische Kinder
Es ist ein nasskalter Novembervormittag und in der Sonderschule im Prager Stadtteil Michle beginnt ein neuer Schultag. Es wird ganz gewöhnlicher Schultag sein, das zeichnet sich schon auf der Straße vor der Schule ab. Aus den parkenden Autos steigen ungefähr acht Chinesen und gehen hinein. Was hat es damit auf sich?
Internationale Schule
Diese Bezeichnung weckt meistens die Vorstellung einer besseren, oftmals privaten, Bildungsinstitution, in die ambitionierte Eltern ihre Sprösslinge schicken, weil sie davon ausgehen, dass sie den idealen Start für eine steile Karriere bietet. Von der Schule in Michle kann man so etwas nicht erwarten. Ihre Schüler haben Autismus oder eine so genannte Mehrfachbehinderung. Trotzdem ist die Schule in Michle auch international. Die Leitung scheut sich nicht auch Kinder aus dem Ausland aufzunehmen. Dies ist natürlich keine allgemein selbstverständliche Praxis.
Das schwierigste an der Arbeit mit den Kindern, die angeborene Behinderungen haben, ist die Kommunikation. Welche Art der Sprache wählt man, wenn sie wenigstens zu einem grundlegenden Verständnis führen soll? Natürlich gibt es durchdachte und bewährte Methoden, die der Lehrer lernt und die sehr hilfreich sind – zum Beispiel die Kommunikation mit Bildtafeln, Darstellungen der wichtigsten Abläufe in der Schule an diesem Tag. Mit den Schülern wird so abgesprochen, dass sie zuerst lernen gehen, es dann eine Pause gibt, dann Pausenbrot, dann nochmal Unterricht, dann Mittagessen und danach den Heimweg. Auf der anderen Seite ist klar, dass jeder Schüler einzigartig ist, in seinem Wesen genauso wie auf seinem Weg des Verstehens.
Und wenn zur Hürde, die durch die Behinderung entsteht, noch die einer fremden Sprache und eines anderen kulturellen Codes kommt, weil man z. B. asiatische Eltern hat? Das ist dann schon eine Nuss, die es zu knacken gilt. Deshalb lehnen die meisten tschechischen Sonderschulen Kinder aus dem Ausland, vor allem aus dem außereuropäischen, ab.
Die Diakonieschule in Michle tut dies aber nicht. Zwischen den größtenteils tschechischen Kindern, finden sich Schüler mit Eltern aus China, Vietnam, Brasilien und Singapur. Den Lehrern und Assistenten der Schule bereitet dies mehr Arbeit, aber auch mehr Freude. Im November sorgte der Vater des dreizehnjährigen Jii Liang für eine solche Freude.
Ein Bild und das Lächeln chinesischer Freunde
Herr Tu Shao Hua arbeitet seit Langem in der Tschechischen Republik zum Thema Tourismus zwischen Tschechien und China. Er hatte einen Einfall, wie er der Schule dafür danken kann, dass sie seinem Sohn mit Downsyndrom eine besondere Ausbildung ermöglicht. Er entschloss sich zu etwas Ungewöhnlichem: Er lud einen Maler aus China ein, einen guten Bekannten von Herrn Tu. Er widmet der Schule ein Bild, das er direkt in ihren Räumlichkeiten malt. Mehr Informationen von Herrn Tu gab es zunächst nicht. Trotzdem wurde ein Termin festgelegt, dann wurde in der Schule Kaffee gekocht, sie bereiteten kleine Erfrischungen vor und warteten.
Der Vormittag mit dem Maler, Herrn Zhao Wei, wurde schließlich rundum großartig. Es wurde ein sehr freundliches Treffen, mit viel Lächeln, welches nicht nur die Sprachbarriere, sondern auch alle weiteren Hindernisse überwand. Herr Zhao gestaltete mit Ölfarben, Pinseln und einer gewöhnlichen Gabel ein buntes abstraktes Bild vor den Augen der Schüler. Und die Mitglieder seiner zahlreichen Gefolgschaft brachten für die Schüler der Schule noch viel mehr Geschenke mit.
Die Besucher sprachen viel darüber, dass es eine weitere Zusammenarbeit geben soll und sie die Schule weiter unterstützen wollen. Das Bild trocknet nun an der Wand des Schulleiters und wahrscheinlich wird es Teil einiger Benefizauktionen werden. Herr Tu, der das Ganze organisiert hat, wirkt ganz zufrieden.
Adam Šůra
DIE EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT DER KARLSUNIVERSITÄT IN PRAG (ETF UK)
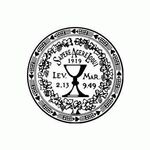 P.O. Box 529, Černá 9,
P.O. Box 529, Černá 9,
CZ 115 55 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 221 988 211; Fax: (+ 420) 221 988 215
E-Mail: intl@etf.cuni.cz
Internet: http://web.etf.cuni.cz/ETFENG-1.html
Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Karlsuniversität (ETF UK) ist die Nachfolgerin der Jan-Hus- Fakultät (1919–1950) und der Comenius-Fakultät (1950–1990). Im Jahr 1990 wurde sie in die Karlsuniversität eingegliedert. Die Verwaltung der Fakultät wird vom Dekan und dem Team der Prodekane geleitet, die auf vier Jahre in ihr Amt gewählt werden. Die Fakultät bietet Bakkalaureats- und Master-Studiengänge an – in evangelischer Theologie, Diakonie (Seelsorge und Sozialarbeit), ökumenische Studien, und verschiedene theologische Bereiche auf Doktoranden-Ebene. Die Fakultät ist ökumenisch für alle offen. Pfarrerinnen und Pfarrer der EKBB erhalten hier ihre Ausbildung.
Gedanken einer Studentin, die von weit her nach Prag kam
Jedes Jahr verbringen etwa zwanzig bis dreißig Studierende aus dem Ausland ein Jahr oder ein Semester an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Prag, wo ihnen eine Reihe von Veranstaltungen auf Englisch zur Verfügung steht. Hier folgen ein paar Gedanken von einer von ihnen – einer Studentin vom Columbia Theological Seminary in den USA.
Ich wusste nicht recht, was ich von meinem Semester in Prag erwarten sollte. Freunde von zu Hause hatten mir erzählt, das sei die schönste Stadt Europas, und sie sorgten dafür, dass ich das Wort pivo kannte. Aber ich wusste nicht, wie mein Leben als Austauschstudentin an der Evangelischen Fakultät der Karlsuniversität wirklich sein würde. Ich war erleichtert und erfreut zu erkennen, dass das Leben in Prag reicher und schöner war, als ich es mir je erträumt hatte.
Mein Kommilitone aus Amerika, Keith Thompson, und ich erlebten drei Jahreszeiten in der Tschechischen Republik – das Ende des warmen und wunderschönen Sommers, der in den knackig-frischen Herbst überging, und schließlich den kalten, verschneiten Winter. So, wie sich die Jahreszeiten wandelten, so änderten sich auch unser Wissen, unsere Beziehungen und Erfahrungen. Ich war hin und weg von der Schönheit der Tschechischen Republik, aber das ist nicht das Erste, was mir einfällt, wenn ich an meine Zeit in Prag zurückdenke. Ich erinnere mich besonders an die Geschichten, die ich hören durfte – von Professoren, Bekannten, Freunden. Zum ersten Mal hörte ich davon, wie es war, die Samtene Revolution zu erleben, die religiösen Praktiken der Nation zu verändern, und ich sah, auf welche Weise sich die Folgen der beiden Weltkriege nicht nur im Landschaftsbild von ganz Europa niedergeschlagen hatten, sondern in den Familiengeschichten fast jedes einzelnen, den ich traf. Am Gedenktag zum Ende des Zweiten Weltkrieges waren wir zu einem interkonfessionellen, internationalen Gottesdienst von Tschechen, Deutschen, Briten und mindestens zwei Amerikanern eingeladen. Als wir gemeinsam sangen, staunte ich über die unglaubliche Tragweite der Geschichte, sichtbar in diesem Altarraum. Vor hundert Jahren hatten unsere Vorfahren gegeneinander Krieg geführt, einer mit dem anderen, und doch standen wir heute hier zusammen und feierten gemeinsam Gottesdienst.
Durch meinen Aufenthalt in Prag wurde in mir eine große Liebe zu Mitteleuropa geweckt (das, wie ich schnell gelernt habe, nicht zu verwechseln ist mit „Osteuropa“!) und, zu meiner Überraschung, auch eine große Liebe zu meinem eigenen Land. Die vielen Studenten aus der ganzen Welt, mit denen ich hier gemeinsam studierte, kamen zu dem gleichen Schluss: Im Ausland zu leben, hilft uns, unser eigenes Zuhause mit neuen Augen zu sehen. Nachdem ich fünf Monate fern von Amerika gelebt hatte, konnte ich mit einer neuen Perspektive, mit neuen Ideen und einer Fülle von Geschichten nach Hause zurückkehren, die ich nie vergessen werde. Ich bin so dankbar für meine Zeit in Prag, und ich weiß, dass ich eines Tages in dieses wunderschöne Land zurückkehren werde, das ich einst mein Zuhause nennen durfte.
Laura Nile
Anfang diesen Jahres verließ uns unser langjähriger Kollege Prof. Milan Balabán
Milan Balabán wurde am 3. September 1929 in Boratyn, in der heutigen Westukraine, geboren. Sein Vater war dort Geistlicher der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) bei den wolhynischen Tschechen. In den Jahren 1948-1952 studierte Milan Balabán an der theologischen Comenius- Fakultät, der heutigen Evangelisch-Theologischen Fakultät der Karlsuniversität Prag.
Zwischen 1952 und 1974 war er anfangs Vikar, später Pfarrer in den Gemeinden der EKBB in Šenov, Strmilov, Semtěš bei Čáslav und in Prag-Radotín. Im Jahr 1969 absolvierte er ein Postgraduierten-Studium am Ökumenischen Institut in Château de Bossey in der Schweiz.
Er war Mitglied der Gruppe, die im Rahmen der tschechischen ökumenischen Bibelübersetzung am Alten Testament arbeitete. 1974 wurde er auf staatliches Geheiß aus dem Dienst als Geistlicher entlassen und war bis 1990 Arbeiter. In dieser Zeit organisierte er illegal Weiterbildungen, einschließlich weiterführender Studien in Theologie über die Universität Cambridge, im Selbstverlag wurden einige seiner Werke und Gedichtbände veröffentlicht, die nach dem Ende des kommunistischen Regimes von renommierten Verlagen herausgegeben wurden.
Als Pfarrer ohne staatliche Genehmigung gründete er in Prag ein alttestamentliches Seminar und nahm auch an Untergrundseminaren in Zusammenarbeit mit Milan Machovec, Egon Bondy, Radim Palouš und weiteren bekannten Dissidenten teil.
Im Jahr 1990 wurde ihm für seine Arbeit CH-R-Š im Alten Testament, vorgelegt bereits 1972, die Doktorwürde in Theologie verliehen. 1993 habilitierte er sich mit der Arbeit „Glaube- oder Schicksal?“, 1995 wurde er zum Professor der Karlsuniversität ernannt.
Im Oktober 2002 erhielt er von Václav Havel eine staatliche Auszeichnung für seine Verdienste um die Tschechische Republik.
Sein ganzes Leben beschäftigte er sich mit der hebräischen Gedankenwelt und der Phänomenologie des Glaubens. Als Dichter untersuchte er die phänomenologische Qualität tschechischer und ausländischer Gedichte. Studenten und Kollegen an der Evangelisch- Theologischen Fakultät kannten ihn als herzlichen und witzigen Pädagogen, klugen Freund, originellen Denker und großen Dichter.
Milan Balabán starb am 4. Januar 2019 in Libice nad Cidlinou.
Pavel Hošek
