Bulletin 45 – Advent 2018
Der Leitartikel
Liebe Leser,
Die Jahre, die mit einer Acht enden, sind in europäischem oder sogar globalem Maßstab von Bedeutung. In der tschechischen Geschichte gibt es viele einschneidende Achter-Jahre und sie werden 2018 besonders bedacht.
50 Jahre trennen uns vom 1968, das mit dem vielversprechenden Prager Frühling begann und mit dessen totaler Umkehrung durch die Besetzung der Warschauer-Pakt-Armeen endete. Und an einen weiteren fünfzigsten Jahrestag wollen wir erinnern, auch wenn er nicht mehr 1968 betrifft – im Januar 1969 hat sich vor dem Nationalmuseum, am oberen Ende des Wenzelsplatzes der Student Jan Palach selbst verbrannt und wollte mit dieser Tat die tschechische Nation aus ihrer Lethargie, die sich nach der sowjetischen Besetzung breit gemacht hatte, aufrütteln.
Schließlich etwas Hoffnungsvolleres – es gibt ein einhundertjähriges Jubiläum und hierzu gibt es wirklich etwas zu feiern! Das Ende des ersten Weltkriegs, aber auch die Gründung der Tschechoslowakischen Republik, für die besonders der Name des ersten Präsidenten Tomáš Garrigue Masaryk steht, und 100 Jahre Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder. Einen Artikel zum Jubiläum unserer Kirche finden Sie in dieser Ausgabe der Evangelischen Nachrichten aus Tschechien an erster Stelle.
Es gilt aber auch, was unser Synodalsenior in seiner Predigt zum Jubiläum bei den Feierlichkeiten in Pardubice gesagt hat: „Was sind schon hundert Jahre?“. Es wird Advent. Möge die Botschaft von Weihnachten uns stärken und Hoffnung geben. In der oft so geschäftigen Weihnachtszeit wollen wir nicht vergessen, wo wir Unterstützung und Freude finden, wo die Quelle des Friedens ist, der höher ist als alle Vernunft.
Mit besten Wünschen
Jana Plíšková
DIE EVANGELISCHE KIRCHE DER BÖHMISCHEN BRÜDER
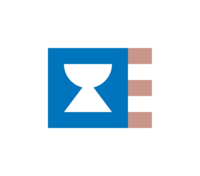 P.O. Box 466, Jungmannova 9,
P.O. Box 466, Jungmannova 9,
CZ 111 21 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 224 999 215(216); Fax: (+ 420) 224 999 219
E-Mail: ekumena@e-cirkev.cz
Internet: www.e-cirkev.cz
Die Grundlagen der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) wurzeln in der Utraquistischen Kirche (1431–1620) und in der Brüderunität ((1457–1620). Die EKBB entstand in ihrer heutigen Gestalt im Jahr 1918 durch den Zusammenschluss der bis dahin selbständigen evangelischen Kirchen Augsburger und Helvetischen Bekenntnisses. Deren Existenz wurde nach dem Ende der harten Gegenreformation, die von 1620 bis zum Erlass des Toleranzpatens durch Kaiser Joself II. im Jahr 1781 dauerte, erlaubt. Die strengen Beschränkungen mussten die Evangelischen freilich auch danach beachten, bis zum Erlass des Protestantenpatentes im Jahr 1861.
In der Zeit ihrer Entstehung hatte die EKBB 250 000 Mitglieder, im Jahre 1938 waren es dann schon 325 000 Mitglieder. Heute ist die Kirche in 14 Seniorate aufgeteilt mit einer Gesamtzahl von 250 Gemeinden und ca. 80 000 Gemeindegliedern. Die Kirche wird vom sechsköpfigen Synodalrat geleitet, der auf sechs Jahre gewählt wird. Repräsentiert wird die Kirche vom Synodalsenior und vom Synodalkurator.
1918-2018: Hundert Jahre - Jubiläum der Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder
Im Jahr 1918 war Österreich-Ungarn ein Pulverfass, das kurz davor war, in die Luft zu gehen. Die politischen und staatsrechtlichen Veränderungen führten in Böhmen zur Abtrennung vom Wiener Kirchenrecht. Die tschechischen Protestanten spürten die Gunst der Stunde und begannen mit den innerkirchlichen Verhandlungen. Die angestrebte Vereinigung der zwei größten evangelischen Kirchen, der lutherischen (Augsburger Bekenntnis) und der reformierten Kirche (helvetisches Bekenntnis), war Inhalt der Verhandlungen. In der Euphorie über den Zerfall Österreich-Ungarns und zusammen mit den Vorzeichen eines freien tschechischen Staates lösten sich alle theologischen und politischen Bedenken, die einer Vereinigung vorher im Wege gestanden hatten, auf.
Schon am 16. Mai 1917 trafen sich die Vorstehenden der tschechischen Protestanten. Nach den Referaten von Josef Souček und Josef Hromádka wurde folgender Beschluss verfasst: „Die tschechischen Protestanten fühlen eine lebendige Sehnsucht danach, eine selbstständige tschechische nationale evangelische Kirche zu gründen, auf Spuren und Basis der böhmischen Reformation, dass die gegenwärtigen, geschichtlich gewachsenen, tschechischen Kirchen eine Einheit bilden.“
Großes Interesse an einem Anschluss an diese neue Kirche äußerten auch einige Tausend Tschechisch sprechende Protestanten in Schlesien, die sich von der Vereinigung mit der tschechischen Kirche eine Befreiung vom nationalistischen Druck versprachen, dem sie sich als Minderheit in den polnischen und deutschen Gemeinden ausgesetzt sahen.
Mit der Gründung der Tschechoslowakei am 28.10.1918 begann die Neuorganisation der evangelischen Kirchen und ihr Zentralausschuss beschloss die Einberufung einer allgemeinen Kirchenversammlung, welche feierlich die Vereinigung der beiden Kirchen auf der Basis des Böhmischen und des Brüderischen Bekenntnisses erklärte.
Die konstituierende Generalversammlung wurde am Dienstag, den 17.12.1918 um neun Uhr im Smetana-Saal im Prager Repräsentationshaus Obecní dům abgehalten. In den Reden, die nacheinander von den Vorstehenden beider Konfessionen gehalten wurden, kann man heute das Pathos der Stunde nachempfinden: gesprochen wurde von „tiefer Dankbarkeit“ für die „Befreiung der Nation“, Tomáš Garrigue Masaryk, der erste Präsident der Tschechoslowakei wurde als Instrument von Gottes Gerechtigkeit bezeichnet. Außerdem wurden die protestantischen Ideale gepriesen: Demokratie, Freiheit und Verantwortung. Die Abschlussresolution lasen Ferdinand Hrejsa und Antonín Frinta: die evangelischen Kirchen augsburgerischen und helvetischen Bekenntnisses sind vereinigt.
Schon einige Jahre vor der Gründung der EKBB war unter den Theologiestudenten der Gedanke gewachsen, in Prag ein Religions- und Kulturzentrum zu gründen, und dieses mit dem Namen von Jan Hus zu verbinden. Der Gedanke sollte zum 500. Jahrestag der Verbrennung von Jan Hus im Jahre 1915 umgesetzt werden.
Ab dem Jahr 1902 schaute man sich nach einem Haus zum Kauf um. Am günstigsten zeigte sich im Jahre 1912 schließlich ein zweistöckiges Haus in der Jungmannova-Straße, im Zentrum Prags. Die Zeit drängte, bis zu den Hus-Feierlichkeiten, bei der man das Hus-Haus eröffnen wollte, blieben nur noch drei Jahre. Obwohl das Haus nun gekauft war, konnte es die Kirche nicht sofort vollständig beziehen. Es wohnten noch Mieter dort und für die verabredeten Zwecke gab es nicht genug Platz. Zum Haus aber gehörte ein weiträumiger Innenhof. Auf dem sollte dann das wirkliche Hus-Haus gebaut werden.
Im Oktober 1918 wurde neben einem Saal für 200 Personen, eine Bibliothek mit einem Lesesaal eingerichtet. Dort hatte die sogenannte „Konstanzer Vereinigung“ ihren Sitz, die die Zeitschrift „Konstanzer Funken“ herausgab. Nach der Vereinigung der evangelischen Kirchen am Ende des Jahres 1918 zogen der Synodal-Ausschuss und seine Unterabteilungen ins Haus. Im Juni 1923 begann man mit dem Anbau.
Gemäß den Plänen des Architekten Bohumir Kozák baute man auf das ursprüngliche Haus drei weitere Stockwerke und vereinheitlichte die Fassade zur Straße hin. Dort wurde auch eine Hus-Statue von Ladislav Kofránek angebracht wurde, ein Bibelrelief und ein Lamm mit einem Schriftzug. Das vordere Gebäude des Hus-Hauses wurde am 1. Mai 1924 feierlich eröffnet. Über die Baustelle für das Hof-Gebäude wurde im Jahr 1934 entschieden. Man wählte wieder den Architekten B. Kozák. Der Neubau im Hof wurde feierlich am 14.3.1937 eröffnet.
Die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum
Ein Kirchen-Festival mit Konzerten, Diskussionen, Theateraufführungen, Filmen und auch mit Zeit für Stille und Gebet fand in Pardubice vom 27.-30. September 2018 statt. Bei den Feierlichkeiten zum 100. Gründungstag der Kirche der Böhmischen Brüder kamen alle Generationen zusammen.
Schon am Freitag standen die unterschiedlichsten Angebote auf dem Programm: Gespräche über Gott und den Glauben, über das Gemeindeleben, die Rolle der Kirche in der Gesellschaft, über Minderheiten, Migration oder kirchliche Sozialarbeit. Die ernsten Themen wurden von Konzerten, Filmen und Workshops aufgelockert. Es gab auch ein interessantes Angebot für Kinder.
Der Hauptpunkt der Feierlichkeiten war der große Festgottesdienst am 29. September auf offener Bühne. Der Synodalsenior der EKBB, Daniel Ženatý, leitete den Gottesdienst, der life im Tschechischen Fernsehen übertragen wurde.
Das Programm am Samstag wurde dann an vier verschiedenen Orten in Pardubice fortgesetzt. Es wurden dort Konzerte, Vorträge, Ausstellungen, Workshops, Filme oder Morgenandachten und Abendgebete angeboten. Die Diakonie der EKBB stellte ihre Projekte vor, auch die evangelischen Schulen präsentierten sich. Das Kammerorchester des Konservatoriums der Evangelischen Akademie in Olomouc begleitete die morgendlichen Gottesdienste und spielte am Nachmittag ein Konzert im Park.
Die Feierlichkeiten in Pardubice waren die größte und öffentlichkeitswirksamste Veranstaltung zum 100-jährigen Jubiläum der EKBB dar. Es nahmen evangelische Kirchenmitglieder aus der gesamten Republik teil. Auch Interessierte aus der nichtkirchlichen Öffentlichkeit und ökumenische Gäste aus Tschechien und dem Ausland waren gekommen. Experten schätzen, dass etwa 2000-3000 Menschen teilgenommen haben. Bei dieser Gelegenheit gab die EKBB auch etliche Publikationen heraus.
Das Erinnern an das Jubiläum der EKBB in diesem Jahr geht noch weiter. Eine internationale Konferenz im Senat des tschechischen Parlaments und eine feierliche Versammlung der EKBB im Smetana-Saal des Prager Repräsentationshauses, also an dem Ort, an dem die Kirche vor 100 Jahren gegründet wurde, sind für Mitte Dezember geplant. Heute ist die EKBB die größte nicht-katholische Kirche in der Tschechischen Republik. Berühmte Evangelische waren Präsident T. G. Masaryk, Milada Horáková und Jan Palach.
Adéla Rozbořilová, Daniela Ženatá
Künftige Zusammenarbeit mit dem Prager Flughafen
Der Prager Flughafen hat eine Zusammenarbeit mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen im Bereich der Seelsorge auf den Weg gebracht. Bei außergewöhnlichen Situationen soll es Reisenden, Angehörigen und Angestellten fortan möglich sein, mit Seelsorgern zu sprechen. Gedacht wurde dabei an Naturkatastrophen, Unfälle und Terroranschläge.
Der Dienst eines Seelsorgers soll im Krisenfall allen Personen, egal welchen Bekenntnisses, zur Verfügung stehen. Den Vertrag zur Flughafenseelsorge unterschieben Václav Řehoř, Vorstandsvorsitzender des Internationalen Václav-Havel-Flughafens in Prag und Daniel Ženatý, Vorsitzender des Ökumenischen Rats der Kirchen, sowie Petr Jan Vinš, dessen Generalsekretär.
„Die geistliche Unterstützung ergänzt den Dienst der Psychologen, die wir bereits für solche Fälle im Team haben. Auch wenn dieser Krisenfall natürlich die größte Ausnahme darstellt, müssen wir darauf gut vorbereitet sein. Die Zusammenarbeit mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen versichert uns, dass unsere Reisenden und Angestellten in jeglicher Hinsicht gut betreut sind“, meint Václav Řehoř.
Jiří Hofman
Film und Diskussionsabende zum Thema „berühmte Protestanten“
Im selben Jahr, in dem die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder ihr Jubiläum feiert, gedenkt auch die Tschechische Republik des Falls der österreichisch-ungarischen Monarchie und der Entstehung unserer unabhängigen Republik vor hundert Jahren. Die tschechischen Protestanten sind mit der modernen Geschichte des Landes signifikant verbunden und das von Anfang an. Bis heute sind sie manche von ihnen bekannt als markante Staatsmänner, Denker, Menschenrechtsaktivisten oder Gegner des kommunistischen Regimes.
An drei Herbstabenden konnten sich die Besucher der Václav-Havel-Bibliothek im Zentrum Prags an diese Persönlichkeiten erinnern. Sie waren eingeladen zu drei Filmabenden und anschließender Diskussion mit Gästen.
Der erste tschechoslowakische Präsident Tomáš Garrigue Masaryk wurde im September durch einen Dokumentarfilm und einzigartige hundert Jahre alte Aufnahmen aus dem Nationalen Filmarchiv vorgestellt. Über Masaryks evangelischen Glauben, seine Beziehung zur Familie und auch dessen Universitätstätigkeit sprach anschließend Michal Stehlík, der stellvertretende Direktor des Nationalmuseums.
Während des Treffens im Oktober konnten die Besucher einige authentische Aufnahmen des konstruierten politischen Prozesses gegen Milada Horáková sehen. Die Vertreter des kommunistischen Regimes beschuldigten sie im Jahre 1950 fälschlich des Hochverrats und verurteilten sie in einem manipulierten Gerichtsverfahren vor den Objektiven propagandistischer Kameras zum Tode. Die tapfere Protestantin Milada Horáková wurde zum Symbol des Widerstands gegen die Totalität der regierenden Kommunistischen Partei und auch zum Beispiel für unglaublichen persönlichen Mut und Kampf für die Wahrheit. An dem Abend erzählte die Historikerin Dana Musilová mehr über sie.
Im November gedachten die Teilnehmer des jungen Philosophiestudenten Jan Palach, der sich im Januar 1969 aus Protest gegen die sowjetische Okkupation der Tschechoslowakei selbst verbrannte. Seine Beerdigung wurde zu einer nationalen Manifestation und 20 Jahre später setzte die sogenannte Palach-Woche eine Welle von Demonstrationen in Gang, die ihren Höhepunkt in der bekannten Samtenen Revolution fanden. An Palach wurde in einem neuen abendfüllenden Film erinnert, der unter anderem auch in seiner Heimatkirche gedreht wurde. Der jetzige Synodalsenior der EKBB, Daniel Ženatý nahm darin die Rolle des damaligen Pfarrers von Palach, Jakub S. Trojan, ein. An der Diskussion nahmen der Hauptdarsteller des Films Viktor Zavadil und der Historiker Jakub Jareš teil.
Alle drei Film- und Diskussionsabende stießen auf reges Interesse; im Saal blieb nie ein Platz frei und die Besucherzahl aller drei Abende ging gegen Vierhundert.
Jiří Hofman
Zwei nagelneue Schulen entstehen, die dritte ist in Planung
Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder ist Trägerin von sechs Schulen, die siebte, eine Grundschule in Brünn ist in Planung. Wir sind stolz auf das Konservatorium in Olomouc und die fähigen Absolventen der Sanitätsschule, der Mittel- und Fachhochschulen mit sozialem Schwerpunkt und mit Freude beobachten wir die Kinder der Brüderschule, die bislang die einzige Grundschule war. Das besondere an unseren Schulen ist ihre familiäre Atmosphäre, aber auch die Art, wie sie mit schwierigen Schülern umgehen. Zugleich werden sie bei Evaluationen als erfolgreich bewertet und die Absolventen finden größtenteils leicht eine Anstellung. Im Meer des tschechischen Schulsystems sind das nur ein paar Tropfen, aber wir sind dankbar für dieses Steinchen im Mosaik der Bildung. Zwei unserer Schulen bemühen sich schon seit einigen Jahren die Anzahl an Schülern erhöhen zu können und ihre Arbeit in neuen Schulgebäuden fortführen zu können, die den Anforderungen modernen Unterrichtens entsprechen. Die Anzahl der Neuanmeldungen an den evangelischen Schulen übersteigt deren derzeitige Aufnahmekapazitäten.
Evangelische Akademie Prag
Aufgrund eines Beschlusses der Synode, durch den der Bau für die Evangelische Akademie Prag genehmigt wurde, bekräftigete der Synodalrat das Interesse am Kauf eines passenden Grundstücks in Prag-Modřany. Ein architektonischer Entwurf wurde erarbeitet und nach vielen Verhandlungen eine Baugenehmigung erreicht. Die Bauabnahme des neuen Schulgebäudes ist für Ende 2019 angesetzt.
Brüderschule
Die Kirchenleitung verhandelte auch über den Bau eines neuen Schulgebäudes für die Brüderschule in der Nähe des derzeitigen Schulstandortes in Prag- Holešovice. Wenn alles nach Plan verläuft, wird die Schule zur weiterführenden Schule ausgebaut und auch eine Turnhalle und einen Speisesaal erhalten. Während der diesjährigen Tagung der Synode kamen Kinder der Brüderschule nach Litomyšl, um sich den Einwohnern und den Mitgliedern der Synode vorzustellen, welche diesesmal dort stattfand. In den Klostergärten führten sie ein fröhliches Programm vor, welches zeigte, dass mehr Platz zum Lernen gebraucht wird, dass damit auch mehr Platz für die Entwicklung der Schüler ist und letztlich dies der Gesamtgesellschaft nützt.
So finanzieren wir die beiden Schulen
Die Synode genehmigte den Finanzierungsplan für die Gebäude beider Schulen. Neben den Mitteln aus dem Verkauf des Gebäudes der Theologischen Fakultät, rechnet der Plan auch mit Mitteln aus dem Diakonie- und Gemeindeentwicklungsprogramm, die zusammen mit einer angemessenen Miete dazu dienen sollen, das kircheninterne Darlehen schrittweise zurückzuzahlen. Außerdem sollen Fundraising und Benefizveranstaltungen einen deutlichen Beitrag leisten.
Zweite Grundschule Filipka in Brno geplant
Momentan in Planung und Vorbereitung ist noch eine zweite Grundschule in der zweitgrößten tschechischen Stadt – in Brünn. Eine Gruppe engagierter Lehrkräfte hat die ministerielle Erlaubnis erhalten und nach den notwendigen Reparaturen an dem gemieteten Schulgebäude sollen im September 2019 zunächst die Klassen der Grundstufe beginnen.
Wir hoffen, dass all unsere Schulen noch mehr zu Zentren des gemeinschaftlichen Lebens und gesellschaftlicher Aktivitäten werden und den guten Namen der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder an ihre Mitbürger weitertragen.
Daniela Ženatá
Partnerschaften und Partner
Seit vielen Jahren schon sind Gemeinden der EKBB mit Gemeinden anderer Kirchen in Partnerschaft verbunden. Es gibt Partner in den Niederlanden (früher waren sie dort besonders zahlreich), in der Schweiz, in Deutschland, in Schottland und in den Vereinigten Staaten von Amerika. (Möglicherweise habe ich auch die einen oder anderen übersehen!)
Diese Partnerschaften sind sehr facettenreich, und jede einzelne ist anders. Manche entstanden aus einer persönlichen Freundschaft zwischen Geistlichen heraus; manche führten zum Austausch von musikalischen Fähigkeiten und Begeisterung; manche legten ihren Schwerpunkt auf Hilfe bei verschiedenen Sommerlagern. Viele zogen gegenseitige Besuche nach sich, eine Chance, um bewusster in die Schuhe eines anderen zu schlüpfen, die Wege eines anderen zu gehen, eine Reihe anderer Bräuche kennenzulernen, und dabei vielleicht auch eine etwas andere Art des Denkens oder eine andere Art, den Glauben auszuüben. Gelegentlich – besonders vielleicht in der Vergangenheit – führte die Partnerschaft zu finanzieller Hilfe für ein bestimmtes Projekt.
Es gab eine Zeit in Schottland, wo ich herkomme, zu der die Menschen ihre Stadt niemals verließen, außer es fand ein Gemeindeausflug statt. Eine Gemeinde, in der Mary und ich Mitglieder waren, kann sich an Tage erinnern, als für solch eine Spritztour nicht ein Bus, sondern ein ganzer Zug angeheuert wurde, damit Leute, die sonst nie irgendwohin fuhren, ihre Horizonte erweitern konnten – und sei es nur um ein paar Meilen.
Das mag einst für Gemeindepartnerschaften gegolten haben: Sie boten Gelegenheiten zu reisen, da die Menschen das auf eine andere Art und Weise nicht bewerkstelligen konnten; heute reisen vielleicht mehr Leute mehr als je zuvor auf eigene Faust. Das könnte uns zu dem Gedanken verleiten, dass die Tage von Partnerschaften gezählt sind, dass sie nicht mehr nötig sind. Wie dem auch sei: sie sind immer noch nötig (und dafür könnte man so oder so argumentieren), sie sind noch immer ein wichtiger Teil unseres Gemeindelebens.
Die Wahrheit ist, dass wir auch jetzt noch davon profitieren, dass wir einst unsere Horizonte erweitert haben; die Kirche profitiert immer noch von Treffen, die ihre Mitglieder auf neue Wege führen. Denn es stimmt ja immer noch, dass wir selbst, unsere Gemeinden und unsere Kirchen von diesen Treffen mit anderen Christen aus anderen Teilen von Gottes Welt bereichert werden.
Während also manche Partnerschaften zu Ende gehen, da Partnerschaften selten ewig dauern, werden wieder neue geschlossen. Manchmal entstehen sie, weil einzelne Menschen die Vision haben, andere zu treffen, und andere dafür begeistern. Manche neuen Partnerschaften werden auf höchster Ebene geschlossen, so ist die EKBB nun etwa mit der LaCrosse-Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Amerika (ELCA) verbunden.
Der Senior unserer Synode, Daniel Ženatý, besuchte in diesem Jahr die Vereinigten Staaten, gemeinsam mit Oliver Engelhardt, dem Leiter der Abteilung für Ökumene und internationale Beziehungen, und Štěpán Brodský von der Diakonie. Sie unterzeichneten dort formal ein Abkommen mit der LaCrosse-Synode. Und Daniel Ženatý fuhr noch weiter, besuchte die Generalversammlung der Presbyterianischen Kirche in den USA (PCUSA) und machte außerdem Station in Texas, wo neue Kontakte geknüpft und neue Möglichkeiten ausgelotet wurden. Es gibt heute hier bei uns Gemeinden, die solche Möglichkeiten suchen, und es gibt Gemeinden anderswo (in Texas, Schottland oder im Rheinland), die neue Freunde bei uns finden wollen.
Nächsten April wird in Atlanta die letzte in einer Reihe von Partnerschaftskonferenzen zwischen der EKBB und der PCUSA stattfinden. Das ist eine Chance, alte Freundschaften zu erneuern und neue Wege zu erforschen, eine Gelegenheit zu bekräftigen und aufzufrischen, zu hinterfragen und vielleicht sogar zu ändern. Mindestens zwölf Vertreter der EKBB werden voraussichtlich daran teilnehmen. Zu den beiden „ursprünglichen“ Kirchen werden diesmal einige andere stoßen – von der ELCA und möglicherweise auch die Kirche von Schottland.
Das Dach dieses Abkommens ist ein großes Dach, und die Teilhabe an einer Partnerschaft ist eine sich ausweitende Wirklichkeit. In den Worten eines amerikanischen Spirituals: „There’s room for many a more.“
David Sinclair
Was Freiheit kostet. 50. Jahrestag der Selbstverbrennung Jan Palachs
Aus Protest gegen die allgemeine Apathie, welche in der Tschechoslowakei Einzug nahm, nachdem die Armeen der Warschauer-Pakt-Staaten sie okkupiert hatten, verbrannte sich am 16. Januar 1969 der junge Student Jan Palach in aller Öffentlichkeit auf dem Wenzelsplatz vor dem Nationalmuseum.
Seine Tat erweckte eine allgemeine Welle der Solidarität und bürgerschaftlicher Aktivität, an seiner Beerdigung nahmen hunderttausende Menschen teil. In den folgenden zwanzig Jahre kommunistischer Diktatur, war sein Todestag das Symbol für den Kampf um Freiheit und Demokratie. Die Proteste erreichten ein halbes Jahr vor dem Fall des Kommunismus ihren Höhenpunkt, sieben Tage lang protestierten tausende Menschen im Januar 1989 auf dem Wenzelsplatz.
Zum Gedächtnis an Jan Palach rufen bis heute alle demokratisch ausgerichteten Organisationen und Individuen auf. Wir sind stolz darauf, dass Jan Palach in seinem Leben nicht nur mit der Karlsuniversität verbunden war, sondern auch mit der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder.
Ondřej Lukáš
Petr Kratochvíl in den Vorstand der Konferenz Europäischer Kirchen berufen
Auf der Vollversammlung der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) im Juni wurde ein neuer Präsident gewählt – die Wahl fiel auf den evangelischen Pfarrer Christian Krieger aus dem Elsass. Der Vorstand (Governing Board) hat einen tschechischen Neuzugang – Petr Kratochvíl von der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder, einer kleinen Diasporakirche.
Bei der Wahl werden regionale und konfessionelle Gesichtspunkte in Betracht gezogen, die Satzung verlangt, dass mindestens ein Viertel der Mitglieder aus orthodoxen oder orientalischen Kirchen kommen. Bei der Aufstellung der Kandidaten wird auch an die Vertretung von Frauen, der Jugend und Laien gedacht.
Für seine fünfjährigen Amtszeit hat sich der neue Präsident Christian Krieger zwei Ziele gesteckt: „Das erste Ziel ist es, die Gemeinschaft zwischen den Kirchen in Europa weiter auszubauen. Ich will den Dialog untereinander stärken und zu diesem mehr Gelegenheit in unseren gemeinsam Sitzungen bieten. Das zweite Ziel ist dann das Zeugnis der Kirchen in Europa und für Europa. Damit geht ein größeres Engagement in sozialen Fragen, in Sachen wirtschaftlicher Gerechtigkeit, der Fürsorge für Migranten und anderen Themen einher“, erklärte er bei seiner Kandidaturvorstellung.
Unter den siebzehn gewählten Mitgliedern des Vorstands befindet sich auch ein Tscheche: Prof. Petr Kratochvíl von der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder, welcher von allen sechs tschechischen Kirchen, die Mitglieder der KEK sind, gemeinsam nominiert wurde. Er ist beruflich als Direktor des Instituts für Internationale Beziehungen tätig.
Zum Ersatzmann wurde dann auch Dr. theol. Petr Jan Vinš von der altkatholischen Kirche gewählt, derzeitiger Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen in der Tschechischen Republik.
Pressemeldung des Ökumenischen Rats der Kirchen in der Tschechischen Republik
Gott hat den Fremdling lieb
Jesus als Flüchtling. Die Migranten Sarah und Abraham. Josef in den Händen von Menschenhändlern. Die Wirtschaftsmigrantin Ruth. Gott als Gast. Und was ist mit denen, die heute auf dem Weg, auf der Flucht oder in einem fremden Land sind?
Das sind die Bilder, die uns die Ausstellung „Gott hat den Fremdling lieb“ vor Augen stellt. Ihre primäre Aufgabe ist es, die biblische Auffassung von Gastfreundschaft zu präsentieren – die Liebe zu den Kommenden, Gästen und Ausländern (philoxenia). Sie fragt nach unserer Beziehung zu den Menschen auf der Flucht und den Menschen, die Asyl suchen, und als Begründung zieht sie biblische Texte heran, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Sie erzählt Geschichten verschiedener biblischer Figuren und beschreibt ihre Erfahrungen auf dem Weg, weit weg von der Heimat, die Erfahrungen des Fremdseins. In welchem Licht sieht die Schrift Ausländer, Solidarität oder Gastfreundschaft? Sollen wir Fremde willkommen heißen oder nur tolerieren? Sie zu unseren Gästen machen oder ihnen nur zum Überleben helfen? Menschen auf der Flucht sind zwar nicht mehr in den Schlagzeilen präsent, aber sie sind nicht vor den Mauern Europas und seiner Staaten verschwunden. Sie suchen immer noch ihren Platz zum Leben. Die Ausstellung zeigt: wenn wir die (oft missbrauchte) Wortverbindung „christliche Werte“ ernst nehmen, dann gehört freundliche Aufmerksamkeit gegenüber Ausländern, besonders denen in Not, ganz gewiss dazu.
Inspiration bei den Nachbarn in Österreich
Die EKBB bereitete die Ausstellung zusammen mit der Österreichischen Bibelgesellschaft, mit Hilfe des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und des Gustav-Adolf-Werk e.V. vor. Außer in Deutschland wurde die Ausstellung auch in Ungarn, Rumänien und Frankreich gezeigt, ursprünglich kommt sie aber aus Österreich. Hier wurde sie schon im Jahr 2012 von der Österreichischen Bibelgesellschaft geschaffen, die sie der EKBB kostenlos für eine tschechische Adaptation zur Verfügung gestellt hat.
Die Ausstellung hat die Form von zwölf großformatigen Plakaten (80 x 200 cm). Jedes Plakat beinhaltet Fotos, Bilder und Bibelverse zum Thema und einen Text auf deutsch und tschechisch, der die biblische Erfahrung des Ausländerseins thematisiert. Vom ersten bis zum letzten Plakat legt der Besucher symbolisch einen ganzen Weg zurück – von der Entscheidung, die Heimat zu verlassen, über leidvolle Wanderschaft bis hin zu den Problemen, die mit der Ankunft in einer neuen Umgebung verbunden sind.
Ab Oktober wandert die Ausstellung zwischen den einzelnen Gemeinden der EKBB und wird auch Schulen und anderen Interessenten aus der ganzen Republik zur Verfügung gestellt. Sie will eine christliche Stimme in die tschechische öffentliche Diskussion einbringen. In einer Situation, in der wir täglich mit ablehnenden Meinungen politischer Repräsentanten und schnellen Lösungen nach dem Grundsatz Null Toleranz konfrontiert sind, sollten wir als Christen die Schwerpunkte und Herausforderungen, die der Bibel entspringen, hören und öffentlich machen.
Die Vernissage der Ausstellung fand am 26. September in der Kirchengemeinde Prag-Střešovice statt und bei dieser Gelegenheit gab es auch eine Diskussion mit Menschen, die selbst mit Migration und Flüchtlingen Erfahrungen haben.
Den Abend begleiteten einige Musiker aus Syrien und Usbekistan und eine willkommene Bereicherung waren auch die typischen ausländischen Spezialitäten: ukrainischer Borschtsch, gefüllte Piroggen oder Gebäck nach irakischer Rezeptur. Alles wurde von Ausländern vorbereitet, die in der hiesigen Gemeinde der EKBB früher einen Zufluchtsort gefunden haben und nach und nach zu Mitgliedern oder Freunden geworden sind.
Der Synodalrat veröffentlichte im Juli 2018 zur Situation der Flüchtlinge in der Tschechischen Republik eine Stellungnahme, in der er seine Besorgnis über die Haltung der tschechischen Regierung zum Ausdruck brachte. Ganz konkret handelte es sich in diesem Fall um eine Gruppe von 450 Menschen, die in einem Fischerboot nahe dem italienischen Ufer festsaßen. Die tschechische Regierung lehnt nach den Worten ihres Premiers vom Juli diesen Jahres den dringenden Antrag der italienischen Regierung ab und wird keinem der Migranten helfen. In der Stellungnahme des Synodalrates heißt es:
„Mit ihrer ablehnenden Position verrät die Tschechische Republik die Grundsätze der zivilisierten Welt, zu der sie gehören möchte und die u.a. in der Tradition und auf den Werten des christlichen Glaubens steht. Wir sind überzeugt, dass unser Staat fähig ist, in Zusammenarbeit mit anderen europäischen Partnern und Institutionen effektiv gegen Wirtschaftsmigration und organisierten Menschenhandel vorzugehen. Gleichzeitig vertrauen wir den staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und glauben, dass unsere Gesellschaft über genug Selbstvertrauen, moralische Kraft und effektive Mechanismen für die Unterstützung der wirklich Hilfsbedürftigen verfügt. Die Worte Jesu von der Hilfe für den Nächsten in Not sind im Evangelium sehr deutlich. Angesichts der lebensbedrohlichen Lage konkreter Menschen dürfen wir nicht achtlos und gleichgültig bleiben.“
Michael Pfann, Jiří Hofman
Pavel Smetana (1937–2018)
Der der ehemalige Synodalsenior der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) Pavel Smetana starb am 4. 10. 2018 im Alter von 81 Jahren.
Pavel Smetana wurde am 14. Juli 1937 in Klokočov geboren. Nach seinem Studium an der Evangelisch-Theologischen Comenius-Fakultät in Prag wurde er im Jahr 1964 in Hošťálková zum Pfarrer ordiniert. Im Jahr 1987 wurde er zum Stellvertreter des Syondalseniors gewählt und folgte im Jahr 1991 Josef Hromádka im Amt des Synodalseniors. Er stand zwei Amtszeiten bis 2003 an der Spitze der EKBB. In den Jahren 1995 bis 2000 war er zugleich Vorsitzender des Ökumenischen Rats der Kirchen in der Tschechischen Republik.
Auf viele Menschen hatte Smetana großen Einfluss, insbesondere auf Menschen in der Ökumene sowie in den deutsch-tschechischen Beziehungen. Daher veröffentlichen wir hier Erinnerungen des langjährigen Ökumene-Referenten der EKBB, Gerhard Frey-Reininghaus:
Wir haben einander Anfang der neunziger Jahre kennengelernt, in einer Zeit, als ich zusammen mit anderen ein neues Gebäude für die Evangelisch-theologische Fakultät der Karlsuniversität suchte. Ich half Dekan Jakub Trojan in der Kommunikation zunächst mit deutschen Kirchen und diakonischen Einrichtungen und nach und nach auch mit der Ökumene in Europa, in den USA und Südkorea. Von Anfang war Pavel Smetana für die Fakultät der wichtigste kirchliche Partner. Sehr freundschaftlich empfing er die Partner aus dem Ausland und unterstützte die Bemühungen, ein neues Gebäude zu finden, das den Anforderungen der immer größeren Zahl von Studierenden gerecht wurde. Als sich schließlich ein geeignetes Gebäude in der Černá Gasse fand, war klar, dass die Frage der Finanzierung von der Kirche gelöst werden musste, da die Kirchen im Ausland nur Kirchen unterstützen konnten und nicht staatliche Institutionen. Für den Synodalrat war dies eine sehr schwere Entscheidung, weil die benötigten finanziellen Mittel bis jetzt nur zum Teil zur Verfügung standen. So war es klar, dass die Kirche sich verschulden musste. Dies war ein großes Dilemma und Pavel Smetana wusste, dass sein Wort in dieser Sache entscheidend war. Er hatte viele schwere Nächte und schlussendlich waren es sein Glaube an Gott und die Unterstützung der Freunde, dass er dem Kauf zustimmte.
Die Versöhnung zwischen Tschechen und Deutschen war für Pavel Smetana eine Herzensangelegenheit und er tat viel für die Versöhnung mit großer Demut und Aufrichtigkeit. Die erste wichtige gemeinsame Erfahrung war für mich der tschechisch-deutsche Gottesdienst in der Kirche St. Martin in der Mauer zum 50. Jahrestag des Endes des 2. Weltkriegs im Mai 1995. Eine wichtige Rolle spielte die bemerkenswerte Erklärung des Synodalrates zum Thema der Aussiedlung der Sudentendeutschen nach dem Krieg. Sie wurde vom Beratungsausschuss des Synodalrates für gesellschaftliche und internationale Angelegenheiten vorbereitet und widmete sich der gesamten Geschichte von Tschechen und Deutschen in den Böhmischen Ländern. Die Erklärung endet mit der Feststellung, dass nach allem, was sich während des Krieges und danach ereignete, es nötig ist, Schuld zu bekennen, wo wir uns verschuldet haben, um Vergebung zu bitten und einen neuen Anfang zu machen auf der Grundlage von Gottes Vergebung und Gnade. Dies war auch die Überzeugung von Pavel Smetana, und auf dieser Grundlage lebte und handelte er. Sehr deutlich erinnere ich mich zum Beispiel an ein sehr bemerkenswertes Gespräch, sehr offen und aufrichtig, das Pavel Smetana im Jahr 1996 in Bad Alexandersbad mit Sudetendeutschen führte. Freundlich und mit Demut, aber auch sehr klar setzte er sich mit den harten Fragen der Sudetendeutschen auseinander, die vorher wohl nie so mit einem Tschechen gesprochen haben. Im Dezember 2000 erhielt Pavel Smetana für seine Verdienste für die Versöhnung und sein Engagement für gute tschechisch-deutschen Beziehungen das große Verdienstkreuz des Bundesverdienstordens aus den Händen des deutschen Botschafters in der Tschechischen Republik Hagen Graf Lambsdorff. Im Jahr 2002 wurde ihm von Präsident Václav Havel der Masaryk-Orden verliehen.
Pavel Smetana hat die Beziehungen mit den Kirchen in Deutschland sehr gerne gepflegt. Er hat gerne in Deutschland gepredigt und hat immer wieder den Dialog gepflegt über die Vergangenheit, die Gegenwart und Zukunft nicht nur in den tschechisch-deutschen Beziehungen, aber auch in den Fragen des Glaubens, der Mission und der Bedeutung des Evangeliums für die heutige Welt. Er sprach gut Deutsch und vermochte es, sich auch in schwierigen Fragen gut auszudrücken. Er unterstützte sehr die Arbeit der tschechisch-deutschen Kommission von EKBB und EKD, die ihre Arbeit im Jahr 1996 aufgenommen hat und 1999 mit dem Buch „Der trennende Zaun ist abgebrochen“ beendet hat. Auf der Grundlage der Anregung von Pavel Smetana auf der EKD-Synode im Jahr 2003 in Trier wurde eine weitere Arbeitsgruppe von EKBB und EKD eingerichtet, und zwar zum Thema der sexuellen Ausbeutung von Frauen und Kindern im Grenzbereich. Diese Arbeitsgruppe arbeitete einige Jahre und hat eine tschechisch-deutsche Erklärung zum Thema vorberietet, die von den Synoden der EKD, der EKBB und der evangelischen Kirchen in Österreich angenommen wurde.
Pavel Smetana hat sich auch in der Stiftung „Memento Lidice“ engagiert, die den Bau des Hauses „Oaza“ in Lidice vorbereitet und realisiert hat, ein Ort für Begegnung, Gottesdienst, Seminare und Wohnraum für Senioren. Im November 2018 sind es schon 20 Jahre, dass dieses Haus der Versöhnung eröffnet wurde. Pavel Smetana war der geistliche Vater dieses Projektes, zusammen mit dem römisch-katholischen Bischof František Radkovský und Pfarrer Dr. Ernst Uhl aus Bremen.
Der irdische Weg von Pavel Smetana ist zu seinem Ende gekommen, doch seine Spuren bleiben im Herzen und Glauben von vielen, auch bei mir.
Gerhard Frey-Reininghaus
DIE DIAKONIE DER EKBB
 Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Tel: (+ 420) 242 487 811 (812); Fax: (+420) 242 487 834
E-mail: info@diakonie.cz
Internet: www.diakonie.cz
Die Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) ist eine gemeinnützige christliche Organisation, die Hilfe und Unterstützung anbietet für ein würdiges und vollwertiges Leben, auch wenn es durch Alter, Krankheit, gesundheitliche Behinderungen, Isolation, schwierige soziale Situationen und andere Lebenskrisen beeinträchtigt ist. Die Dienste der Diakonie der EKBB erfolgen auf der Grundlage der Botschaft des Evangeliums von der Liebe Gottes und nach dem Vorbild des Dienstes Jesu Christi. In ihren Zentren und Spezial-Schulen bietet die Diakonie soziale, gesundheitliche, Bildungs- und Seelsorgedienste an. Unter den nicht-staatlichen Organisationen, die soziale Dienste anbieten, ist die Diakonie der EKBB die zweitgrösste Institution.
Erfolgreiche Spendenaktion der Diakonie. Für Geflüchtete, denen die Diakonie hilft, gibt die Kirche eine Millionen Kronen
In der diesjährigen Osterausgabe des Ökumenischen Bulletins haben wir über die Projekte der Diakonie im jordanischen Flüchtlingslager Zaatari berichtet. In den Gemeinden der EKBB hat zu der Zeit die Fasten-Spendenaktion stattgefunden, die Menschen in diesem Flüchtlingslager zugute kommen soll. Der Ertrag summierte sich auch dank der Partner in den USA (Diaconia Connections) auf eine Millionen tschechische Kronen (etwa 40 000 €). Mit Hilfe dieser Spendenaktion ist es möglich, das Zentrum der Diakonie „Friedens-Oase“ auszubauen. Die Menschen, die im Flüchtlingslager leben, haben damit einen Rückzugsraum für Treffen bekommen, sowie einen Ort wo konkrete Hilfsprogramme angeboten werden können, die die Diakonie mit anderen Organisationen betreut. Zusätzlich wird für die Kinder ein neuer Spielplatz mit Schaukeln, Rutsche und einem Klettergerüst gebaut, der zum Schutz vor der brenndenden Sonne extra mit einem Schattensegel überspannt ist.
Die Diakonie macht Menschen mit Einschränkungen und Alkoholdemenz fit für die Arbeitswelt
Die Diakonie in Valašské Meziříčí, Osttschechien, betreibt zwei Bekleidungsgeschäfte und eine Reinigungsfirma. Diesen Herbst kam noch eine Pralinen-Manufaktur dazu. Die Besonderheit liegt darin, dass Menschen dort arbeiten können, die auf dem regulären Arbeitsmarkt nicht weiter kommen. Meist werden sie dort den Arbeitsansprüchen nicht gerecht, etwa im Hinblick auf das selbstständige Arbeiten. Dabei fehlt ihnen nicht das Geschick oder die Lust zu arbeiten. Wie kann man diesen Menschen helfen, damit sie eine Anstellung erhalten? Diese Frage beschäftigt die Diakonie in Valašské Meziříčí.
Es zeigt sich, dass der größte Schwachpunkt in der Arbeitseinweisung liegt. Im normalen Betrieb gibt es keine Zeit, Menschen die besonderen Arbeitsanforderungen in ihrem Tempo zu zeigen. Es geht darum, geduldig zu erklären, um was sich der Angestellte kümmern soll, und danach ein Auge darauf werfen, ob es klappt. Die Diakonie in Valašské Meziříčí hat darum ein eigenes Arbeitsvorbereitungs-Programm mit dem Namen „Matteo“ entwickelt.
Wir pflanzen - mal sehen, was daraus wird...
Rund zehn Menschen bewegen sich über die Waldlichtung. Sie sammeln alte Äste vom Boden und laden sie auf zwei große Haufen ab. Es sind überwiegend Männer, die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Die Mehrheit hat eine Form der sogenannten Alkoholdemenz. Oft versagt ihnen das Kurzzeitgedächtnis, einer hat Schwierigkeit mit der Motorik. Alle leben in Pržno, einem kleinen Ort bei Valašské Meziříčí, in einem betreuten Wohnen. Sie sind in ihrem Alltag auf Hilfe durch Fachpersonal angewiesen, viele Tätigkeiten können sie aber doch selbstständig.
In dem betreuten Wohnen in Pržno hat man darum das neue Angebot der Diakonie „Matteo“ freudig angenommen. Jetzt bereiten sie dort Menschen für die Ausübung einer bestimmten Arbeit vor. Das Programm ermöglicht eine individuelle Anpassung an jeden Klienten im Hinblick auf das, was seine spezifischen Fähigkeiten und Schwierigkeiten sind. Es geht auch darum, herauszufinden, was den Klienten Spaß macht, und was eher nicht, was sie motiviert und was sie abschreckt. Das ist deshalb wichtig, damit die Menschen, die jahrelang nicht gearbeitet haben, im Falle einer künftigen Beschäftigung Erfolg haben.
Der Kurs „Gärtner, Instandhalter“ hat gerade erst begonnen. Irena Šustková, eine ihrer Leiterinnen, die mit den Klienten den ersten Arbeitstag auf der Waldlichtung verbracht hat, lobt die Gruppe. Ein großer Teil der Arbeit ist geschafft. Dann können sie bald zum nächsten Arbeitsschritt gehen: Bäume pflanzen.
An dem ganzen Arbeitsprogramm, das sich aus verschiedenen Kursen zusammensetzt, sollen 25 Menschen teilnehmen, zwölf von ihnen sollen am Ende eine dauerhafte Anstellung finden. Das sind die Bedingungen der Förderung, dank der das ganze Programm erst umgesetzt werden konnte. Bis jetzt haben neun Klienten das Programm absolviert, fünf von ihnen sind auf Arbeitssuche. Zwei Klientinnen werden in der Reinigungsfirma der Diakonie eingelernt. Einer der Absolventen arbeitet bereits als Hilfskoch in dem betreuten Wohnen, in dem er zugleich wohnt. Das Programm ist also auf einem guten Weg.
Adam Šůra
DIE EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT DER KARLSUNIVERSITÄT IN PRAG (ETF UK)
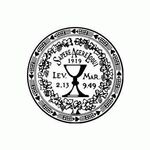 P.O. Box 529, Černá 9,
P.O. Box 529, Černá 9,
CZ 115 55 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 221 988 211; Fax: (+ 420) 221 988 215
E-Mail: intl@etf.cuni.cz
Internet: http://web.etf.cuni.cz/ETFENG-1.html
Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Karlsuniversität (ETF UK) ist die Nachfolgerin der Jan-Hus- Fakultät (1919–1950) und der Comenius-Fakultät (1950–1990). Im Jahr 1990 wurde sie in die Karlsuniversität eingegliedert. Die Verwaltung der Fakultät wird vom Dekan und dem Team der Prodekane geleitet, die auf vier Jahre in ihr Amt gewählt werden. Die Fakultät bietet Bakkalaureats- und Master-Studiengänge an – in evangelischer Theologie, Diakonie (Seelsorge und Sozialarbeit), ökumenische Studien, und verschiedene theologische Bereiche auf Doktoranden-Ebene. Die Fakultät ist ökumenisch für alle offen. Pfarrerinnen und Pfarrer der EKBB erhalten hier ihre Ausbildung.
„Wenn nicht du, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann dann?“, fragt eine rollstuhlfahrende Studentin aus der Republik Moldau
Beim Treffen mit Mariana heute Nachmittag wurde eines sofort ersichtlich: ihr offenes Naturell. Tatsächlich hatten wir gerade begonnen, über Politik zu diskutieren, über ein Thema, das wohl selbst unter guten Bekannten selten zur Sprache kommt. Nach einem köstlichen Gedanken- und Meinungsaustausch erzählte sie mir dann ihre Geschichte.
Mariana Morari ist eine rumänische und moldawische Studentin der Sozialen Arbeit mit Schwerpunkt auf Diakonie und Christliche Soziale Praxis. Sie beendet gerade ihr Grundstudium im gemeinsamen Studienprogramm der Evangelisch-Theologischen Fakultät an der Karlsuniversität, Finnlands Diakonischer Fachhochschule (DIAK) und der diakonischen Organisation Interdiac. Infolge einer Krankheit ist Mariana außerdem Rollstuhlfahrerin und musste schon die eine oder andere Herausforderung meistern, seit sie zum Studium in die Tschechische Republik gekommen ist.
Bei Marianas Entscheidung, in Prag zu studieren, spielte der Zufall eine gewisse Rolle. In der Republik Moldau hatte sie schon einige Jahre im sozialen Bereich gearbeitet, mit geistig und körperlich Behinderten. Unter den Organisationen, für die sie arbeitete, waren Keystone, Alliance of Organizations for People with Disabilities und Motivatie Moldova.
Damals suchte sie nach einem qualitativ hochwertigen Studiengang im selben Bereich und entdeckte zufällig eine Anzeige in den sozialen Medien. Der Studiengang mit Unterrichtssprache Englisch sollte in Tschechien und Finnland stattfinden. Mariana bewarb sich im März 2015, und im Sommer desselben Jahres erhielt sie eine Zusage. Sie bereitete sich auf einen Umzug nach Prag vor.
Dieses Ereignis brachte eine Menge Herausforderungen für Mariana mit sich. In der Republik Moldau lebte sie bei ihren Eltern, in der Tschechischen Republik dagegen musste sie sich an ein eigenständiges Leben gewöhnen. So musste sie etwa einen Job finden, denn ihre Eltern waren leider nicht in der Lage, sie finanziell zu unterstützen. Sie bemerkte, dass Prag keine rollstuhlgerechte Stadt ist. Es dauerte ganze drei Monate, bis sie einen passenden Ort zum Leben gefunden hatte.
Mariana war indes sehr dankbar, als sie bemerkte, dass die Karlsuniversität sie unterstützen würde. So stellte die Fakultät ihr für die ersten drei Tage in Prag eine Unterkunft zur Verfügung, half bei der Orientierung, unterstützte sie finanziell, lieferte allgemeine Informationen. Die finanzielle Unterstützung war ihr besonders willkommen, da ihr Geld gestohlen worden war und sie einen neuen Teilzeitjob finden musste.
Als sie zum ersten Mal am Prager Flughafen ankam, war sie zudem sehr glücklich, einen Freiwilligen zu treffen, den die Karlsuniversität geschickt hatte. Darüber hinaus, so Mariana, war sie angenehm überrascht von der Fürsorge der Evangelisch-Theologischen Fakultät für ihre neuen Studenten. Sie entsinnt sich beispielsweise, wie einmal ein Universitätsangehöriger sie und acht andere Studenten auf der Fahrt mit dem Zug begleitete, der sie zur Hochschule in Český Těšín bringen sollte, mehrere Stunden von Prag entfernt.
Mariana erklärt, sie habe durch die Unterschiede zwischen der Republik Moldau und der Tschechischen Republik viele lustige Situationen erlebt, besonders in Bezug auf die Sprache. Sie, die in der Schule Russisch gelernt hat, erinnert sich an Fälle, in denen gleiche Wörter auf Russisch und auf Tschechisch gegensätzliche Bedeutungen haben konnten. Einmal kochte sie gerade ein moldawisches Gericht, als ein Mitbewohner hereinkam und rief: „To voní!“ Auf Russisch bedeutet der Ausdruck „stinken“, doch angesichts der positiven Körpersprache des Mitbewohners folgerte Mariana, dass es auf Tschechisch „duften“ heißen musste, was tatsächlich stimmt. Sie sagt: „Es ist immer noch schwer für mich, zu jemandem zu sagen: ,To dobře voní.‘ (,Das riecht gut.‘) Ich spüre dann eine Fehlverbindung in meinem Gehirn, das manchmal ganz durcheinander ist und nicht mehr weiß, welche Version ich benutze, die tschechische oder die russische.“
Während des Wintersemesters 2017/2018 nahm Mariana (im Rahmen ihres Studiengangs) an einem Erasmus-Austausch mit Helsinkis DIAK-Fachhochschule teil. Während ihres Aufenthalts kümmerte sie sich um rumänische und bulgarische Bürger in Notsituationen. Durch ihr fließendes Rumänisch und Englisch konnte Mariana speziell in Situationen helfen, in denen Übersetzungen vonnöten waren. Dadurch hatte sie die Gelegenheit, viele Lebensgeschichten kennenzulernen, und ihr wurde bewusst, wie schwer es nicht registrierte EU-Migranten in Finnland haben. Sie wurde wirklich mit schwierigen Situationen konfrontiert und musste sich selbst daran erinnern, dass sie zwar nicht die ganze Welt auf einen Streich ändern konnte, dass es aber wichtig war, dennoch einem Menschen nach dem anderen zu helfen. Mariana fasst ihre Erfahrung durch den Austausch als „herausfordernd und interessant zugleich“ zusammen.
Am Ende fragte ich Mariana, ob sie den Austausch anderen empfehlen würde und welche Botschaft sie für junge Menschen habe, besonders für Menschen mit Behinderungen, die ebenfalls darüber nachdächten, an einem Austausch teilzunehmen, aber noch zögerten. Kurz gesagt meinte Mariana: „Klar, sie sollten das machen, aber es ist nichts für jeden, es ist nicht einfach. Du musst sehr motiviert sein, das zu machen, aber dann wirst du unterwegs eine Menge lernen, und du wirst deine Werte ändern und verstehen, wie wichtig Menschen sind.“ Sie verwies zudem darauf, wie wichtig es sei, ein Land „von innen heraus“ kennenzulernen statt nur über das Fernsehen oder das Internet. Sie rät, „mit den Leuten vor Ort zu sprechen, Sprachen zu lernen, das Land zu sehen“; dadurch werde man begreifen, dass es „keine Unterschiede zwischen den Menschen gibt“. Tatsächlich, sagt sie, wird das neue Land, das du besuchst, „ein bisschen dein eigenes Land werden“.
Mariana glaubt, dass „man die Gelegenheit ergreifen sollte zu reisen, zu studieren und sich selbst weiterzubilden, denn Geld und persönliche Sachen können einem genommen werden, und dann wäre die Bildung das einzige, das einem künftig helfen könnte, die Welt so zu sehen, wie sie ist.“ Marianas Schlussbotschaft, die auf andere Studenten zielt, die mit einem Handicap leben, ist: „Ins Ausland zu gehen, heißt mehr zu sehen. Viele Leute haben Angst und schämen sich, um Unterstützung zu bitten; geh und trau dich!“ Wenn du um Hilfe bittest, kannst du den Studiengang „für dich barrierefrei machen“.
Mit Blick auf das Zaudern und die Unsicherheit der Leute, an einem Austausch teilzunehmen, bemerkt sie: „Wenn nicht du, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann dann?“
Jiří Mrázek als Dekan der Prager Theologischen Fakultät wiedergewählt
Professor Jiří Mrázek wird das Amt des Dekans der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Karlsuniversität (ETF) auch bis 2022 innehaben. Seine erste, vier Jahre währende Amtszeit ging mit dem akademischen Jahr 2017/2018 zu Ende, doch wurde er für eine zweite Amtszeit vom Akademischen Senat der ETF (bestehend aus Vertretern von Studenten und Lehrenden) wiedergewählt und dann offiziell vom Rektor der Karlsuniversität bestätigt.
Jiří Mrázek studierte Theologie an der ETF und in Halle an der Saale. Nach seinem Hochschulabschluss war er fünf Jahre lang als Pfarrer im Dienst der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder tätig. 1990 verteidigte er erfolgreich seine Dissertation über den „Wandel des Messianismus in aramäischen Texten aus Qumran“ sowie 2005 seine Habilitation über „Parabeln im Kontext des Matthäusevangeliums“. Er lehrt seit 1989 an der ETF und ist derzeit Professor und Leiter des Instituts für Neues Testament. In der Vergangenheit war er Prodekan für Entwicklung sowie Prodekan für Forschung und Aufbaustudien.
Bei seiner Aufgabe, die Fakultät zu leiten, wird Dekan Mrázek von folgendem Team unterstützt: Dr. Ladislav Beneš (Prodekan für Studienangelegenheiten), Dr. Petr Gallus (Prodekan für Entwicklung), Professor Martin Prudký (Prodekan für Forschung und Aufbaustudien), Dr. Jan Roskovec (Prodekan für Internationale und Ökumenische Beziehungen), Ing. Eva Svobodová (Schatzmeisterin – administrative und finanzielle Angelegenheiten) und dem früheren Dekan, Professor Jakub Trojan, dem Ehrenmitglied des Teams.
Peter Stephens
Doktorandenstudium an der Evangelisch-Theologischen Fakultät
Schon seit einer Reihe von Jahren ist es möglich, das Doktorandenstudium an der ETF UK nicht nur auf Tschechisch, sondern auch in englischer oder deutscher Sprache zu absolvieren.
Aktuell sind zwei Studienprogramme offen: Theologie und Philosophie. In dem Studiengang Theologie können sich die Studierenden auf eines von drei Studienfächern fokussieren, und zwar auf Biblische Theologie, Historische und Systematische Theologie oder Praktische Theologie. Im Studienprogramm Philosophie konzentrieren sich die Studierenden auf das Fach Religionsphilosophie.
Weitere Informationen erteilen der Prodekan für postgraduale Studien, Prof. ThDr. Martin Prudký (prudky@etf.cuni.cz), die Referentin für das Doktorandenstudium Vladimíra Dubinová (dubinova@etf.cuni.cz ) und die Auslandsabteilung der Fakultät (international@etf.cuni.cz).
Für das Studium in einer Fremdsprache ist eine Gebühr von 25.000 CZK (cca 1 000 Euro) pro Studienjahr zu entrichten.
Anmeldeschluss für das Doktorandenprogramm des Studienjahres 2019/2020 ist der 30. April 2019, (siehe: https://web.etf.cuni.cz/ETFENG-53.html).
Ondřej Lukáš
