Bulletin 44 – Sommer 2018
Der Leitarikel
Liebe Leser,
wie groß ist die Freiheit in der wirtschaftlich boomenden Volksrepublik China? Wir wissen dazu manches und wundern uns nicht, dass Christen aus China fliehen. Ihr Leben ist tatsächlich in Gefahr.
Und es ist auch nicht verwunderlich, dass sie zu uns fliehen, in die freie Tschechische Republik, wo sie Verständnis und freundliche Aufnahme erwarten. Ihre Erwartungen werden enttäuscht, die politischen Verhältnisse in diesem freien Land sind nicht freundlich oder verständnisvoll, jedenfalls nicht gegenüber Migranten. Auch wenn die Mächtigen sich dabei auf den Begriff der christlichen Werte berufen. So verwendet ist der Begriff völlig sinnentleert und nichtssagend.
Und so können Sie in diesen Evangelischen Nachrichten aus Tschechien lesen, wie sich unsere Kirche gegenüber diesen Asylbewerbern verhält. Über den Widerstand der Kubaner gegen ihr Regime haben wir schon früher geschrieben, auch dieses Jahr hat unsere Kirche ihre Solidarität mit den kubanischen Dissidenten zum Ausdruck gebracht. Wir hoffen, dass sie an dem Programm, dass wir für sie in der Václav-Havel-Bibliothek durchgeführt haben, Freude hatten.
Und Ihnen, liebe Freunde, wünschen wir Freude am Sommer. Aber vor allem – halten wir die Freiheit hoch in Ehren, freuen wir uns, wenn wir nicht um sie kämpfen müssen. Sie ist ein hohes Gut.
Mit den besten Wünschen unserer Redaktion
Jana Plíšková
DIE EVANGELISCHE KIRCHE DER BÖHMISCHEN BRÜDER
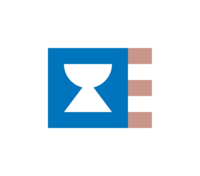 P.O. Box 466, Jungmannova 9,
P.O. Box 466, Jungmannova 9,
CZ 111 21 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 224 999 215(216); Fax: (+ 420) 224 999 219
E-Mail: ekumena@e-cirkev.cz
Internet: www.e-cirkev.cz
Die Grundlagen der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) wurzeln in der Utraquistischen Kirche (1431-1620) und in der Brüderunität ((1457-1620). Die EKBB entstand in ihrer heutigen Gestalt im Jahr 1918 durch den Zusammenschluss der bis dahin selbständigen evangelischen Kirchen Augsburger und Helvetischen Bekenntnisses. Deren Existenz wurde nach dem Ende der harten Gegenreformation, die von 1620 bis zum Erlass des Toleranzpatens durch Kaiser Joself II. im Jahr 1781 dauerte, erlaubt. Die strengen Beschränkungen mussten die Evangelischen freilich auch danach beachten, bis zum Erlass des Protestantenpatentes im Jahr 1861.
In der Zeit ihrer Entstehung hatte die EKBB 250 000 Mitglieder, im Jahre 1938 waren es dann schon 325 000 Mitglieder. Heute ist die Kirche in 14 Seniorate aufgeteilt mit einer Gesamtzahl von 250 Gemeinden und ca. 80 000 Gemeindegliedern. Die Kirche wird vom sechsköpfigen Synodalrat geleitet, der auf sechs Jahre gewählt wird. Repräsentiert wird die Kirche vom Synodalsenior und vom Synodalkurator.
Tagung der Synode
Ungefähr einhundert Delegierte, Berater und Gäste aus der ganzen Republik und aus dem Ausland versammelten sich im Areal des Schloßberges von Litomyšl, um Leben, Leitung und Zukunft der Kirche zu besprechen.
Unsere Schulen
Als eine bahnbrechende Entscheidung kann man sicher die Genehmigung des Baus von zwei neuen Schulen in Prag – in den Stadtbezirken Holešovice und Modřany – ansehen.
Die Kirche knüpft hiermit an die Tradition und den guten Ruf ihres Schulwesens an und erfüllt ihr Vorhaben, einen Teil der Restitutionsgelder in Projekte zu investieren, die der Gesellschaft dienen. Die Bratrská škola (Brüder-Schule) in Prag 7 – bislang Grundschule – ruft schon lange nach einer Erweiterung um höhere Klassenstufen. Unter den Eltern und auch den Delegierten genießt sie einen sehr guten Ruf. Die familiäre Atmosphäre, erstklassige Lehrer und die Werte, die die Schule als ihre Prioritäten ansieht – das alles hat nach knapp dreißigjährigem Bestehen zur Folge, dass die Kapazität ausgeschöpft ist und die Schule den Ruf genießt, eine der besten Einrichtungen zu sein, in die ein Kind kommen kann (und das nicht nur auf dem Gebiet von Prag 7). In einer ähnlichen Situation ist die Evangelische Akademie in Modřany. Beide werden nun erweitert und erhalten neue Gebäude. Die Kirche knüpft damit an die lange und erfolgreiche Tradition des evangelischen Schulwesens an und auch an das ähnlich funktionierende gesellschaftlich anerkannte Werk der Diakonie der EKBB, die neben dem Betrieb einiger Schulen vor allem soziale, gesundheitliche, humanitäre Dienste und Entwicklungsdienste leistet.
Kirchenleitung und Glaubensfragen
Die Teilnehmer der Synode widerriefen eine frühere Verordnung, nach der Kaplane (in Armee, Gefängnissen oder Krankenhäusern) innerhalb ihrer Funktion keine Trauungen durchführen durften. Dieses Recht erhalten sie nun wieder.
Außerdem wurde die Situation der Pfarrer und Presbyter (ehrenamtliche Mitarbeiter) besprochen. Die Synode appelliert an die Kirchenvorstände der einzelnen Gemeinden, in den Fürbitten an ihre Prediger zu denken, achtsamen Gesprächen mit ihnen Zeit zu widmen, ihnen zuzuhören und ihnen Zeit für Bildung, Familie und Erholung zu gewähren.
Gäste aus der tschechischen und ausländischen Ökumene
An der dreitägigen Besprechung der Synode nahmen auch zahlreiche Gäste aus den Reihen der tschechischen und der ausländischen Ökumene teil. Mit ihrem Besuch ehrten uns die Vertreter der Schlesischen Evangelischen Kirche, der Brüderkirche und der Tschechoslowakisch-Hussitischen Kirche, der Presbyterianischen Kirche in Korea, der Protestantischen Kirche in den Niederlanden, der Waldenserkirche in Italien, der Lutherischen Kirche in Polen, der Reformierten Christlichen Kirche der Slowakei, der Lutherischen Kirche in Ungarn, der Reformierten Kirche in Polen, der Vereinigten Protestantischen Kirche Frankreichs und der Schottischen Kirche.
Während des Mittagessens am Samstag grüßte Bruder Bruno Gabrielli, Pfarrer der Waldenserkirche in Italien, die Kirchenleitung der EKBB.
„Ich danke für die Erneuerung der alten, historischen Partnerschaft, die bis ins 15. Jahrhundert reicht. Uns verbindet die Situation kleiner Minderheitskirchen, welche über Jahrhunderte der Verfolgung, Diskriminierung und Verbannung gegen den Untergang ankämpfen. Aber wir verfallen nicht in Panik, wir bemühen uns Gott zu erfreuen und zwischen Säkularismus, religiösem Fanatismus und sogenanntem „begeistertem Atheismus“ auf seinem schmalen Pfad zu gehen. Wir wollen nicht, dass Menschen verfolgt, diskriminiert oder unterdrückt werden, wenn sie gezwungen sind, aus ihrer Heimat vor Krieg, Diktatur oder Hungersnot zu fliehen. Ich danke für eure Unterstützung und den Willen, eure Regierung davon zu überzeugen, die Last der Flüchtlinge, die vom Mittelmeer kommen, mit Italien zusammen zu tragen. Es geht um eine Herausforderung des europäischen Gewissens, diese Angelegenheit müssen alle Kirchen zur Priorität machen und sie auch in ihren Predigten und in ihrer Lehre thematisieren.“
Jiří Hofman
Erklärung des Synodalrats zur Ablehnung der Asylanträge chinesischer Christen
Nur acht chinesische Christen, die in der Tschechischen Republik um internationalen Schutz gebeten haben, bekamen vom Innenministerium Ende Februar einen positiven Asylbescheid. Die Entscheidung über die Anträge, die die Flüchtlinge Anfang des Jahres 2016 gestellt hatten, wurde mehrmals vertagt, 70 Asylanträge wurden schließlich abgelehnt.
Schon im September 2016 schickte der Vorstand des Ökumenischen Rats der Kirchen in der Tschechischen Republik einen Aufruf an die Mitglieder der Regierung mit der Bitte um eine baldige Genehmigung der Asylanträge. Im März 2018 gab der Synodalrat der EKBB diese Erklärung heraus:
„Wir sind dankbar für die acht anerkannten Asyl-Bewerber. Christen werden in der Volksrepublik China wegen ihres Glaubens verfolgt. Bei einer Abschiebung droht den Asylbewerbern Unterdrückung und Verfolgung. Wir wünschen uns, dass alle 70 Asylbewerber in unserem Land bleiben können und ihren Glauben frei leben können, den sie in ihrem eigenen Land nicht praktizieren dürfen.“
Sprecher der abgelehnten Asylbewerber beschlossen gegen den Bescheid gerichtlich vorzugehen. Dass die Asylbewerber aktiv Interesse an der Integration in die Gesellschaft äußern, indem sie Tschechisch lernen, manche von ihnen einer Arbeit nach gehen, zeigt, dass sie nicht als Wirtschaftsflüchtlinge zu uns kommen, und sich hier ein neues Leben aufbauen wollen. Wir danken allen, die den Asylbewerbern helfen. Wir beten für die chinesischen Christen in ihrem und in unserem Land!
Gemeinschaft und Gebet
Ein paar Asylbewerber aus China wandten sich vor zwei Jahren an die Diakonie der EKBB. Sie suchten jemanden, mit dem sie ihren christlichen Glauben teilen könnten und der ihnen in dem neuen Land zur Seite stehe. In China können viele internationale Organisationen z.B. China Aid, Human Right Watch oder Freedom House, die christliche Motivation ihrer Arbeit nicht frei äußern. Die chinesischen Christen nehmen Tschechien als ein demokratisches Land wahr, das ihnen Glaubensfreiheit ermöglicht. Seit der Begegnung in der Diakonie sind viele freundschaftliche Kontakte entstanden. Man trifft sich in Diakoniezentren und in den Kirchengemeinden. Dort lernen sie Tschechisch, viele suchen Arbeit. Zugleich aber nehmen wir wahr, dass sie große Angst vor einer Abschiebung haben.
Eine Andacht für verfolgte Christen in China
Mit dem Entzünden der Kerzen und mit Klängen eines chinesischen Liedes begann die interreligiöse Andacht am 16. März am Denkmal für die Opfer des Kommunismus in Prag am Fuße des Petrin-Bergs. Diese öffentliche Andacht machte auf die Situation der chinesischen Christen aufmerksam, deren Asylanträge abgelehnt wurden, und erinnerte an die Situation weiterer ethnischer und religiöser Minderheiten in China. Die Zahl 70, aus weißen Kerzen geformt, symbolisierte die Anzahl der Menschen, deren Asylanträge nicht bewilligt wurden; Asyl bekamen nur acht von ihnen. Die Zahl war von roten Kerzen umrahmt, in Form eines Herzes.
„Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag.“ Mit diesem biblischen Vers aus Sprüche 3,27 eröffnete der Pfarrer für Minderheiten der EKBB Mikuláš Vymětal die ökumenische Andacht. Pfarrer und Mitglied des Synodalrats Pavel Pokorný lud zum Nachdenken ein. „Wenn China einmal ein freies Land sein wird, und es wird so kommen, werden die Enkel der Zeitzeugen des Totalitarismus fragen: „Wer hat euch geholfen? Was machte das christliche Europa? Was machten die Länder, die selbst am eigenen Leib erlebten, was es heißt, in Unfreiheit zu leben?“ Und die Zeitzeugen werden antworten: „Niemand stand uns bei, sie haben schön von Freiheit und christlichen Werten geredet, aber niemand nahm uns auf.“ Und ihre Stimmen werden bis zu den Ohren unserer Enkel hier dringen und sie werden sich für uns schämen.“
Bei der interreligiösen Andacht sprachen auch Vertreter der jüdischen und der muslimischen Gemeinde und es wurde auf Chinesisch und auf Tschechisch gebetet. Am Ende läuteten die Glocken der nahen katholischen und evangelischen Kirche.
Der Dank der chinesischen Christen
Aus einem Brief:
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind chinesischen Christen, die um Asyl in der Tschechischen Republik bitten. Wir möchten allen danken, die uns helfen, die uns mit Liebe begegnet sind.
Im Februar 2018, als 70 chinesischen Christen den Bescheid über den abgelehnten Asylantrag bekamen, waren wir enttäuscht und unsere Herzen waren voll Angst und Furcht, dass wir nun nach China abgeschoben werden. Aber sofort danach haben wir die Unterstützung vieler Tschechen bekommen. Der Ausdruck der Liebe brennt in uns, hilft uns, damit wir uns nicht fürchten vor der eisigen ablehnenden Entscheidung. Ihr gabt uns das Vertrauen, damit wir weiter gehen können.
„Habt keine Angst, wir werden für euch kämpfen.“, sagten uns freiwillige Mitarbeiter der Diakonie. Also fürchteten wir uns nicht so sehr. Verschiedene Petitionen haben unseren Mut erhöht, in Tschechien zu bleiben, viele Menschen helfen uns leise. Jede Unterstützung und jeder Ausdruck von Zuwendung gibt uns große Kraft. Vor zwei Jahren sind wir in die Tschechische Republik gekommen mit der Sehnsucht nach Demokratie und Freiheit, zugleich waren wir verloren und ängstlich in einem unbekannten Land. Wir danken Gott für seine Rettung, es sind hier so viele gute Menschen, die uns unterstützen. Dank euch sind wir nicht allein und dank euch geben wir nicht einfach auf. Wir danken euch nochmal. Gott segne euch!“
Jana Vondrová, Jiří Hofman
Ein Tag für Kuba 2018. Wir verteidigen Menschenrechte
Ein Land, aus dem die besten Zigarren stammen. Ein Land mit einer wunderbaren Natur. Ein Land, in dem man hinter Gitter kommt, ohne dass man etwas Schlimmes verbrochen hat. Ein Land, in dem man eine staatliche Erlaubnis braucht, um ein Auto zu kaufen. Das alles sind verschiedene Gesichter Kubas.
Der Kuba-Tag, der am 20. März in Prag stattfand, will auf die Menschenrechtsverletzungen aufmerksam machen, nicht nur auf der Insel, sondern auch weltweit.
Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder und die tschechische Organisation „Člověk v tísni“ (Mensch in Not) veranstalteten diesen Tag bereits zu siebten Mal. Das diesjährige Motto lautete: „Wir verteidigen Menschenrechte“.
Den Auftakt machte ein ökumenischer Gottesdient in der Kirche St. Martin in der Mauer. Danach zog die Menschenmenge mit weißen Blumen und weißen Regenschirmen durch die Stadt. An verschiedenen Stellen blieben die Teilnehmenden stehen und legten eine Blume ab, mit Hinweisen zu bestimmten Menschenrechtsverletzungen.
Am Abend ging es in der Václav-Havel-Bibliothek mit einer Podiumsdiskussion weiter. Auf dem Podium saßen Vertreter von Člověk v tísni, dem tschechischen Helsinki-Komitee und Amnesty International, außerdem der ehemalige Präsidentschaftskandidat und Bürgerrechtler Marek Hilšer, sowie Peter Morée von der Evangelisch-Theologischen Fakultät Prag. Die Diskussion wurde moderiert von Jiří Schneider, dem Leiter des Aspen Institute Central Europe, sowie Mitglied im Synodalrat der EKBB.
Die Organisation „Člověk v tísni“ setzt sich bereits seit den 1990er Jahren für Kuba ein. „Wer sich für Menschenrechte engagiert, bringt sich und seine Familie in Gefahr. Einer Reihe von Dissidenten ist es in der letzten Zeit nicht einmal mehr erlaubt, im Land zu reisen, geschweige denn ins Ausland. Und die normale Bevölkerung ist immer mehr polizeilicher Gewalt oder falschen Unterstellungen ausgesetzt. Darum ist es auch heute so dringend notwendig, dass wir über Kuba sprechen und unsere Solidarität mit den Kubanern ausdrücken, weil ihre Rechte mit Füßen getreten werden.“, beschreibt Lucia Argüellová von „Člověk v tísni“ die Situation.
Alles, was auf Kuba unabhängig ist, sei anti-staatlich und wird verfolgt. Es gibt sogar einen Strafbestand, der sich „vorkriminelle Gefahr“ (Schutzhaft) nennt. „Wenn jemand gefährlich aussieht, kann man jemanden auch verhaften, bevor er eine Straftat begangen hat. Es ist extrem einfach, jemanden ins Gefängnis zu bringen.“, fuhr Lucia Argüellová fort.
Es wurde auch über Menschenrechtsverletzungen in den Kriegsgebieten gesprochen, in Syrien und in der Ukraine, oder über die Situation in China, in Tibet, in Russland oder Polen. Auf dem Podium wurde gefragt, welche Rolle beim Verteidigen von Menschenrechten der Zivilgesellschaft und der Diplomatie demokratischer Staaten zukommt, wozu auch die tschechische Diplomatie zählt. Táňa Fischerová, vom tschechischen Helsinki-Komitee meinte: „Wohin unsere aktuelle Außenpolitik abdriftet, ist eine Schande. Nach der Revolution 1989 schlugen wir einen guten Weg ein, unser Land wurde ernst genommen, der Respekt gegenüber der Tschechischen Republik war spürbar, und die Menschen waren dankbar, dass wir etwas für sie getan haben, egal ob auf Kuba, in Belarus, oder in Bosnien. Heute aber geht unser Land in eine Richtung, die uns so nicht gefällt. Der aktuelle Diskurs in den Medien und in der Politik scheint die Sicht auf die allgemeinen Menschenrechte wieder so zu verändern, wie sie zu Zeiten vor 1989 war.“
Mit dem Tag für Kuba wird daran erinnert, dass im März 2003 auf Kuba 75 führende Dissidenten inhaftiert wurden und zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurden. Freigelassen wurden sie vorzeitig im Jahre 2010; die Mehrheit ging unter dem Druck der Regierung ins Exil.
Jana Vondrová
Weltmissionskonferenz in Arusha, Tansania
Die 14. Konferenz über Weltmission und Evangelisation fand vom 8.-13. März 2018 in der Stadt Arusha in Tansania statt. Wie üblich wurde sie von der Kommission für Weltmission und Evangelisation (CWME) des Ökumenischen Rates der Kirchen organisiert und diesmal nahmen über 1000 Delegierte aus protestantischen, orthodoxen, anglikanischen, katholischen und weiteren Kirchen teil. Aus der EKBB nahm der junge Theologe Pavol Bargár daran teil. Wir bringen hier Auszüge aus seinem Bericht:
Nach dem Eröffnungsgottesdienst gab Dr. Mutale Kaunda, eine junge Christin der Pfingstbewegung aus Sambia, durch ihre Rede den Ton der gesamten Konferenz vor, indem sie den Teilnehmern die Frage stellte, wie wir helfen können, sozio-politische und ökonomische Veränderungen in der Gesellschaft zu verwirklichen, zur Beseitigung von Ungleichheit zwischen den Geschlechtern oder zu einer besseren Gesundheitsversorgung für Menschen am Rande der Gesellschaft beizutragen.
Die einzelnen Tage der Konferenz waren thematisch konzipiert und widmeten sich in den frühen Plenarsitzungen der Evangelisation und Mission an der Peripherie der Gesellschaft und der missionarischen Entwicklung. Am Sonntag waren alle Anwesenden zu Gottesdiensten in den Gemeinden der Stadt Arusha und deren Umgebung, sowie in der Region Kilimandscharo eingeladen.
Die letzte Plenarsitzung verabschiedete nach langer Diskussion eine Schlussbotschaft der gesamten Konferenz. Die Moderatorin des Ökumenischen Rates der Kirchen, Agnes Abuom, erinnerte im Anschluss daran, dass wir als Christen zur Nachfolge des Gekreuzigten eingeladen sind und nicht zur Nachfolge derer, die Verantwortung für verschiedene Formen der Kreuzigung gestern und heute unter uns tragen.
Am Abschlusstag der Konferenz brachte Ignatios Mor Afrem II, Patriarch der syrisch-orthodoxen Kirche, eine Botschaft über Leid und Hoffnung aus dem von Krieg gezeichneten Syrien. Sein Schlusswort war gewissermaßen Ein Gegenpol zum Eingangsvortrag von Mutale Kaunda, beide jedoch verband das Thema Mission und christliches Leben an der Peripherie der Gesellschaft, der Hauptakzent der gesamten Konferenz.
Es kann festgehalten werden, dass sich die 14. Konferenz über Weltmission und Evangelisation auf die christliche spirituelle Entwicklung der Nachfolger Jesu Christi konzentrierte, die zu einer positiven Veränderung der Welt aufgerufen sind.
Pavol Bargár, Oliver Engelhardt
Der Ökumenische Rat lehnt die Besteuerung von zurückerstatteten Kirchengütern ab
Der Ökumenische Rat der Kirchen in der Tschechischen Republik hat mit Besorgnis auf Information reagiert, dass das Abgeordnetenhaus des Parlaments der Tschechischen Republik in einer ersten Lesung die Eingabe der Kommunistischen Partei in Böhmen und Mähren für eine Besteuerung der Restitution der Kirchengüter unterstützte.
Die Verlautbarung der Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen vom 21. 11. 2017 sei hier nochmals abgedruckt:
„Die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen gibt bekannt, dass mit der Verabschiedung des Gesetzes Nr. 428/2012 zur Restitution des Kirchenbesitzes und den folgenden abgeschlossenen Verträgen aus Sicht des Ökumenischen Rats der Kirchen die Frage des Eigentumsausgleichs geklärt ist. Die erlangte Einigung war die Folge eines Kompromisses aller beteiligten Seiten und ermöglichte die Erneuerung der Besitzzustände und die unabhängige Stellung der Kirchen. Hinsichtlich ihrer Existenz und ihres Wirkens sind die Kirchen ein unverzichtbares Glied der demokratischen Gesellschaft.“
Zu dieser Verlautbarung steht der Ökumenische Rat der Kirche weiterhin. Als traurige Ironie sieht er, dass diese Eingabe zur Besteuerung gerade zu einer Zeit verhandelt wurde, als des 70. Jahrestages des Kommunistischen Putsches von 1948 und der Opfer des totalitären Regimes gedacht wurde. Gegen jegliche Versuche, kommunistisches Unrecht zu rechtfertigen oder zu minimieren, wird sich der Ökumenische Rat der Kirchen mit allen zur Verfügung stehenden demokratischen Mitteln einsetzen.
Eine neue Partnerschaft
Seit die EKBB 2004 dem Lutherischen Weltbund beigetreten ist, erfahren wir diese Weltgemeinschaft in unterschiedlicher Weise als Bereicherung. Die Verbundenheit war in besonderer Weise beim Reformationsjubiläum im Jahr 2017 zu spüren. Bereits 2016 begannen erste Kontakte mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Amerika (ELCA). Der Kirchenkreis (Synod) aus dem Gebiet von La Crosse in Wisconsin war auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft im mitteleuropäischen Raum. Nach anfänglichem Kennenlernen über Telefongespräche und E-Mails, kam im Juni 2017 eine Delegation der La Crosse Area Synod zum Besuch in die Tschechische Republik. Viele Gespräche und viele Besuche gaben den vier Besuchern einen Eindruck von Geschichte und Gegenwart der EKBB.
In den ersten Juni-Tagen 2018 reiste nun eine kleine Delegation der EKBB zum Gegenbesuch in die USA: Synodalsenior Daniel Ženatý, Ökumenereferent Oliver Engelhardt sowie Štěpán Brodský für die Diakonie der EKBB waren zu Gast im Kirchenkreis La Crosse sowie bei der Kirchenkreissynode.
Wie positioniert sich die Kirche in aktuellen gesellschaftlichen Angelegenheiten, was für ein theologisches Profil hat sie und welche Rolle spielt der Dienst am nächsten (Diakonie). Diese Fragen beschäftigen beide Seiten gegenseitig und wurden mit großer Neugier besprochen – etwa in Workshops während der Synode. Während des Gottesdienstes wurde die neue Partnerschaft dann mit einem Vertrag schriftlich besiegelt. Im Vertrag heißt es u.a. „Auch mit dieser Partnerschaft öffnet Christus uns die Augen, globale Zusammenhänge und Herausforderungen zu sehen“.
Nächste Treffen stehen bereits jetzt fest im Programm: an den Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum der EKBB in der zweiten Jahreshälfte 2018 werden Vertreter der La Crosse Area Synod teilnehmen. Ebenso an einer Partnerschaftskonferenz, die im Frühling 2019 in Atlanta stattfindet, bei der vor allem Vertreter aus den Gemeindepartnerschaften zwischen der EKBB und presbyterianischen Gemeinden in den USA teilnehmen.
In Zeiten, in denen die Politik unserer Länder internationale Verbindungen vor allem nach dem ökonomischen Eigennutz beurteilt, sind kirchliche Verbindungen als Brüder und Schwestern im Glauben und mit der Bereitschaft, die Freuden und Sorgen der anderen ernst zu nehmen, von hohem Wert.
Oliver Engelhardt
Erstes Treffen einer tschechisch-niederländischen Arbeitsgruppe
Am Ostermontag traf sich erstmals eine tschechisch-niederländische Arbeitsgruppe, die sich über drei Jahre dem Thema Säkularisierung widmen wird. Das erste gemeinsame Seminar fand vom 2. - 4. April 2018 in Horní Maršov (Marschendorf) im östlichen Riesengebirge statt, und zwar in den Räumen eines ehemaligen Pfarrhauses, das nach behutsamer Sanierung heute von einem Verein genutzt wird.
Die Gruppe ist auf Grund der Gespräche zwischen Vertretern der Stiftung SKGO (Kerkelijke Gemeendeopbouw Oost-Europa) und Pfarrer Pavel Pokorný entstanden. Die Stiftung SKGO, die aus dem geistigen Erbe Hebe Kohlbrugges erwachsen ist, ist personell mit der Protestantischen Kirche in den Niederlanden verbunden.
Ziel des dreijährigen Seminars ist es, das Thema Säkularisierung systematisch zu bearbeiten. Dabei geht es um die Fragen wie wir Säkularisierung verstehen, wie wir sie reflektieren, welche Erfahrungen es mit deren Folgen auf das kirchliche Leben gibt und welche Vision wir für das kirchliche Leben in einer säkularen Gesellschaft haben.
In Horní Maršov trafen sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe aus den Reihen der Pfarrerschaft der EKBB Daniel Pfann, Jiří Šamšula und Aleš Wrana, aus den Niederlanden kamen die PfarrerInnen Carola Dahmen, Hanneke Allewijn, Martijn van Leerdam und Sijbrand Alleblas. Die Mehrheit von ihnen bringt eigene Erfahrungen als Seelsorger in Krankenhaus, Gefängnis und Schule mit. Zu Beginn des Treffens waren auch Pavel Pokorný sowie die SKGO-Vertreter Ids Smedema und Jan Kraaijeveld anwesend.
Die Teilnehmer der Gruppe hatten in Horní Maršov die Möglichkeit, sich über Erfahrungen und Beispiele der Begegnung mit dem säkularen Umfeld in der kirchlichen Praxis auszutauschen. Man bedachte die Konzeption dieses Projekts und legte weitere Arbeitsschritte fest.
Das nächste Treffen wird 2019 in Holland stattfinden.
Jana Špinarová
Tschechisch-ungarische Diskussionen zur Rolle der Kirche in der Gesellschaft
Leitende Vertreter der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) und der evangelisch-lutherischen Kirche in Ungarn (ELKU) trafen sich Ende Februar in Brünn. Sie sprachen unter anderem über das Schulwesen und die Finanzierung der Kirchen oder über Fragen der nationalen Identität.
In der Eröffnungsandacht rief der Stellvertreter des Synodalseniors der EKBB, Pavel Pokorný, ins Gedächtnis, dass das Treffen in der Fastenzeit stattfindet, die eine Zeit der Läuterung sei und nach dem Propheten Sacharja seien „Götzendienst, Lüge und Täuschung das, was man als unrein ablegen muss“. Der Bischof der ELKU, Tamás Fabiny, sprach in seiner Andacht über Freiheit und Knechtschaft: „Auch in der ersehnten freien Welt kann sich alles in sein Gegenteil verkehren.“
Der Brünner Pfarrer und Senior in Südmähren, Jiří Gruber, stellte den Gästen das evangelische Leben in der Stadt Brünn vor und lud alle zu einer Besichtigung der dortigen Roten Kirche ein, welche die EKBB nach dem Zweiten Weltkrieg von der Deutschen Evangelischen Kirche übernommen hatte. Einen Gruß an die Teilnehmer sprach auch der Rektor der Masaryk-Universität Brno, Mikuláš Bek.
Dass sich beide Kirchen so nahe stehen, ergibt sich aus der protestantischen Geschichte während der Donau-Monarchie und aus dem gemeinsamen Weg beider Länder in der Zeit des Kommunismus. Die Vertreter beider Kirchen besprachen vor allem aktuelle Themen der derzeitigen Lebenssituation. Im Vordergrund standen Fragen der nationalen Identität oder die Rolle der Kirche in der heutigen Gesellschaft. Es wurde auch über das Schulwesen und die Finanzierung der Kirche gesprochen. Schließlich bekräftigten die Teilnehmer ihre gute Zusammenarbeit und waren sich darin einig, dass die inspirierenden Dialoge fortgesetzt werden sollten. Die ungarischen Freunde luden den Synodalrat der EKBB zu einem weiteren Treffen ein, das Anfang des Jahres 2019 im ungarischen Györ stattfinden soll.
Oliver Engelhardt
DIE DIAKONIE DER EKBB
 Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Tel: (+ 420) 242 487 811 (812); Fax: (+420) 242 487 834
E-mail: info@diakonie.cz
Internet: www.diakonie.cz
Die Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) ist eine gemeinnützige christliche Organisation, die Hilfe und Unterstützung anbietet für ein würdiges und vollwertiges Leben, auch wenn es durch Alter, Krankheit, gesundheitliche Behinderungen, Isolation, schwierige soziale Situationen und andere Lebenskrisen beeinträchtigt ist. Die Dienste der Diakonie der EKBB erfolgen auf der Grundlage der Botschaft des Evangeliums von der Liebe Gottes und nach dem Vorbild des Dienstes Jesu Christi. In ihren Zentren und Spezial-Schulen bietet die Diakonie soziale, gesundheitliche, Bildungs- und Seelsorgedienste an. Unter den nicht-staatlichen Organisationen, die soziale Dienste anbieten, ist die Diakonie der EKBB die zweitgrösste Institution.
Roma unter uns. Die Geschichte einer Abiturientin
Ein schüchternes Klopfen ist zu hören. Dann wird die Tür aber ungestüm aufgerissen und zwei kleine Mädchen stürmen herein. Sie stürzen sich auf Andrea und bitten sogleich: „Andy, spielen wir Zucker- Kaffee?“ Andrea Bendíková wird umschlungen und antwortet geschwind: „Aber erst nach dem Nachhilfeunterricht, einverstanden?“ Die Mädchen stimmen zu.
Wir sind in dem diakonischen, niedrigschwelligen Klub Kruháč- zu Deutsch „Kreisverkehr“ in Jablonec nad Nisou (Gablonz). Die achtzehnjährige Andrea hilft den Kindern schon seit einigen Jahren bei den Schulaufgaben. Sie gibt Nachhilfe in Mathe, Tschechisch, Englisch und anderen Fächern, wenn sie gebraucht wird. Nächstes Jahr wird sie ihr Abitur am Wirtschaftsgymnasium machen, wo es ihr gut gefällt.
Als sie sechs Jahre alt war, beschied ihr die pädagogisch-psychologische Beratung eine ganz andere Zukunft. Nach Aussage der Experten, gehöre sie auf eine Sonderschule. Andrea Bendíková ist eine Roma.
Hip-Hop hilft
Schwer zu sagen, was die Mitarbeiter der Beratungsstelle zu dieser Schlussfolgerung kommen ließ. Andrea hatte, als sie klein war, Probleme mit den Nieren und sie kämpfte mit einer Meningokokkeninfektion. Sie war verängstigt und nervös, was sich sicherlich nicht positiv bei der Begutachtung durch die Pädagogen und Psychologen ausgewirkt hat. Ihre Mutter schritt jedoch ein.
Andrea hat zwei ältere Brüder. Beide besuchten eine ganz normale weiterführende Schule. Die Mutter bestimmte resolut, dass, wenn ihre beiden Söhne die Schule geschafft hätten, sie keinen Grund sehe, warum dies nicht auch ihre jüngste Tochter könne. Sie bewegte sich nicht vom Fleck, bis sie ihren Willen durchgesetzt hatte. Andrea erinnert sich, dass ihre Eltern sie nicht weiter in den Kindergarten schicken wollten, in den vorwiegend Romakinder gingen. Vielleicht deshalb, weil sie das Stigma loswerden wollten, dass sie „ungebildet“ seien.
Die ersten Schuljahre waren bitter für Andrea. Lernen fiel ihr leicht, aber sie erinnert sich an Schikanen. Sie kamen sowohl von den weißen, als auch den Roma-Mitschülern, dafür, dass sie dick war, dass sie gut lernte, dass sie Taschengeld von ihren Eltern und Lob von den Lehrern bekam. Bis heute denkt sie nicht gern an die Zeit. Eine Zuflucht fand sie im Tanzen. Schon mit sechs Jahren begann sie an Tanzgruppen teilzunehmen, in denen moderner Hip-Hop-Tanz mit Elementen aus Gymnastik und Akrobatik trainiert wurde. Das half ihr die schwierige Zeit zu meistern.
Einfaltspinsel oder Ökonomin?
Später half auch der niedrigschwellige Club. Die Diakonie eröffnete ihn an einem Kreisverkehr in Jablonec nad Nisou, daher der Name. Andreas Mutter las davon in der Zeitung und ermunterte ihre Kinder hinzugehen und ihn sich anzusehen. Andrea wollte anfangs überhaupt nicht, doch schließlich siegte die Neugierde, und das war gut so. Sie hatte sich immer gut mit älteren Leuten verstanden und im Leitungsteam fand sie jemanden, mit dem sie über ihre Sorgen sprechen konnte, aber auch Ausflüge machen konnte. Das kannte sie von daheim nicht. Ihre Eltern verbrachten die meiste Zeit zu Hause. Der Vater arbeitete als Gießer und die Mutter setzte in einer örtlichen Fabrik Ketten aus Kristallen für teure Lüster zusammen.
Das Umfeld des niedrigschwelligen Clubs und die Unterstützung durch dessen Leitung halfen Andrea dabei, ihren Weg zu ihren Mitschülern zu finden und unterstützten sie bei ihrer weiteren Schulbildung. Ihre Eltern möchten, dass wenigstens eines ihrer Kinder Abitur hat. Jablonec bietet dafür zwei Möglichkeiten – ein Gymnasium oder eine weiterführende Wirtschaftsschule. Auf das allgemeine Gymnasium wollte Andrea nicht, sie wollte etwas Konkretes, etwas womit sie nach dem Abitur direkt arbeiten könne, allerdings hatte sich auch vor der Wirtschaftsschule Angst. Sie stellte sich vor, dass sie dort zwischen Kindern aus wohlsituierten Elternhäusern säße und dass sie als Roma aus der Arbeiterschicht nicht akzeptiert würde. Im Club machten sie ihr Mut und halfen bei der Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen.
Verlockende weiße Welt
Sie erinnert sich an etwas, was sie aus der Bahn warf: Im September, gleich nach Schuljahresbeginn, ging sie mit einer ihrer neuen Mitschülerinnen die Straße entlang und auf der anderen Straßenseite lief eine Gruppe Romakinder. Ganz selbstverständlich kommentierte die Mitschülerin: „Ich hasse diese Zigeuner.“ Andrea hat sie ungläubig angestarrt. Und begriffen, dass sie für ihre Klassenkameraden keine Roma ist. Sie hat zwar schwarze Haare und ein dunkleres Gesicht, aber das muss nichts heißen. Aber es heißt etwas, dass sie auf die Wirtschaftsschule geht, doch dass Roma es da eigentlich nicht hin schaffen. Andrea verlebte einen bitteren Monat. Im Oktober gab es in ihrer neuen Klasse einen dreitägigen Kennenlernkurs. Was sollte sie da ihren Mitschülern erzählen? Wäre es nicht besser, sie im Unklaren zu lassen?
Sie betete zu Gott und beriet sich mit dem Leitungsteam des Clubs. Am Ende des Vorstellungskurses, bei dem jeder ein paar Worte zu sich selbst sagen sollte, wussten alle, dass sie Roma ist, dass sie sich dafür nicht schämt und dass sie sich damit nicht beleidigen lässt. Vor allem ist sie ein Mensch und als solchen sollen ihre Mitschüler sie behandeln.Es ging gut. Die Klassenlehrerin unterstützte sie deutlich und lobte ihren Mut. Die Klassenkameraden passten sich an.
Nach einer Weile begann jedoch auch Andrea sich anzupassen, auch wenn das nicht unbedingt wünschenswert war. Mit Bewunderung und einem Stich Neid begann sie zu beobachten, wie das Leben in einer wohlsituierten weißen Familie erscheint. Beispielsweise, dass Eltern mit ihren Kindern in den Urlaub fahren oder wie Eltern ihre Kinder für ihre verschiedenen Erfolge loben. Unter Roma geschieht dies gewöhnlich nicht.
Romafamilien halten untereinander zusammen und helfen einander, auch wenn sie dafür ein Opfer bringen müssen, das schafft Freundschaften und man feiert zusammen, (auch wenn es nicht mehr so ist, wie es einmal war). Und als Andrea ihrer Mutter stolz erzählt, dass sie mit ihrer Hip-Hop-Gruppe eine Weltmeisterschaftsteilnahme erkämpft hat, ist deren Reaktion kühl – dies bedeute nur eine weitere Ausgabe für die Familie. Familienurlaub hat Andrea nie erlebt, obwohl die Familie davon eigentlich nichts abgehalten hat.
Andrea begann sich aus der Welt der Roma zurückzuziehen. Wenn sie mit ihren weißen Mitschülern auf der Straße ging und sich eine Gruppe bekannter Roma näherte, sah sie weg, um sie nicht grüßen zu müssen. Schließlich schritt der Leiter des „Kreisverkehrs“ ein und führte mit ihr einige Gespräche und dies war hilfreich.
Die Geschichte von Andreas Leben wäre unvollständig, wenn der Glaube an Gott nicht Erwähnung fände. Er spielt in ihrem Leben die Hauptrolle. Sie kam bei ihrer Tante und ihrem Onkel zum Glauben, als deren kleine Tochter starb. Damals trafen sie sich mit dem Romapfarrer aus Mähren und dieser begann ihnen von Gott zu erzählen. Das Kind starb, der Glaube blieb dennoch. Andrea verbrachte Wochenenden bei ihrer Tante und ihrem Onkel, gemeinsam beteten sie, lasen in der Bibel und sprachen miteinander. „Seitdem bin ich überzeugt, dass eine Romafamilie Gott braucht. Ohne Gott gibt es nichts.“
Und wie sieht ihre Zukunft aus? Letztlich wird sie nach dem Abitur doch weiterstudieren, Pädagogik oder Sprachen. „Es kann sein, dass ich bei der Diakonie lande. Vielleicht ist das mein Schicksal.“, sagt sie mit einem Lächeln.
Adam Šůra
DIE EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT DER KARLSUNIVERSITÄT IN PRAG (ETF UK)
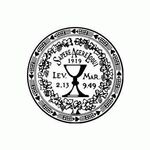 P.O. Box 529, Černá 9,
P.O. Box 529, Černá 9,
CZ 115 55 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 221 988 211; Fax: (+ 420) 221 988 215
E-Mail: intl@etf.cuni.cz
Internet: http://web.etf.cuni.cz/ETFENG-1.html
Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Karlsuniversität (ETF UK) ist die Nachfolgerin der Jan-Hus- Fakultät (1919-1950) und der Comenius-Fakultät (1950-1990). Im Jahr 1990 wurde sie in die Karlsuniversität eingegliedert. Die Verwaltung der Fakultät wird vom Dekan und dem Team der Prodekane geleitet, die auf vier Jahre in ihr Amt gewählt werden. Die Fakultät bietet Bakkalaureats- und Master-Studiengänge an – in evangelischer Theologie, Diakonie (Seelsorge und Sozialarbeit), ökumenische Studien, und verschiedene theologische Bereiche auf Doktoranden-Ebene. Die Fakultät ist ökumenisch für alle offen. Pfarrerinnen und Pfarrer der EKBB erhalten hier ihre Ausbildung.
Drei Dinge, die ich bei meinem Studienaufenthalt in der Tschechischen Republik gelernt habe
Die Evangelisch-Theologische Fakultät in Prag (ETF) führte 2015/16 einen neuen Bachelorstudiengang ein, der in vielerlei Hinsicht innovativ und ungewöhnlich ist. Er wird in Zusammenarbeit mit der Diakonischen Fachhochschule (Diak) in Helsinki, Finnland, und der Internationalen Akademie für Diakonie und soziales Handeln, Mittel- und Osteuropa (Interdiac) im schlesischen Teil der Tschechischen Republik durchgeführt, und der Unterricht wird von Dozenten aller drei Institutionen gemeinsam abgehalten. Die Studenten sind sowohl an der ETF als auch an der Diak eingeschrieben, und mit ihrem Abschluss erwerben sie akademische Abschlüsse von beiden Partneruniversitäten. Das Studienprogramm heißt „Soziale Dienste mit Schwerpunkt auf Diakonie und christlicher sozialer Praxis“, und die Unterrichtssprache ist ausschließlich Englisch. Die meisten Studenten kommen aus östlichen europäischen oder außereuropäischen Staaten, und Ziel des Programmes ist es, ihnen sowohl theoretische als auch praktische Kenntnisse auf dem gesamten Gebiet der Sozialarbeit und der sozialen Dienste zu vermitteln, wobei auf einen partizipativen Ansatz, auf Befähigung zur Selbsthilfe und auf Gemeinwesenarbeit ein besonderer Fokus gelegt wird. Das Programm beinhaltet auch das Studium der Sozialarbeit im Umfeld der Kirchen und Glaubensgemeinschaften (Diakonie) ‒ ein Zusatzstudium, das die Absolventen befähigt, im kirchennahen Umfeld tätig zu werden. Die Studenten müssen im Rahmen des Studiums umfangreiche Praktika absolvieren.
Das Studienprogramm nähert sich nun dem Ende, nämlich wenn die Studenten ihr Studium 2018/19 abschließen. Einer von ihnen blickt nun hier auf seine Studienzeit und die Praktika zurück und erzählt uns, welche Erfahrungen er dabei gemacht hat.
*****
Ich danke Gott dafür, dass er mich in die Tschechische Republik geführt hat, wo ich viele neue Dinge gelernt habe. Ich stamme aus Indonesien und bin dort Hilfspfarrer in einer Kirche in Bandung in der Provinz West-Java. In Prag studiere ich Diakonie und christliche Sozialarbeit an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Karlsuniversität. Was ich früher dachte und was zu meinem Grundsatz wurde, hat sich nun, nach diesem Lernprozess in Prag, grundlegend geändert, zum Beispiel in Bezug auf Führungsverhalten und Gemeinschaftsbildung. Diese beiden Dinge unterscheiden sich, denn sie haben unterschiedliche Zwecke und Funktionen. Ein Leiter spielt eine Rolle vor den Leuten, ein Sozialarbeiter spielt eine Rolle „hinter den Kulissen“. Immer bemühte ich mich, ein guter Leiter zu sein, doch nun versuche ich, ein Sozialarbeiter zu sein, der Leute beeinflusst und sie dazu bringt, selbst und füreinander tätig zu werden.
In diesem Studienprogramm ist jeder Student verpflichtet, praktisch tätig zu werden. Im ersten Semester leistete ich Sozialarbeit in Bethel, einem Tageszentrum und Nachtquartier für Obdachlose in der Stadt Český Těšín an der polnischen Grenze. Im zweiten und dritten Semester arbeitete ich an einer kirchlichen Einrichtung in Prag beim Dienst für Obdachlose mit. Im vierten Semester waren es Flüchtlinge aus dem Irak und aus Syrien, um die ich mich bei meiner Sozialarbeit kümmerte. Und im fünften Semester absolviere ich nun ein Praktikum am Militärischen Universitätskrankenhaus (ÚVN) in Prag, wo ich mich auf die Arbeit mit älteren Menschen konzentriere, die Kriegsveteranen sind.
Die Patienten sind dort alle über 90 Jahre alt. Manche sind noch rüstig, laufen ohne Hilfe, während andere im Alltag unterstützt werden müssen. Durch die Zusammenarbeit mit älteren Menschen denke ich viel über den Sinn des Lebens und meine Bestimmung auf dieser Welt nach. Einmal traf ich dort eine Freiwillige. Sie ist bei einem Unternehmen in Prag angestellt, doch sie ist gleichzeitig ehrenamtlich am ÚVN tätig. Ich fragte sie, warum sie eine Freiwillige sein wolle, und sie antwortete, dass Arbeit für sie eine Tätigkeit sei, um Geld für die täglichen Bedürfnisse zu verdienen, und sie meinte etwas im Leben zu vermissen, wenn sie nur für die Arbeit lebte. Zu arbeiten, nur um etwas Geld zu verdienen, machte sie nicht glücklich. „Ich bin glücklich, wenn ich etwas für andere tun kann, ohne irgendetwas dafür zu bekommen“, sagte sie. Die Antwort überraschte mich – ich hätte sie nicht erwartet. Was für eine bemerkenswerte Antwort, und welcher Edelmut darin zum Ausdruck kommt!
Wenn ich darüber nachdenke, was ich während meines Studiums der Sozialarbeit und bei den Praktika gelernt und erfahren habe, sind es drei Dinge, die ich hier festhalten möchte:
- Diakonie ist die Aufgabe der ganzen Gemeinde, nicht nur die eines Pfarrers oder Diakons. Wir alle sind dazu berufen, dem Herrn in unserem Alltag zu dienen, indem wir anderen dienen. Es gibt so viel, was wir anderen Menschen tun können. Bei der Arbeit am ÚVN wurde mir bewusst, dass ein kleines Lächeln Menschen glücklich machen kann. Die älteren Menschen sind glücklich, wenn sie uns freudig mit ihnen arbeiten sehen.
- Diakonie wird ihre wesentliche Bestimmung verlieren, wenn sie sich von Jesus Christus löst. Die Arbeit mit den Älteren am ÚVN bewegte mich dazu, die Gnade der Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus zu vermitteln, indem ich ein geistliches Lied mit ihnen singe und mit ihnen bete. Sozialarbeit ohne Jesus ist keine Diakonie.
- Diakonie verändert sich gemäß dem zeitlichen Fortschritt und der Entwicklung menschlicher Bedürfnisse. In Indonesien findet diakonische Praxis noch in einem sehr abgesteckten Rahmen statt, es geht etwa um die Beschaffung von Geld, Reis oder anderen Notwendigkeiten des täglichen Lebens für Arme und Bedürftige. In Wirklichkeit umfasst Diakonie viele Aspekte, bei denen auch die Regierung, Institutionen, Organisationen und die Gesellschaft einbezogen werden, und sie wächst auch weiter mit der allgemeinen und technologischen Entwicklung.
Blicke ich darauf zurück, wie ich war, als ich vor fast drei Jahren hierher kam, bin ich sehr dankbar für die Güte unseres Herrn Jesus, der mich hierher gebracht hat, um meine tschechischen Brüder und Schwestern und auch Menschen anderer Nationen zu treffen, und dabei so viel Weisheit und Wissen zu erlangen, die so wertvoll für mich persönlich sind.
Billy Tambahani
