Bulletin 43 – Ostern 2018
Der Leitartikel
Liebe Leser,
schon in den letzten Ausgaben unserer Evangelischen Nachrichten aus Tschechien konnten Sie von den Jahrestagen lesen, die unsere Kirche durchlebt. Aber das Jubiläum, das für die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder vielleicht die größte Bedeutung hat, liegt noch vor uns: im Herbst dieses Jahres wird unsere Kirche 100 Jahre alt. Auch im Blick auf die Vorbereitungsarbeiten, die noch voll im Gang sind, ist dieser Jahrestag besonders anspruchsvoll. Die Feier soll ja würdevoll sein und der Wichtigkeit dieses historischen Meilensteins gerecht werden. Die Entstehung unserer Kirche ist nämlich nicht nur für uns, tschechische evangelische Christen, von Bedeutung, sondern auch für weitere Bürger unseres Landes, auch wenn sie sich dessen nicht unbedingt bewusst sind. Sie begegnen uns, sie hören von uns, wenn wir auf Unrecht und Lügen aufmerksam machen, nehmen unsere Hilfe an – die Hilfe von Kaplanen und Pfarrern, als Seelsorger, Lehrer, bei Trauungen…
Diese Ausgabe unseres ökumenischen Bulletins erscheint kurz vor dem Osterfest. Das ist Absicht. Wir wollen darauf hinweisen, dass große und wichtige Jubiläen nicht nur einmal in 100 oder 500 Jahren stattfinden, sondern jedes Jahr. Jedes Jahr erinnern wir daran, welches Ende das Leben von Jesus Christus in dieser Welt nahm und feiern seinen Sieg über den Tod. Diese Botschaft hat für uns die größte Bedeutung und gibt uns Sicherheit und Frieden. Und sie ist es wert, erinnert zu werden und zwar jedes Jahr.
Ich wünsche Ihnen, liebe Freunde, dass sie an den Texten in unserem Bulletin Interesse und Gefallen finden. Und vor allem, dass Ihnen die bevorstehenden Osterfeiertage Frieden und Freude bescheren.
„Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.“ (Offb 1, 17-18)
Im Namen der Redaktion Jana Plíšková
DIE EVANGELISCHE KIRCHE DER BÖHMISCHEN BRÜDER
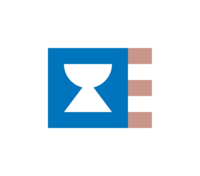 P.O. Box 466, Jungmannova 9,
P.O. Box 466, Jungmannova 9,
CZ 111 21 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 224 999 215(216); Fax: (+ 420) 224 999 219
E-Mail: ekumena@e-cirkev.cz
Internet: www.e-cirkev.cz
Die Grundlagen der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) wurzeln in der Utraquistischen Kirche (1431–1620) und in der Brüderunität ((1457–1620). Die EKBB entstand in ihrer heutigen Gestalt im Jahr 1918 durch den Zusammenschluss der bis dahin selbständigen evangelischen Kirchen Augsburger und Helvetischen Bekenntnisses. Deren Existenz wurde nach dem Ende der harten Gegenreformation, die von 1620 bis zum Erlass des Toleranzpatens durch Kaiser Joself II. im Jahr 1781 dauerte, erlaubt. Die strengen Beschränkungen mussten die Evangelischen freilich auch danach beachten, bis zum Erlass des Protestantenpatentes im Jahr 1861.
In der Zeit ihrer Entstehung hatte die EKBB 250 000 Mitglieder, im Jahre 1938 waren es dann schon 325 000 Mitglieder. Heute ist die Kirche in 14 Seniorate aufgeteilt mit einer Gesamtzahl von 250 Gemeinden und ca. 80 000 Gemeindegliedern. Die Kirche wird vom sechsköpfigen Synodalrat geleitet, der auf sechs Jahre gewählt wird. Repräsentiert wird die Kirche vom Synodalsenior und vom Synodalkurator.
Entsendung von Kaplanen und neuer Vertrag zur Gefängnisseelsorge Ein besonderer Ausdruck ökumenischer Zusammenarbeit
Am Tag des tschechischen Gefängniswesens, am 14.12., wurden im vergangenen Jahr 15 neue hauptamtliche und 19 ehrenamtliche Gefängnisseelsorger feierlich in ihren Dienst entsandt. Zum ersten Mal überhaupt wurde das in einem ökumenischen Gottesdienst begangen. Er fand in der Prager Kirche Sv. Václav na Zderaze (St. Wenzel von Zderaz) statt, die im 19. Jahrhundert in der Prager-Neustadt als Stafanstalt diente. Bei der Entsendung legten die Gefängnisseelsorger vor dem Generalsekretär der tschechischen Bischofskonferenz Stanislav Přibyl und dem Vorsitzenden des Ökumenischen Rats der Kirchen, Daniel Ženatý, ihre Versprechen ab.
Der Verein für Gefängnisseelsorge (tsch. vězeňská duchovenská péče - VDP) ist eine überkonfessionelle Vereinigung, die sich für eine ausgleichende und aufgeklärte geistliche und pastorale Arbeit in den Gefängnissen einsetzt. Die Vorsitzenden des Ökumenischen Rats der Kirchen und der tschechischen Bischofskonferenz schlossen deshalb mit dem Verein für Gefängnisseelsorge einen Vertrag, nach dem zum geistlichen und pastoralen Dienst erfahrene Geistliche und Laien entsandt werden sollen. Außerdem sollen sie über das ökumenische Umfeld und die spezifischen Bedingungen in Gefängnissen unterrichtet sein.
Der Verein für Gefängnisseelsorge organisiert für seine neuen Mitglieder Einstiegskurse und interdisziplinäre Seminare und kümmert sich um Weiterbildungen. Alle drei Vertragspartner halten es für unerlässlich, dass die Kandidaten für den Seelsorger-Dienst vorher ein Praktikum in Form von ehrenamtlicher geistlicher und pastoraler Tätigkeit absolvieren.
Die Unterzeichnung dieses Vertrags bestätigt die einzigartige ökumenische Seelsorge-Zusammenarbeit in den tschechischen Gefängnissen, die in Kooperation von 13 christlichen Kirchen geschieht.
Der Vertrag wurde am 14.12.2017 von dem Vorsitzenden des Vereins Pavel Zvolánek, dem beauftragten der tschechischen Bischofskonferenz Josef Kajnek und dem Vorsitzenden des Ökumenischen Rats der Kirchen, Daniel Ženatý unterzeichnet.
Fastenzeit – Zeit der Besinnung. Was können wir für unsere Umwelt tun?
Was können wir für unsere Umwelt? Auch solche Fragen wirft die Fastenzeit auf, die Zeitspanne vor Ostern, die dieses Jahr am 14. Februar begonnen hat. Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder macht gleich mehrere Angebote, wie diese Zeit genutzt werden kann.
Der Fasten-Kalender gibt uns für jeden Tag einen neuen Impuls, seinen Mitmenschen oder seiner Umgebung etwas Gutes zu tun. Er bietet uns Anregungen dafür, wie man seinen eigenen ökologischen Fußabdruck ausrechnet, wie man beim Putzen gefährliche Chemikalien vermeidet, wie man sein Mobiltelefon verantwortungsbewusst aussucht, oder wozu bürgerschaftliches Engagement dient. An den Sonntagen ist jeweils eine kurze biblische Andacht von einem evangelischen Pfarrer/einer evangelischen Pfarrerin abgedruckt.
Autofasten (http://autopust.cz/) ist eine Anregung, die Fastenzeit (oder wenigstens die letzte Woche) ohne Auto zu verbringen oder die Autofahrten zu reduzieren. Inspiriert von ähnlichen Aktionen in Österreich und Deutschland findet das Autofasten in der Tschechischen Republik regelmäßig seit dem Jahr 2011 statt und es nehmen mehrere hundert Menschen daran teil. Eine diesjährige Neuigkeit ist ein „Rechner“, den man auf der erwähnten Internetseite findet und der die tatsächliche Zeitersparnis (bzw. den entsprechenden Zeitverlust) bei der Autofahrt ausrechnet.
Beide Aktivitäten sollen zu einem intensiveren Nachdenken über unser Verhalten gegenüber der Umwelt anregen. In der Bibel wird der Mensch in der Schöpfungsgeschichte mit der Bewahrung der Erde beauftragt. Deshalb sollten wir uns ihr gegenüber verantwortungsbewusst verhalten.
Beide Initiativen werden vom Beratungsausschuss für Umweltfragen der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder in Kooperation mit dem Tschechischen christlichen ökologischen Netzwerk vorbereitet. Der Gedanke des Umweltschutzes steht auch hinter der Aktion mit dem Namen „Auf dem Fahrrad in die Kirche“, welche durch den gleichen Ausschuss jeweils im September organisiert wird. Es handelt sich um einen konkreten Sonntag, an dem Christen auf das Verhältnis zur Umwelt aufmerksam machen können, indem sie ihr Auto zuhause lassen und mit dem Fahrrad zur Kirche fahren.
Reformationsjubiläum und Wege zur Versöhnung nach der samtenen Revolution
Wenn wir und heute fragen, wie die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) mit ihrer veränderten gesellschaftlichen Position seit dem November 1989 umgeht, besonders im Blick auf Versöhnung und Vergebung, könnte der Blick auf die Reformation von Bedeutung sein. Das Reformationsjubiläum, Luthers Auftreten vor 500 Jahren, steht uns noch gut vor Augen.
Martin Luther war Mitglied und bewusst Teil der katholischen Kirche, also der allgemeinen. Auch für Jan Hus war die Kirche schlicht gegeben. Trotzdem war der Widerstand gegen die reformatorische Lehre groß. Vor allem gegen Luthers Erkenntnis, dass die Kirche weder Eigentümerin des Heils noch Mittel zum Heil ist. Buße oder Vergebung sind nicht käuflich, genauso wenig wie ein Leben in Fülle. Hoffen nicht auch wir heute, so wie Luther damals, dass wir Teil der unsichtbaren Kirche sind, die Gott selbst bewahrt? Warum sind wir denn so besorgt um unsere Kirche, wenn wir wissen, dass sie unter Gottes Ratschluss steht?
Die Kirche im totalitären Staat
Überlegen wir einmal, worin sich die Lage der Kirche in der Tschechoslowakei in den Jahren 1948–1989 von der Situation zur Zeit Luthers unterscheidet. Im Unterschied zum Mittelalter waren die tschechischen Kirchen im Totalitarismus durch kirchliche Gesetze eingeschränkt, die der Staat aufgezwungen hatte. Es gab viele Vorschriften und Anordnungen. Die tschechischen Kirchen waren in ihren eigenen Angelegenheiten nicht rechtsfähig. In diesen Punkten sehe ich den grundsätzlichen Unterschied zu der Zeit der Reformatoren.
Um dem internationalen Bedürfnis nachzukommen, mit anderen demokratischen Staaten gut auszukommen, unterschrieb der tschechoslowakische Staat die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Genau darauf verwiesen Regimekritiker, als sie anboten, bei der Einhaltung der Menschenrechte zu helfen. Unter ihnen waren auch Mitglieder der Kirchen. Es zeigte sich, dass die Regierenden bereit waren, der Weltgemeinschaft zynisch ein freundliches Gesicht zu zeigen, während sie ihren Kritikern mit gefletschten Zähnen gegenüber traten.
Die Kirche geriet von zwei Seiten unter Druck. Auf der einen Seite stellte der Staat die Spielregeln auf, an die sich die Kirche zu halten hatte. Manche der Reglementierungen waren nur schwer zu ertragen und widersprachen teilweise sogar dem Gesetz. Auf der anderen Seite setzten Regimekritiker aus den eigenen Reihen, also von innen, die Kirche unter Druck, indem sie den gesteckten Rahmen der Kirche überschritten und sich stark machten für eine Verbesserung der Lage. Waren sie in ihren Bestrebungen nicht den Reformatoren ähnlich, die für eine „Besserung der menschlichen Sache“ (Johann Amos Comenius) kämpften?
Bürger und Gemeindemitglieder unter Druck
Ich versuche einige Haltungen zu beschreiben, die durch die Verschärfung des Drucks nach 1968 hervortraten. Hier will ich sie mit einigem Abstand reflektieren.
- Die innere Emigration: Menschen ziehen sich zurück auf ihr Privatleben, bewegen sich nur noch im familiären Umfeld, im Freundeskreis, im Verein oder in der Kirche. Das lässt sich teilweise bis heute erleben.
- Kirche und Welt als Gegenpole: Die Kirche wird als von der Welt abgeschieden wahrgenommen.
- „Bloß kein Aufsehen erregen“: Das war das allgegenwärtige Argument, warum man nicht eindeutig Stellung bezog. Man versuchte schlimmere Folgen zu vermeiden, indem man seine eigene Meinung bedeckt hielt.
- Atmosphäre des Misstrauens: Vernehmungen, Verschwiegenheit, Angebote zur „Zusammenarbeit“ kamen immer wieder vor. Es konnte passieren, dass auch ein naher Kollege erklärte, wie man auf zwei Seiten spielt. Da frage ich mich heute: Wo ist das Maß menschlicher Schwachheit? Können wir es wagen zu richten?
- Engagierter Einsatz (auch Widerstand): Aus verschiedenen Gründen wählten Menschen den Weg sich politisch zu engagieren, manchmal aus der Not heraus, manchmal aus Kalkül, manchmal aus Prinzip. In jedem Fall kann man sagen, dass solche Entscheidung das Ende irrationaler Befürchtungen war. Die Angst um das innere Bestehen nahm ab. Auf überraschende Weise stand man nicht mehr allein da, sondern es fand sich eine Gemeinschaft beim gemeinsamen Weg mit anderen.
Nach der Wende
Nach Jahren der andauernden Situation, in welcher viele von uns erstarrt waren in Angst und Furcht, Unsicherheit und Gesichtsverlust, kam die Wende.
War das eine Prüfung der Gläubigen, ob sie der Führung Christi vertrauen? Kann man das so sagen? Und haben wir damals die Prüfung bestanden? Bestehen wir sie heute?
Aufbrechen zur Befreiung
Es scheint mir, dass manche, zumindest vor sich selbst, ihre Schwächen und ihr Versagen eingestehen. Manche sogar offen. Andere jedoch weigerten sich, jegliche Fehler zuzugeben.
Vor einigen Jahren hatte der Theologe Jan Šimsa während des Pfarrkurses eine Idee. Er meinte, es fehle eine Möglichkeit, seine Schuld zu bekennen und Beichte abzulegen. Beispielsweise innerhalb des Kurses, oder vor den Vorsitzenden des Pfarrvereins oder vor Einzelnen. Egal wie. Zur Sicherheit habe ich gefragt: „Und du denkst, dass da jemand kommt?“ „Aber sicher, ich kenne eine Reihe von Menschen, denen eine Beichte Erleichterung versprechen würde.“ Es kam, soweit ich weiß, nicht einer. Später wurde Jan Šimsa, ein kämpferischer Mann, der in Fragen nach der Wahrheit resolut war und einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hatte, Seelsorger für die, die er damals vor Augen hatte.
Zum Schluss wiederhole ich die gewagte Behauptung: Das kommunistische Regime war erfolgreich in seinen Angriffen auf die Einheit der kirchlichen Gemeinschaft. Das Privileg der Kirche Christi ist es aber, darin nicht einen Grund zum Aufgeben zu sehen, sondern als eine Kirche in Verschiedenheit zu leben und dabei frei Argumente auszutauschen, Konsens und Dissens zu pflegen. Und gleichzeitig wollen wir weiterhin darauf hoffen, dass wir eines Tage alle eins seien, wie es bei Johannes 17,21 („auf dass sie alle eins seien“) heißt.
Tomáš Bísek, geb. 1939 in Prag, evang. Pfarrer i.R., Mitunterzeichner der Charta 77, emigrierte 1985 nach dem Entzug der Predigterlaubnis aus der Tschechoslowakei nach Schottland, 1996 kehrte er mit seiner Frau zurück und wirkte bis zu seinem Ruhestand 2007 als Pfarrer in Prag.
Wege zur Versöhnung und Vergebung in den tschechisch-sudetendeutschen Beziehungen.
Ein persönlicher Blick.
Liebt. Vergebt. - „Aber in Bezug auf Sudetendeutsche? Das ist doch nicht so einfach!“ höre ich den Einwand.
Ich (Jahrgang 1952) bin im Sudetenland aufgewachsen, in dem einst deutschsprachigen Dorf Hackelsdorf /Herlíkovice an der oberen Elbe im Riesengebirge. Wir wussten nichts. Nichts von der ehemaligen Zweigstelle des KZs Groß Rosen. Keine Ahnung, was früher die Häuser waren – dass es eine Schule, eine Mühle, ein Geschäft und Kneipen gegeben hatte. Mit anderen Kindern schaute ich neugierig durch die Fenster in die leeren Holzhäuser am Berghang und stocherte mit Stöcken in den Gräben (vielleicht liegt da ein toter Deutscher?). Die Leute kannten sich untereinander nicht, jede Familie von woanders her zugezogen, misstrauisch. Es gab keine Vergangenheit, keine Gemeinschaft. Vielleicht – die Sehnsucht.
Viel später haben mir die Texte des Historikers Ján Mlynárik (im Sozialismus unter dem Pseudonym Danubius) die Augen geöffnet. Nach ihm brachte das Leben in den Sudeten für viele Tschechen, die deutsche Häuser „eingenommen“ hatten, kein Glück. Das Blut deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Ich kann es am Beispiel meiner Familie bezeugen. Glauben Sie an die Kraft des Fluches?
Das andere Ende meines Lebensbogens: Im September 2017 nehme ich am Treffen des Heimatkreises Hohenelbe im bayerischen Marktoberdorf teil. Unter den Anwesenden habe ich Bekannte, Freundinnen und Freunde: Die Heimat verbindet uns. Mehrere von ihnen sind gegenüber uns Tschechen so empathisch und verständnisvoll, dass ich ihnen manchmal widersprechen muss. Und umgekehrt - meine Schwäche für die alten Landsleute wird mir bewusst. Nur weil ich Germanistin bin oder weil mein früherer Mann Sudetendeutscher ist? Für mich sind Sudetendeutsche diejenigen, die „den Kürzeren“ gezogen haben – als eine unfreiwillige Minderheit in der Zeit der ersten tschechoslowakischen Republik, als „Kanonenfutter“ für Hitler an der Ostfront, als Opfer der auf Kollektivschuld gegründeten Vertreibung aus der Tschechoslowakei, und auch als verachtete Flüchtlinge im zerstörten Nachkriegsdeutschland.
Bei Diskussionen mit den Befürwortern der Vertreibung frage ich (mich) oft: Wie hätten wir uns politisch verhalten (und gespalten), wenn wir Deutsche gewesen wären? Hätten wir in der Krisenzeit bestanden?
Sehnsüchte tendieren dazu, in Erfüllung zu gehen. So durfte ich nach der Wende helfen, Kontakte und Zusammenarbeit mit dem Heimatkreis Hohenelbe aufzubauen. (Endlich Leute, die in meiner Stadt Wurzeln hatten!) Ich durfte bei der Planung des Begegnungszentrums in Vrchlabí mitmachen, das schließlich leider doch nicht zustande kam. Die Freude an persönlichen Freundschaften ist jedoch geblieben.
Das Leben neigt dazu, sich sinnvoll zu schließen. Ich wurde Mitglied des kleinen Vereins „Přátelé Herlíkovic/Freunde von Hackelsdorf“, unsere Aktivitäten (Renovierungsarbeiten an einem alten Hackelsdorfer Haus und an der kleinen Bergkirche, das Reinigen des deutschen Friedhofs im Nachbarort, alljährliche thematische tschechisch-deutsche Wochen, Kirchweihjubiläen) sind für mich beglückend, - weil wir da eben die Gegenwart mit der Vergangenheit zu versöhnen versuchen...
Eure Ältesten sollen Träume haben. Auch ich habe Träume. Dass wir einmal Gottfried und Günther Fischer finden, die 1946 als kleine Kinder ihr Haus in Hackelsdorf verlassen mussten, um welches sich jetzt unser Verein kümmert. Dass sie kommen und wir sagen: „Ihr Haus!“ - Oder dass auf dem Hohenelber Bahnhof eine Gedenktafel für die fast 45.000 Deutschen angebracht wird, die von hier 1945 – 1946 in Güterwaggons „abtransportiert“ wurden. - Ich träume davon, dass der Geschichtsunterricht bei uns nicht mit dem zweiten Weltkrieg endet. - Und ich wünsche, dass unser Staat endlich dem Kriegsgräberabkommen mit Deutschland beitritt (wobei unter „Kriegsgräbern“ auch Gräber von den infolge des Krieges umgekommenen Zivilisten verstanden werden).
„Alles wird gelöst, nachdem sie ausgestorben sind“, fasste ein Bekannter für sich die Problematik zusammen. Nur außerordentliche Menschen können über den eigenen Schatten springen. Viele Tschechen und viele böhmische Deutsche sind immer noch in ihren Positionen eingegraben. Mein Problem ist nicht die deutsche Schuld. Auf mir liegt das Versagen meines Volkes. „Es ist schwer, sich menschlich in einer menschenfeindlichen Zeit zu verhalten und nicht neues Unrecht entstehen zu lassen“, sagt unser Freund, Pfarrer Erich Busse aus Dresden.
In den Gesprächen in Marktoberdorf kam immer wieder der Wunsch zum Ausdruck: den ewigen Kreis von Unrecht und Vergeltung zu durchbrechen. Ingrid Mainert, die Betreuerin der Hohenelber und von Beruf Psychotherapeutin, spricht von Notwendigkeit eines Mediators. Auch sie ist gegen die Beneš-Dekrete („Wer wäre nicht dagegen!“), es ist ihr jedoch bewusst, wie äußerst kompliziert diese Angelegenheit für die Tschechen ist. - Sind aber unsere von Wahl zu Wahl agierenden Politiker überhaupt gewillt, das Problem zu lösen? Liegt es da nicht auch an uns? Es gibt keine rein „privaten“ Lebensläufe, jeder tragen wir Verantwortung in unserer konkreten historischen Zeit. Und als Christen sind wir doch zu keiner Kreisbewegung verurteilt, sondern – als lebendige „Ichthys“ - zum Schwimmen gegen den Strom vorgesehen. Ist der Geist Gottes nicht der berufenste Mediator?
Der Bekannte von mir hatte mit seinem Satz wohl recht, - wenn auch anders, als er ihn meinte. Wenn es nämlich keine von uns vertriebenen Sudetendeutschen mehr gibt, - dann erst kommen sie. Sie kommen zurück in ihrer Literatur, die wir zu entdecken beginnen. Es werden Gedenkstätten und Museen eröffnet werden, deutsches Kulturerbe wird geachtet werden. Und in Prag wird sicher einmal eine große, viel besuchte Ausstellung mit einem kurzen Titel stattfinden: ODSUN. - Aber dies wird nichts mehr mit Versöhnung und Vergebung zu tun haben.
(Artikel für „Český bratr“, Zeitschrift der Evangelischen Kirche. Gekürzt. Durch Kursive sind biblische Zitate gekennzeichnet.)
Gedenkorte der Toleranzzeit. Das Erbe hat seinen Wert.
Es ist schade, dass es in Prag keine Dauerausstellung gibt, die sich der Geschichte der Reformation in Böhmen widmet. Im Ausland ist dies üblich – in Frankreich oder Deutschland gibt es eine Reihe von evangelischen Museen, so zum Beispiel auch in Budapest. Sie sind notwendig, um die Aufmerksamkeit auf die gegenwärtige Reihe an Gedenktagen zu lenken: auf die Kralitzer Bibel, Jan Hus, Hieronymus von Prag, Martin Luther und in diesem Jahr auf die Generalversammlung der tschechischen Protestanten, bei der im Jahr 1918 die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder gründet wurde. Und dann haben wir der Öffentlichkeit etwas zu bieten: Hus und seine Vorgänger als Vorboten der weltweiten Reformation, Jahre des Religionsfriedens und die Brüderunität, die Zeit nach dem kaiserlichen Toleranzpatent und die wirklich einmalige Vereinigung zweier unterschiedlich gewachsener protestantischer Traditionen.
Einen neuen Anstoß in dieser Sache bot die Entdeckung des Bethauses aus der Toleranzzeit in der Tischlergasse (Truhlářská) in Prag. Ursprünglich hielten hier beide Prager Gemeinden, die tschechische und die deutsche, unter der Beteiligung sowohl lutherischer als auch reformierter Gläubiger, ihre Gottesdienste. Da das leerstehende und baufällige Gebäude der Prager Stadtverwaltung gehört, erschien es naheliegend und unproblematisch, es zum Standort des „Evangelischen Museums“ zu machen. Esa stellte sich jedoch heraus, dass die Stadt andere Pläne mit dem Gebäude hat und dass die nötigen Reparaturarbeiten am Gebäude sehr aufwendig wären, weshalb der Aufbau des Museums in nächster Zeit nicht realisierbar ist.
Ganz anders ist die Situation auf dem Land. Dort eröffneten vor einiger Zeit zwei Ausstellungen zur Geschichte der Reformation bzw. der religiösen Toleranz. Da ist zum einen das Museum der tschechischen Reformation in Velká Lhota bei Dačice, welches unlängst durch die Initiative des dortigen Museumsfreundeskreises entstand und zum anderen die Gedenkstätte für die Toleranzzeit in Vysoká bei Mělník. Diese wurde auf dem Gelände der Evangelischen Kirche in Vysoká errichtet und ihr Begründer ist die Gemeinde der EKBB in Mělník. Das ganze Gelände ist ein bedeutender Gedenkort der Toleranzzeit, es umfasst, neben der Kirche aus Jahr 1786, ein Pfarrhaus mit Nebengelassen und den Friedhof. Die Ausstellung, welche den Besuchern die Zeit nach dem Toleranzpatent näherbringt, wurde in der früheren Aufbahrungshalle eingerichtet und widmet sich erst den einzelnen Toleranzgemeinden in der Region und dann auch zwei Prager Gemeinden - der St. Clemens- und der St. Salvator- Kirche. Schade, dass das Bethaus in der Tischlergasse unerwähnt bleibt.
Umsichtig mit alten Dingen!
Würdigen wir die Gemeindearchive. Aber auch auf den Dachböden unserer Pfarrhäuser lagern viele Schätze. So wurde zum Beispiel in Libiš die erste mit einem Kelch bebilderte Bibel gefunden, sie stammt von Jan Wégh und dient seit mehr als 200 Jahren als Symbol der evangelischen Kirche. Das Archiv der der Salvatorkirche wiederum beherbergt die Entwürfe einer Kirche, die wohl ursprünglich als Anbau zu dem Haus in der Tischlergasse gedacht war. Auch wenn gegenwärtig kein evangelisches Museums und kein zentraler Aufbewahrungsort existiert, sollten wir an die Zukunft denken und nicht nur unserer Dokumente, die Zeugnisse der Vergangenheit unserer Kirche sind, sondern auch das antike Mobiliar unserer Gemeinden, das heute oft aus Unkenntnis dem Verfall preisgegeben wird, erhalten. Vielleicht würde es sich lohnen, wenigstens ein zentrales Register solcher Artefakte einzurichten.
Jan Mašek
Ein Pfarrer aus Glasgow in Prag
David Sinclair wird in Zukunft die Beziehungen der EKBB zu englischsprachigen Ländern pflegen
Zur Pflege der reichhaltigen Beziehungen zwischen der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder und Kirchen in englischsprachigen Ländern wird Pfarrer David Sinclair aus der presbyterianischen Kirche von Schottland (Church of Scotland) beitragen. Seit Beginn des neuen Jahres arbeitet er in der Ökumeneabteilung der Kirchenkanzlei der EKBB und wird weitere vier Jahre dort verbringen. Er wird sich dort um ausländische Besuche kümmern, deren Programme organisieren und auch Kirchengemeinden zur Verfügung stehen, die eine Partnerschaft mit Kirchengemeinden in englischsprachigen Ländern entwickeln wollen.
David Sinclair war ab 2008 bis Ende letzten Jahres Pfarrer der Wellington-Gemeinde in Glasgow. Davor war er Senior in Glasgow und Sekretär des Rates für Kirche und Gesellschaft, der ein Teil der Organisationsstruktur der Kirche von Schottland ist. Zu seiner vierjährigen Mission in der Tschechischen Republik sagte er: „Vor meiner Pensionierung ist die richtige Zeit für eine neue Herausforderung gekommen.“
Er kam nach Tschechien zusammen mit seiner Frau Mary, die als Lehrerin gearbeitet hat. Im November begannen sie in Prag einen Tschechisch-Intensivkurs, nur die Weihnachtsferien verbrachten sie noch mit Kindern und Enkelkindern in Schottland.
Die presbyterianische Kirche von Schottland hat mit den Protestanten in Tschechien langanhaltende und enge Kontakte. Bei der Entstehung der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder und dem Aufbau kirchlicher Strukturen im Jahr 1918 war die schottische presbyterial-synodale Ordnung ein Vorbild für die Organisation der neu entstehenden Kirche. Tschechische Theologen studierten in Edinburgh schon im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts; nach 1989 wurde der Kontakt zwischen den Kirchen wieder aufgebaut. In den letzten Jahren wurden die Pfarrer*innen Magdaléna Trgalová und Petr Peňáz in Gemeinden der Schottischen Kirche entsandt, um dort zu arbeiten und mit ihren Familien zu leben. Derzeit wird dieser Dienst von der Pfarrerin Ida Tenglerová geleistet. „Zusammenarbeit gehört zu den freudigen Dingen unseres irdischen Weges beim Aufbau des Leibes Christi und bei der gemeinsamen Suche danach, wie der reformierte Glaube bezeugt werden kann, “ sagte bei der Entsendung David Sinclairs‘ nach Tschechien der Sekretär des Weltmissionsrates der Schottischen Kirche.
Wir wünschen David und Mary Sinclair, dass sich diese Worte erfüllen mögen und dass ihnen das Leben und Arbeiten bei uns gefällt.
DIE DIAKONIE DER EKBB
 Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Tel: (+ 420) 242 487 811 (812); Fax: (+420) 242 487 834
E-mail: info@diakonie.cz
Internet: www.diakonie.cz
Die Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) ist eine gemeinnützige christliche Organisation, die Hilfe und Unterstützung anbietet für ein würdiges und vollwertiges Leben, auch wenn es durch Alter, Krankheit, gesundheitliche Behinderungen, Isolation, schwierige soziale Situationen und andere Lebenskrisen beeinträchtigt ist. Die Dienste der Diakonie der EKBB erfolgen auf der Grundlage der Botschaft des Evangeliums von der Liebe Gottes und nach dem Vorbild des Dienstes Jesu Christi. In ihren Zentren und Spezial-Schulen bietet die Diakonie soziale, gesundheitliche, Bildungs- und Seelsorgedienste an. Unter den nicht-staatlichen Organisationen, die soziale Dienste anbieten, ist die Diakonie der EKBB die zweitgrösste Institution.
Hoffnung bewahren. Wem und wie eine Spende aus der Fastensammlung hilft
Nach Zaatari, einem der größten Flüchtlingslager der Welt, gelangt man bequem mit dem Auto. Meist fährt man über die Autobahn los, die von Amman, der Hauptstadt Jordaniens, an die syrische Grenze führt. Dort biegt man auf die sogenannte Bagdader Straße ab, fährt durch eine leicht hügelige Wüstenlandschaft und sieht schon von Weitem so etwas wie eine große Stadt. Vor 2012 stand der Name Zaatari für ein kleines Dörfchen. Doch alles änderte sich, als in Syrien die Gewalt des Krieges ausbrach. Nach Jordanien kamen immer mehr Flüchtlinge.
Zaatari erwies sich aus mehreren Gründen als geeigneter Ort, um ein Flüchtlingslager anzulegen – es gab dort etwa ein Grundwasservorkommen, was in einer dürren Wüstengegend eine grundlegende Sache ist. Das Lager entstand in Zusammenarbeit internationaler Organisationen und unter Aufsicht erfahrener jordanischer Behörden; das Land hat wiederholt mit der Ankunft von Flüchtlingen Erfahrungen gemacht (siehe Kasten).
Es gab Zeiten, zu denen sich im Lager über 200 000 Menschen drängten; heute hat sich ihre Zahl bei 80 000 stabilisiert. Im Lager ist es dennoch sehr eng: Würde man die Bewohner von Zlín auf die Fläche des Prager Stadtteils Žižkov stapeln, hätte man ähnliche Verhältnisse wie dort. Davon abgesehen erinnert das Lager an eine normale Stadt, wenn auch eine mit besonderen Regeln.
Treffen auf den Champs-Elysées
Hinein gelangt man natürlich nur mit besonderer Erlaubnis und vorbei an Polizei- und Militärposten. Die sind allerdings recht freundlich und kontrollieren so oberflächlich, wie man es von Grenzen befreundeter Länder kennt. Was dann im Lager einen unerfahrenen Besucher zuerst fesselt, ist das endlose Gewirr von Gebäudezellen, die wie zufällig angeordnet scheinen. In jeder wohnt eine bis zu sechsköpfige Familie. Natürlich bemühen sich die Bewohner, ihre Behausungen auf die eine oder andere Weise zu verbessern – Anbauten aus Wellblech und anderem Material, oft Reste, die zur Hand sind. Ein Mensch, der geordnete europäische Städte gewöhnt ist, hat den Eindruck von permanentem Chaos.
In Wirklichkeit allerdings herrscht im Lager Ordnung. Jede Gebäudezelle hat eine Konskriptionsnummer (auch wenn der Besucher deren Logik nicht verstehen wird), die Wege dazwischen haben ihre Bezeichnung und das Herz des Lagers bildet eine Art Hauptstraße, die die Leute vor Ort nach dem berühmtesten Pariser Boulevard „Champs-Elysées“ nennen. Das tun sie freilich mit Ironie, aber auch mit Stolz – Stolz darauf, dass selbst unter äußerst schwierigen Bedingungen Kreativität und Lebenslust siegen können. Dieser Hauptboulevard des Flüchtlingslagers bietet nämlich fast alles. Im Lager gibt es zwei offizielle Supermärkte, wo man mittels besonderer Lagerkarten einkaufen kann. Mit den beiden Supermärkten konkurrieren jedoch halblegale Geschäfte und Betriebe auf dem Boulevard – ihre Zahl wird auf mehrere Tausend geschätzt – die so gut wie alles anbieten. Hier findet man einen Hochzeitssalon, Läden mit Handys, Apple-Computern und manches mehr. Es wird für Geld oder auch mit Waren gehandelt; hier werden Informationen und Klatsch ausgetauscht. Im Grunde pulsiert das Leben hier wie in Paris ...
Man sieht also, dass die Lagerbewohner nicht ums Überleben kämpfen müssen. Vorbei sind die Zeiten, als sie nur in Zelten lebten, die weder dem Wüstensturm noch dem Winter standhielten, und als die Leute froh waren, überhaupt etwas zu essen zu haben. Heute wird eine Kanalisation gebaut, das Lager ist schon seit geraumer Zeit elektrifiziert (daran hatte im Jahre 2015 auch die tschechische Regierung einen bedeutenden Anteil). Die größte Gefahr für die Bewohner lauert heute woanders – vor allem im Nichtstun. Es gibt hier einfach nichts, womit sich die Zeit füllen ließe.
Das Ende der Träume und Ambitionen
„Irgendwann überzeuge ich mich morgens selbst, dass ich irgendwohin eilen und tausend Dinge erledigen muss. Ich stehe schnell auf, ziehe mich an und frühstücke in Eile. Ich breche auf und gehe schnellen Schrittes irgendwohin. Es ist egal wohin, denn in Wirklichkeit habe ich nichts zu tun …“ So beschrieb vor einiger Zeit die heute dreiundzwanzigjährige Syrerin Alad ihr schlimmstes Lagertrauma einem Mitarbeiter der Diakonie. Als sie mit ihrer Familie aus Syrien floh, war sie gerade im dritten Jahr der Oberschule. Sie plante, später Jura zu studieren. Heute hätte sie das Studium wahrscheinlich abgeschlossen und sähe sich nach einer ersten Anstellung um. Stattdessen steckt sie schon seit einigen Jahren in einem eintönigen Lagerprovisorium fest. Mit ihren Gefühlen ist sie nicht allein, denn Flüchtlinge dürfen in Jordanien nicht arbeiten, um nicht mit den Einheimischen zu konkurrieren. In dem nicht allzu reichen Land ist das der Tribut für die Erhaltung des sozialen Friedens. Es gibt zehn Millionen Jordanier und an die drei Millionen Flüchtlinge.
In Syrien regierte vor dem Krieg ein autoritäres Regime, das seine Gegner mit schockierender Brutalität beseitigen konnte. Wer sich dagegen nicht für Politik interessierte, dem bot das Land einen ordentlichen Lebensstandard – die Leute konnten ein Unternehmen betreiben, reisen, an soliden staatlichen Schulen kostenlos studieren. Oft hatten sie ähnliche Ambitionen und Lebenspläne, wie wir sie in Europa haben. Der Krieg jedoch machte alles zunichte.
„Als die Flüchtlinge hierher kamen, meinten sie ursprünglich, einen oder zwei Monate hier zu bleiben. Heute sind sie vielleicht schon fünf Jahre hier“, sagt der tschechische Botschafter in Jordanien, Petr Hladík. Damit räumt er mit dem Mythos auf, das Ziel aller Flüchtlinge sei es, nach Europa weiterzureisen. „Meine persönliche Erfahrung – und ich treffe mich seit mehr als vier Jahren mit diesen Menschen – ist eine andere. Sie möchten nach Hause zurückkehren.“ Das jedoch ist weiterhin nicht möglich und es scheint auch in absehbarer Zeit nicht möglich zu werden. Der Krieg in Syrien dauert an, er ist unübersichtlich, und wie er zu stoppen wäre, weiß niemand. Man rechnet im Übrigen auch damit, dass es Syrien in seiner ursprünglichen Gestalt nicht mehr geben wird.
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Das Wichtigste ist es nun, den Leuten im Lager zu helfen, ihre Hoffnung zu bewahren und Frustrationen zu bewältigen. Darum bemüht sich die Diakonie in der sogenannten Oase des Friedens (Peace Oasis). In Zusammenarbeit mit der Tschechischen Regierung und dem Lutherischen Weltbund (LWF) wurde im Lager ein Komplex aus mehreren Zellen errichtet, wo Nähkurse an Nähmaschinen und Computerkurse stattfinden. Es gibt dort auch ein Kinderspielzimmer und einen Spielplatz im Freien, wo man Fußball spielen kann. Als grundlegend stellt sich aber zunehmend heraus, dass den Menschen ein offenes Gespräch über ihre Schmerzen, Sorgen und Hoffnungen ermöglicht werden muss. Auch professionell geschulte Begleiter sind vonnöten. Ein häufiges Thema ist die Gewalt, die junge Mütter und Kinder auf der Flucht durchgemacht haben. Kinder und junge Leute wiederum haben unter den Verhältnissen des Lagers eine schwierige Jugend und müssen sich über ihre Sorgen aussprechen können. So wird Konflikten und Radikalisierung vorgebeugt.
Neben der Oase des Friedens gibt es noch ein freies Stück Land. Die Diakonie plant dort gemeinsam mit der tschechischen Botschaft in Jordanien, die Räumlichkeiten für Treffen zu erweitern – entstehen sollen eine Bibliothek und ein gemeinschaftliches Café. Einen Teil des Geldes für die Erweiterung steuert die tschechische Botschaft bei, einen anderen wollen wir gern aus Spenden der Fastensammlung finanzieren. Vielen Dank!
Adam Šůra
DIE EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT DER KARLSUNIVERSITÄT IN PRAG (ETF UK)
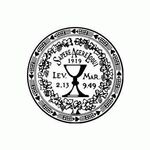 P.O. Box 529, Černá 9,
P.O. Box 529, Černá 9,
CZ 115 55 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 221 988 211; Fax: (+ 420) 221 988 215
E-Mail: intl@etf.cuni.cz
Internet: http://web.etf.cuni.cz/ETFENG-1.html
Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Karlsuniversität (ETF UK) ist die Nachfolgerin der Jan-Hus- Fakultät (1919–1950) und der Comenius-Fakultät (1950–1990). Im Jahr 1990 wurde sie in die Karlsuniversität eingegliedert. Die Verwaltung der Fakultät wird vom Dekan und dem Team der Prodekane geleitet, die auf vier Jahre in ihr Amt gewählt werden. Die Fakultät bietet Bakkalaureats- und Master-Studiengänge an – in evangelischer Theologie, Diakonie (Seelsorge und Sozialarbeit), ökumenische Studien, und verschiedene theologische Bereiche auf Doktoranden-Ebene. Die Fakultät ist ökumenisch für alle offen. Pfarrerinnen und Pfarrer der EKBB erhalten hier ihre Ausbildung.
Friedensgruß – Gedanken über meinen Studienaufenthalt in den USA
„Gebt einander ein Zeichen des Friedens.“
Als ich den Pfarrer diese Worte sprechen hörte, stand ich auf, bereit zu lächeln und ruhig die Hände der Leute in den benachbarten Bänken zu schütteln, so wie wir es in der Kirche meiner Heimatstadt in der Tschechischen Republik zu tun pflegen. Doch was ich erlebte, war etwas völlig anderes. Die Leute sprangen plötzlich von ihren Plätzen auf. Die Band stimmte unvermittelt ein rasantes Stück an. Alle rannten durch die Kirche, grüßten jeden, der ihnen zufällig über den Weg lief. Viele herzliche Umarmungen, Küsschen und kräftige Handschläge wurden lautstark ausgetauscht. Nachdem dieses Chaos mindestens fünf Minuten angedauert hatte (und alle außer mir mindestens eine Runde durch die ganze Kirche gedreht hatten), schienen die Leute sich langsam wieder zu beruhigen. Als sie schließlich ihre Plätze wiedergefunden hatten, ging der Gottesdienst weiter, als wäre nichts gewesen. Doch ich konnte nicht einfach weitermachen. Ich hatte so viele Fragen! „Was war passiert? Was sollte dieses Chaos mit Zeichen des Friedens zu tun haben? Und am allerwichtigsten: Welche der vielen Einladungen zum Mittagessen, die ich gerade erhalten hatte, sollte ich nur annehmen?!“
Überraschende Momente wie diesen erlebte ich während meines Aufenthalts in den Vereinigten Staaten täglich. Ich hatte die Gelegenheit, das Herbstsemester 2017 am Columbia Theological Seminary (CTS) in Decatur im Bundesstaat Georgia zu verbringen. Und ich liebte es.
Zwischen dem CTS und meiner „Alma Mater“, der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Prag, besteht eine langjährige Beziehung. Die Institutionen tauschen regelmäßig Studenten und manchmal sogar Dozenten aus. Darüber hinaus besucht alle paar Jahre eine Gruppe Studierender vom CTS Prag, um etwas über die Geschichte und die gegenwärtige Situation der christlichen Kirchen in der Tschechischen Republik zu erfahren.
Seit das Columbia Theological Seminary ein Seminar ist, ist der Unterricht dort etwas praxisorientierter. Die überwältigende Mehrheit der Studenten studiert mit dem Ziel, als Pfarrer, in der Beratung, der Jugendarbeit oder Ähnlichem tätig zu werden. Doch das bedeutet keinesfalls, dass das Studium zu einfach oder oberflächlich sei und der Tiefe des theologischen Wissens keine Beachtung geschenkt würde; das Vermächtnis von Walter Brueggemann, dem weltberühmten Professor und Alt-Testamentler, der 17 Jahre am CTS wirkte, ist noch immer sehr gegenwärtig.
Ich glaube, dass die Gemeinschaft das Stärkste war, was ich am CTS erfahren habe. Anders als ich es gewohnt bin, leben dort die meisten Studenten auf dem Campus, und viele Lehrende haben Häuser in den benachbarten Straßen. Gemeinsame Abendessen, Potlucks oder abendliche, tiefschürfende Gespräche bei einem Glas Wein (oder einem Glas mit einer der einheimischen Biersorten) sind Dinge, die schnell geschätzter Teil meines Lebens am CTS wurden. Die Hochschule trifft sich zudem vier Mal pro Woche in einer ihrer Kapellen zu Gebeten und Gottesdiensten. Sowohl die Lehrenden als auch die Studierenden sind außerdem sehr aktiv im Kampf für soziale Gerechtigkeit.
Ich habe während meines Aufenthaltes viel gelernt. Auch wenn die Kultur, das Essen, die Spiritualität und noch viele weitere Dinge anders waren (ich brauchte zum Beispiel durchaus eine Weile, um mich an die allgegenwärtigen Klimaanlagen zu gewöhnen), erfuhr ich, was es bedeutet, akzeptiert zu sein. Trotz meines sprachlichen Unvermögens und der vielen Fettnäpfchen spürte ich, was es heißt, willkommen zu sein. Und ich lernte, dass es Frieden in Vielfalt gibt.
Mögen wir in der Tschechischen Republik, in Europa oder überall sonst einander ebenfalls Zeichen des Friedens geben.
