Bulletin 40 – Ostern 2017
Der Leitarikel
Verehrte Leserinnen und Leser,
diese neue Ausgabe der Evangelischen Nachrichten aus Tschechien erscheint in der Osterzeit. Wir haben uns wieder bemüht, aus dem evangelischen Leben in Tschechien das auszuwählen, was für Sie jenseits der tschechischen Grenzen interessant und vielleicht sogar hilfreich sein könnte.
Ein großes und nicht leichtes Thema – auch in der Tschechischen Republik – sind die Flüchtlinge aus islamischen Ländern und wir wollen dieses Thema angehen: politisch, bürgerschaftlich und auch in der Kirche. Was uns als Christen aber missfällt ist, dass mit „christlichen Werten“ auch diejenigen argumentieren, die mit dem Glauben an Christus nichts zu tun haben und diese Werte zu einem bestimmten Zweck anführen – um unsere, also die „christliche“ Bequemlichkeit und Sicherheit zu schützen; noch schlimmer ist, dass so auch Politiker argumentieren, die daraus Kapital für die Wahlen schlagen wollen. Die Anti-Flüchtlings-Parolen fallen also auf fruchtbaren Boden. Dagegen hat sich unsere Kirchenleitung klar positioniert. Wie? Das erfahren Sie in diesem Bulletin.
Die 95 Wittenberger Thesen von Martin Luther und damit das 500. Jubiläum der europäischen Reformation sind zweifellos für den evangelischen Teil Europas wichtig und spielen auch in unserer Ausgabe der Evangelischen Nachrichten aus Tschechien eine Rolle.
Einer der sozialen Dienste der Diakonie der EKBB ist die Hilfe für die Opfer von häuslicher Gewalt. Das ist bekannt und lobenswert. Sich aber um die Täter dieser häuslichen Gewalt zu kümmern, ist ungewöhnlich. Lesen Sie bei uns, wie die Diakonie der EKBB diese Thema angeht.
Und schließlich noch eine Überraschung – ein Artikel über unseren langjährigen Mitarbeiter und Leiter der Ökumeneabteilung der Kirchenzentrale. Lesen Sie selbst!
Mit den besten Wünschen für ein gesegnetes Osterfest
im Namen des Redaktionsrats
Jana Plíšková
DIE EVANGELISCHE KIRCHE DER BÖHMISCHEN BRÜDER
 P.O. Box 466, Jungmannova 9,
P.O. Box 466, Jungmannova 9,
CZ 111 21 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 224 999 215(216); Fax: (+ 420) 224 999 219
E-Mail: ekumena@e-cirkev.cz
Internet: www.e-cirkev.cz
Die Grundlagen der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) wurzeln in der Utraquistischen Kirche (1431-1620) und in der Brüderunität ((1457-1620). Die EKBB entstand in ihrer heutigen Gestalt im Jahr 1918 durch den Zusammenschluss der bis dahin selbständigen evangelischen Kirchen Augsburger und Helvetischen Bekenntnisses. Deren Existenz wurde nach dem Ende der harten Gegenreformation, die von 1620 bis zum Erlass des Toleranzpatens durch Kaiser Joself II. im Jahr 1781 dauerte, erlaubt. Die strengen Beschränkungen mussten die Evangelischen freilich auch danach beachten, bis zum Erlass des Protestantenpatentes im Jahr 1861.
In der Zeit ihrer Entstehung hatte die EKBB 250 000 Mitglieder, im Jahre 1938 waren es dann schon 325 000 Mitglieder. Heute ist die Kirche in 14 Seniorate aufgeteilt mit einer Gesamtzahl von 250 Gemeinden und ca. 80 000 Gemeindegliedern. Die Kirche wird vom sechsköpfigen Synodalrat geleitet, der auf sechs Jahre gewählt wird. Repräsentiert wird die Kirche vom Synodalsenior und vom Synodalkurator.
Der Synodalrat der EKBB zum Missbrauch des Begriffs „Christliche Werte“
Wir sind tief beunruhigt davon, wie einige politische Amtsträger in den letzten Monaten zur Rückehr zu „christlichen Werten oder Wurzeln“, zum „ Zusammenhalten unserer christlichen Identität“ oder zur „Rückkehr zu unseren christlichen Wurzeln“ aufrufen.
Die Annahme des Gesetzes, Karfreitag zum staatlichen Feiertag zu machen, wurde mit der Unterstützung der christlichen Identität gegen den Ansturm anderer Identitäten begründet. Zur Rückkehr zu den christlichen Wurzeln um sich gegen islamistischen Fundamentalismus zu verteidigen, forderte bei den vorjährigen Feierlichkeiten zum St.-Wenzels-Tag [zugleich: Tag der tschechischen Staatlichkeit] auch Präsident Miloš Zeman auf.
Warum missfällt uns das? Es ist uns daran gelegen, dass die Bezeichnung „christlich“ nicht sinnentleert wird. Wir wollen nicht hinnehmen, dass „christliche“ Rhetorik zur Verbreitung von Vorurteilen und Fremdenhass, am häufigsten gegen Muslime, für die Verweigerung von Flüchtlingshilfe, für das Heraufbeschwören eines Kampfes der Kulturen und eines nationalistischen Geistes verwendet wird.
Wir fürchten, dass diese oberflächlich „christliche“ Rhetorik zur Rechtfertigung unserer Abneigung ausgenutzt wird, mit dem Nächsten zu teilen oder etwas zu opfern.
Wir empfangen das Evangelium als gute Nachricht für die Schwachen und Leidenden, die im jähen Widerspruch steht zu allen tiefausgehobenen Gräben zwischen Menschen, errichteten Mauern und Feinseligkeit. Für uns Christen ist die Botschaft Jesu Christi leitend für unseren Lebensweg, auch wenn wir ihr bei weitem nicht gerecht werden können. Gern würden wir aber zur Hoffnung ermutigen, den Weg zu den Menschen um uns zu suchen und die zerstörerischen Konflikte zu beenden.
Der Synodalrat der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder in Prag, den 18. Oktober 2016
Verabschiedung von Ökumenereferent Gerhard Frey-Reininghaus
Am 1. April 2017 ging Gerhard Frey-Reininghaus, der über 26 Jahre in Diensten der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder stand, in den Ruhestand. Er kam im Jahr 1990 mit seiner ersten Frau Adelheid aus der württembergischen Gemeinde Köngen für ein zweijähriges postgraduales Studium nach Prag. Nach dieser Zeit ging er aber nicht nach Deutschland zurück. In der Zeit, in der die Evangelisch-theologische Fakultät wegen eines rapiden Anstiegs der Studierendenzahlen in Schwierigkeiten kam, nahm er die anspruchsvolle Aufgabe auf sich, sich beim Finden eines neuen Gebäudes für die Fakultät zu beteiligen. In seinem Fundraising war er ausgesprochen fleißig, entgegenkommend aufmerksam und allen Menschen trat er mit großer Herzlichkeit gegenüber. Ohne sein Zutun hätte sich die Evangelisch-theologische Fakultät nie so entwickeln können, wie es unter den neuen Bedingungen möglich war. Mit seiner Frau baute er die Auslandsabteilung der Fakultät auf, die bis heute sehr aktiv ist. Sein Wirken an der ETF mündete in die Einladung des damaligen Synodalseniors Pavel Smetana zur Arbeit in der Ökumene-Abteilung der Zentralen Kirchenkanzlei. Gleich zu Beginn ging es in dieser Arbeit darum, die Wunden, die seit dem 2. Weltkrieg im Leben beider Nationen bestanden, zu heilen. So entstand eine deutsch-tschechische Arbeitsgruppe, in der Gerhard der Sekretär der tschechischen Seite war. Ausgangspunktdieser Arbeit war die Erklärung der Synode der EKBB aus dem Jahr 1995 zur Vertreibung der Sudetendeutschen. In der Arbeitsgruppe entstand das Büchlein „Der Trennende Zaun ist abgebrochen“ mit dem Ziel einen Weg zu Versöhnung und besserem gegenseitigen Verständnis zu finden. Gerhard hat in und mit dieser Arbeit darauf hingewiesen, dass Versöhnung der Mittelpunkt des Evangeliums ist. Auch durch seine Hilfe wurde dann im Jahr 2003 der Vertrag zwischen EKBB und EKD unterschrieben. Daran knüpfte dann die Zusammenarbeit zur Problematik der sexuellen Ausbeutung von Frauen und Kindern im deutsch-tschechischen Grenzgebiet an.
Die Aufmerksamkeit von Gerhard Frey-Reininghaus beschränkte sich aber nicht nur auf Deutschland. Unter seiner Führung begann die Zusammenarbeit der tschechischen American Working Group und des Czech Mission Network in den USA. Er entwickelte die Kontakte mit einer Reihe von Kirchen aus ganz Europa und förderte die sehr schöne Freundschaft mit der Presbyterianischen Kirche in Korea. Für die vielen ausländischen Partner und Freunde der Evangelisch-theologischen Fakultät, der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder und ihrer Diakonie entstand auf Gerhards Initiative hin dieses Informationsbulletin.
Er bewährte sich auch als hervorragender Organisator und Koordinator, sei es bei der Organisation von Hochwasserhilfe in den Jahren 1997 und 2002, bei den Christlichen Begegnungstagen in Prag im Jahr 2005 oder bei den Feierlichkeiten zum 600. Todestag von Magister Jan Hus im Juli 2015. Diese Ereignisse hat Gerhard durch seine Weitsicht und sein Kommunikationstalent entscheidend geprägt und hat die Vorbereitungsteams professionell und routiniert geleitet.
Wir können hier nur manche seiner Aktivitäten nennen, die unsere Kirche bereichert haben. Am Samstag 1.4.2017 hat der Synodalrat einen festlichen Abend zur Verabschiedung von Gerhard Frey-Reininghaus veranstaltet, an dem etwa 150 tschechische und ausländische ökumenische Partner teilgenommen haben. Wie ein roter Faden zog sich der Dank für das Verständnis, die Offenheit und Freundschaft, die fest zu seiner Kommunikation und seiner Partnerschaftspflege gehörten, durch das Programm. Seine Art und sein Handeln ist für viele von uns eine wichtige Inspiration und Bereicherung. Wir freuen uns über seine Freundschaft und dass wir uns weiterhin mit Gerhard treffen können - in verschiedenen Rollen auf dem Feld der tschechischen und weltweiten Ökumene. Den Danksagungen bei seiner Verabschiedung schließen wir uns an und danken Gott, dem Herrn, für die Gaben, die Gerhard von ihm für seine Arbeit bekommen hat und die er mit uns geteilt hat.
Daniela Hamrová
Es hat Sinn!
Über diakonische Projekte und Entwicklungsprojekte mit Vladimír Zikmund
Mehrere Jahrzehnte lang waren die tschechischen Kirchen nach einem Regierungsbeschluss von 1949 von der Staatskasse abhängig und diese Situation dauerte auch nach der Wende von 1989 an. Erst vor ein paar Jahren erlebten wir einen grundlegenden Wandel, im Jahre 2012 wurde das Gesetz über den Eigentumsausgleich zwischen Kirchen und Religionsgemeinschaften und dem Staat beschlossen. Für die Kirchen begann so der Weg in die finanzielle Selbstständigkeit. Die staatlichen Zahlungen verringern sich jedes Jahr und werden im Jahr 2030 enden.
Gleichzeitig kommt es aber zu einem Finanzausgleich, demzufolge die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder bis zum Jahr 2043 schrittweise eine Summe von 2,26 Milliarden Tschechischer Kronen bekommt. Es handelt sich hier um eine Entschädigung für das Eigentum, das den Kirchen vom sozialistischen Regime abgenommen wurde. Ab 2017 wird ein Teil dieser Summe über Förderprogramme verschiedenen diakonischen Projekte und Entwicklungsprojekten zugute kommen. Wie das in der Praxis aussieht, beschreibt der Synodalkurator der EKBB Vladimír Zikmund.
Wie funktionieren die diakonischen Projekte und Entwicklungsprojekte eigentlich?
Dieses Modell wurde von der Synode, unserem höchsten Gremium, genehmigt. 18,5 % der Ausgleichszahlungen werden jährlich an diakonischen Projekte und Entwicklungsprojekte vergeben, die helfen sollen, unsere Gemeinden zu beleben. 70 % dieser Summe verteilt die EKBB in Form von Zuschüssen und 30 % die Diakonie der EKBB. Die Regeln des Systems der Zuschussbewilligung wurden von einer Kommission erstellt, deren Mitglieder praktische Erfahrungen aus verschiedenen Förderprogrammen haben und gleichzeitig das Kirchenleben gut kennen. Hauptbereich der Unterstützung sind Gemeindeaufbau und Mission, Erziehung, Bildung und diakonische Arbeit.
Wie groß war das Interesse an einer Antragstellung im ersten Jahr?
Dieses Jahr gab es 59 Anträge und von der Kommission wurden 46 Projekte dem Synodalrat zur Genehmigung vorgeschlagen. Dabei geht es um finanzielle Unterstützung in einer Gesamthöhe von über viereinhalb Millionen Kronen. Ich möchte noch erwähnen, dass eine weitere Million für sogenannte Mikroprojekte bestimmt ist. Dieses Geld verteilen die Senioratsausschüsse aufgrund eigener Regeln.
Welcher Bereich war am meisten gefragt?
Die meisten Anträge – 38 an der Zahl – betrafen die Entwicklung von Gemeinden. Es ging dabei um die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, das Öffnen von Räumlichkeiten für die Öffentlichkeit oder die Entwicklung von Aktivitäten aller Generationen zur Festigung der Beziehung zur eigenen Gemeinde und das Ansprechen von Mitgliedern am Rande der Gemeinde.
Und die anderen Bereiche?
Um diakonische Arbeit ging es in 13 Projekten; es handelte sich hier hauptsächlich um die Entwicklung der Freiwilligenarbeit und die Stärkung der Bindung zwischen den Diakoniezentren und den mit ihnen zusammenarbeitenden Gemeinden, etwa Zugangsmöglichkeiten zu kirchlichen Aktivitäten für Menschen mit Behinderung. Die wenigsten Anträge betrafen evangelische Rüstzeitheime. Insgesamt waren es sieben, bei denen es hauptsächlich um die Ausstattung der Lager ging.
Welches Projekt war für dich das interessanteste?
Es gab verschiedene interessante Sachen, beispielsweise das Zugänglichmachen eines Kirchturms nahe eines oft befahrenen Radwanderweges. Auch das ist eine Möglichkeit, den Menschen die Kirche zu öffnen. Mir gefällt auch die Hilfe für Leute aus dem Strafvollzug bei der Eingliederung ins normale Leben. Das sind nämlich Menschen, mit denen die Gesellschaft meistens nichts zu tun haben möchte. Die Projekte „Barrierfreies Pfarrhaus oder wir wollen nicht im Verborgenen leben“ oder „Konfirmand, bleib bei uns“ kann ich auch nicht unerwähnt lassen.
Welche Projekte würdest du in der Zukunft gerne sehen?
Ich unterstütze gerne die Integration von Jugendlichen in Aktivitäten des Seniorats oder der Gesamtkirche. Die grundlegende kirchliche Einheit bleibt immer die Gemeinde, doch ist es im Jugendalter gut, in einer breiteren Gemeinschaft verankert zu sein. Ich selbst habe das bei verschiedenen Brigaden und Kursen erlebt. Eine gute Richtung ist sicher auch die Unterstützung der Freiwilligenarbeit in den Diakoniezentren. Auch jede Bautätigkeit in den Gemeinden, sofern Eigenleistungen der Gemeindemitglieder einbezogen werden, führt zu größerem Interesse der Mitglieder daran, wie ihre Gemeinde aussehen wird und wie sie sich darin fühlen.
Manche Anträge wurden von der Kommission abgelehnt. Wieso?
Meistens weil im Projekt eine neue Aktivität fehlte. Den Regeln nach ist dieses Programm nämlich nicht für Investitionen und Umbau gedacht, sondern für Projekte, die mit Entwicklung verbunden sind. Die Kommission hat ein System vorgeschlagen, das manchem vielleicht streng erscheint, aber bestimmt auch von Nichtfachleuten eingehalten werden kann.
Die Projekte bewegen sich zumeist in einer Höhe von mehreren zehntausend Kronen, der Eigenanteil der Gemeinden liegt bei 10 Prozent. Ist das für die Gemeinden nicht zuviel?
So haben wir die Regeln gleich zu Beginn gesetzt, also haben alle damit gerechnet; manchmal ist der Anteil der Gemeinde auch größer. Ich denke, das ist recht gesund, es verhindert das bloße Ausstrecken der Hand nach Geld und zehn Prozent ist gleichzeitig eine tragbare Summe.
Wurde über eine Änderung der Regelwerks nachgedacht?
Alle gesammelten Erfahrungen möchten wir in den neuen Aufruf zu Antragseinreichung, in die Bearbeitung der Antragsformulare, aber auch in unser Schulungs- und Konsultationsprogramm, das wir weiterhin organisieren wollen, einfließen lassen. Für das Jahr 2018 hat die Kommission vorgeschlagen, dass die Anträge die gleichen Bereiche betreffen sollen, nur mit einem anderen Summenverhältnis und mit einem größeren Fokus auf Gemeindeentwicklung. Die Summe, die nächstes Jahr verteilt wird, geht an die neun Millionen Kronen und die Höchstsumme, die beantragt werden kann, bleibt wahrscheinlich bei 300 000 Kronen.
Welches Gefühl hast du bis jetzt von der Entscheidung, einen Teil des Geldes aus dem Finanzausgleich in diakonische Projekte und Entwicklungsprojekte zu investieren?
Ich weiß noch nicht, wie es mit den diesjährigen Projekten ausgehen wird und ob sie die erwünschte Belebung der Gemeinden bewirken. Ich weiß auch nicht, ob dieses Jahr mehr oder weniger Anträge kommen. Und ich weiß nicht, ob manche Gemeinden nicht versteckte Projekte in ihrer Schublade haben und nur darauf warten, wie das erste Jahr des Zuschuss-Systems aussehen wird. Ich bin aber davon überzeugt, dass diese Art der Unterstützung gut ist. Deswegen schätzen wir es, wenn die Gemeinden über ihre Projekte auf Web-Seiten und über andere Medien informieren. Damit man davon weiß und damit sich weitere Menschen Inspiration holen können.
Das hat bestimmt Sinn!
Jana Vondrová
Die tschechischen Protestanten gedenken 500 Jahre Europäischer Reformation
Genau wie andere Europäer gedenken die Tschechen im Jahr 2017 Martin Luthers und seiner 95 Thesen, die er 1517 an die Tür der Schlosskirche Wittenbergs schlug und die den Beginn der Europäischen Reformation bilden.
In den vergangenen Jahren gedachten die Tschechen der Geschehnisse, die der Europäischen Reformation vorangegangen waren – die Verbrennungen von Jan Hus und Hieronymus von Prag auf dem Konstanzer Konzil 1415 und 1416. Und gerade zu den Gedanken Jan Hus´ bekannte sich Martin Luther ein Jahrhundert später.
Was erwartet uns im Luther-Jahr?
Ende letzten Jahres kam ein Truck in die Tschechische Republik, der durch ganz Europa tourt und auf das Gedenkjahr der Reformation aufmerksam macht. Prag besuchte er am 21. und 22. November, es war seine einzige tschechische Station. Dieses Projekt der EKD stellt heraus, dass die Reformation nicht nur ein deutsches Thema ist und sich nicht mit Martin Luther erschöpft.
Der Truck machte sich letztes Jahr Anfang November aus Genf auf den Weg und sammelt Kurzfilme von jeder seine Stationen, das sind insgesamt 67 in 19 Ländern. Dieses Jahr im Mai endet seine Reise in Wittenberg.
Die Tschechen bereiten sich auf den Kirchentag vor, der vom 24.-28. Mai in Berlin und Wittenberg stattfindet und sie sind bereit an den Vorbereitungen weiterer Veranstaltungen mitzuwirken, die in Deutschland stattfinden werden.
Martin- Luther-Woche
Den Jahrestag der Reformation wollen die tschechischen Protestanten dort begehen, wo das Luthertum in Tschechien besondere Tradition hat, deshalb lenken sie ihre Schritte in den Osten der Republik. Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder wird einen Festgottesdienst für die ganze Kirche mit anschließendem Programm in Ratiboř am 10. September halten, die Schlesische Evangelische Kirche A.B. dann am 17. September in Český Těšín.
Beide Feierlichkeiten werden ökumenisch geplant und es werden Stellvertreter beider Kirchen teilnehmen. Nach Tschechien kommt außerdem eine Wanderausstellung, die sich der Reformation in den böhmischen Ländern widmet.
In der EKBB ist das Jahr, in dem wir der Geschehnisse um Martin Luther gedenken, Teil eines größeren Projekts, das „Unsere Reformation“ heißt. Es widmet sich Gedenktagen in den Jahren 2013-2018, die (nicht nur) für die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder bedeutend sind.
So haben wir in den letzten Jahren an die Herausgabe der Kralitzer Bibel, das Abendmahl in beiderlei Gestalt und eben an Jan Hus´und Hiernonymus von Prag erinnert.
Die Geschichte eines Kronleuchters
Das Licht der Kirchen-Partnerschaft reicht über den Ozean
In der evangelischen Kirche in Letohrad haben wir am 6. November 2016 feierlich den Hauptkronleuchter entzündet. Der Grundstein für die Kirche wurde 1998 gelegt. Vier Jahre später sind wir in die neue Kirche eingezogen und über manche fehlenden Details haben wir uns nicht lange den Kopf zerbrochen: Renovierungen des Außenbereichs, Pflaster verlegen, Blenden für die Heizungsanlage – das alles ließ sich nach und nach einrichten. Und so kam es, dass nur noch ein Leuchter fehlte.
Früchte einer Partnerschaft mit der Gemeinde in Annapolis
Im neuen Kirchengebäude haben wir mit Angeboten für die Öffentlichkeit begonnen, mit Konzerten, Ausstellungen oder Sprachkursen für Kinder und Erwachsene. Und genau diese Englischkurse stellten unsere Partnerschaft mit der Presbyterianischen Kirche in Annapolis (USA, Maryland) auf eine neue Basis. Die Zusammenarbeit mit dieser Kirche begann schon vor dem Bau der Kirche, jedes Jahr kam eine Gruppe von Menschen, die sich Arbeitskleidung überzogen und sich handwerklich unterstützend ans Werk machten.
Im Jahr 2001 machten wir die Bekanntschaft mit Ehepaar Moran, mit Mark und Connie; beide waren frisch in der Rente, er als ehemaliger Soldat, der den Großteil seines Lebens im technischen Bereich gearbeitet hat, sie als ehemalige Lehrerin, eine kleine runde Dame mit einem ansteckenden Lachen. Connie hat sich in die Tschechische Republik verliebt, und war sehr aktiv – beispielsweise unterstützte sie großzügig das Programm der evangelischen Jugend. Mit einer Reihe von Menschen aus unserer Gemeinde pflegte sie regelmäßigen E-Mail-Kontakt und sie war eine überragende Gastgeberin für alle, die aus unserer Gemeinde nach Annapolis flogen.
Die Morans besuchten Letohrad im Herbst 2010 und noch einmal im Frühjahr 2011. Wir wussten, dass der Gesundheitszustand von Connie nicht besonders gut war und wir ahnten, dass es wahrscheinlich die letzte Gelegenheit sein würde, dass sie sich auf eine so anstrengende Reise machen konnte. 2012 begannen die beunruhigenden Nachrichten, Connie kämpfte mit einer langwierigen Gefäßkrankheit und im Frühjahr 2013 kam die traurige Nachricht von Connies Tod, Mark blieb allein zurück.
Die Morans, Letohrad und das Werk tschechischer Glasmeister
Wir trafen uns wieder im Frühjahr 2016, als Mark an einer internationalen Konferenz teilnahm, die unsere Kirche in Prag ausrichtete, und gemeinsam mit anderen verbrachte er ein Wochenende in unserer Gemeinde. Er war etwas schmaler geworden, hatte häufig Tränen in den Augen, aber immer konnte man sehen, wie er sich darüber freute, durch die Stadt zu laufen.
Er sagte uns, dass er uns gern auf irgendeine Weise eine Erinnerung im Gedenken an seine Frau stiften möchte, denn für Connie war die evangelische Kirche in Letohrad eine Herzensangelegenheit. Der neue Leuchter bot sich hierfür bestens an.
Und so begannen wir jemanden zu suchen, der einen Kronleuchter entwirft und anfertigt. Bei der Auswahl der Firmen hatten wir ein glückliches Händchen: die familiär geführte Firma Zikron aus Brno schien mit uns auf einer Wellenlänge zu sein. Wir mussten ihnen nicht einmal sagen, wie der neue Kronleuchter auszusehen habe – wir setzten uns mit dem Chef der Firma Pavel Haman und der Designerin Iva in die leere Kirche und erzählten ihnen von Mark und Connie. Und das Ergebnis ist ein wunderschönes Stück tschechischer Glaskunst, das seit November in unserer Kirche hängt. 12 Kerzenelemente, als Symbol für 12 Apostel. Gläserne Fische, das Symbol des Christentums. Blau wie die Farbe des Himmels.
Das Licht am November-Sonntag
Der gesamte Gottesdienst am 6. November 2016, zu dem Mark extra wiedergekommen war, drehte sich um das Licht: der Bibeltext, die Predigt, die Lieder. Und in dem Moment, als die Gemeinde das Lied "Vor Dir Gott, verliert die Dunkelheit ihre Macht" sang, wurden langsam alle Lichter im Saal ausgemacht, damit allein der neue Kronleuchter mit seinem Licht in der Kirche erstrahlte. Dieser Moment gehörte zu den berührendsten an diesem Sonntag.
Mark Moran kehrte nach dieser Feier nach Hause zurück. Wir glauben, dass es nicht unser letztes Treffen war und dass Letohrad nun nicht mehr nur ein Ort der Trauer um seine verlorene geliebte Frau sein wird, sondern dass die Erinnerung mit einem Tag voller Freude verbunden sein wird, als "ihr" Kronleuchter zum ersten Mal erstrahlte. Er nahm einen Brief für unsere Partnergemeinde in Annapolis mit, in welchem wir schreiben: "Connie Moran war das Licht im Leben ihres Ehemanns Mark und ihre unermüdliche Unterstützung unserer Partnerschaft brachte Licht auch in unsere Leben. Es ist uns eine große Ehre, dass in unserem Kirchsaal nun ein Kronleuchter als Erinnerung an Connie leuchtet, als Erinnerung der Zeit, als zwei Gemeinden jeweils am anderen Ende der Welt eine Gemeinschaft gründeten, die sich in eindrücklicher Weise in das Leben von jedem von uns eingeschrieben hat."
Renata Popelářová, Letohrad
Die Evangelische Akademie Prag wird mit dem Roma-Spirit-Preis ausgezeichnet
Am internationalen Tag der Menschenrechte, dem 10. Dezember 2016, fand in Prag die Verleihung des Roma-Spirit-Preises 2016 statt. Das Projekt "Roma Spirit" würdigt das Engagement derjenigen, die sich für verbesserte Lebensbedingungen der Roma in der Tschechischen Republik einsetzen. Unter den fünf Preisträgern in der Kategorie Verein/Firma/Arbeitgeber im Bereich der Sozialen Arbeit und Unterstützung der Roma-Gemeinschaft wurde auch die Evangelische Akademie Prag ausgezeichnet. Die Evangelische Akademie, die eine Fachhochschule für soziale Arbeit und ein sozialwissenschaftliches Gymnasium umfasst, hat seit 1997 einen Studiengang für soziale Arbeit im Umfeld ethnischer Minderheiten eingerichtet. Sie ermöglicht jungen Menschen aus Roma-Familien eine qualitativ hochwertige Ausbildung, auch in der Form eines Fernstudiums. Die Zahl der erfolgreichen Schulabgänger aus der Roma-Gemeinschaft ist ein Beweis für die gute Arbeit der Akademie.
Tschechische Projekte werden aus Bayern unterstützt
„Für ein gerechtes Europa“ – das ist das diesjährige Motto der Fastenaktion, die jedes Jahr von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) ausgerufen wird. Der Erlös der Fastenkollekte geht an ausgewählte Projekte weltweit, die finanzielle Unterstützung benötigen. Dieses Jahr wird die EKBB unterstützt.
Und wohin fließt das Geld dann konkret? Gemeinsam mit den deutschen Partnern haben wir vier Projekte ausgewählt, für deren Realisierung wir in den EKBB-Gemeinden Geld sammeln und uns nach weiteren finanziellen Mitteln umsehen. Es handelt sich beispielsweise um eine Generalüberholung und einen Anbau des Gemeindehauses in Havlíčkův Brod, oder um die Renovierung des Gemeindehauses in Mladá Boleslav. Unterstützt wird auch das Diakoniezentrum in Vsetín, und die dortige Arbeit mit der Roma-Gemeinschaft sowie ein Programm für Familien mit Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen.
Die gesamtkirchliche Kollekte wurde feierlich am ersten Märzwochenende in Erlangen eröffnet. Am Samstag wurden alle Projekte vorgestellt. Vertreter der Gemeinden aus Havlíčkův Brod, Přeštice und Mladá Boleslav berichteten von ihrem Gemeindeleben, was sie alles auf die Beine stellen und warum es notwendig ist, dass die Gebäude erneuert oder umgebaut werden müssen. An der Podiumsdiskussion über die Vision eines gerechten und barmherzigen Europas nahmen Vertreter der tschechischen und der bayrischen Kirche, der Universität und der Stadt Erlangen teil. Von tschechischer Seite debattierten Pavel Pokorný, Mitglied des Synodalrates, und Olga Navrátilová von der Evangelisch-theologischen Fakultät der Karlsuniversität Prag mit.
Der Leiter des Ökumenereferats, Oliver Engelhardt, stellt unsere Kirche vor, woraus wir leben und was wir machen. Synodalkurator Vladimír Zikmund und Synodalsenior Daniel Ženatý erwähnten Dinge, die ihnen im tschechischen und europäischen Kontext am Herzen liegen, und welche sie in ihrer Arbeit für die Kirche erfreuen.
Die aktive Teilnahme des Erlanger Oberbürgermeisters Florian Janik unterstrich, dass die Fastenaktion der Bayrischen Kirche von der gesamten Gesellschaft wahrgenommen wird. Das Programm wurde musikalisch von dem Chor Echo aus Zlín gestaltet. Die deutschen und tschechischen Teilnehmenden haben sich gegenseitig verköstigt, mit dem traditionellen Rinderbraten an Sahne und Knödeln, mit Franzbrötchen und Walachischen Spezialitäten, später ging man zu tschechischem Bier oder einem Schlückchen Walachischen Sliwowitz über.
Im Sonntagsgottesdienst, der liturgisch vom Erlanger Dekan Peter Huschke geleitet wurde, predigte Synodalsenior Daniel Ženatý und über Sinn und Zweck der Kollekte sprach der Ökumenebeauftragte der ELKB Michael Martin. Er erwähnte die Bedeutung die Verlautbarung des Synodalrats der EKBB, die im vergangenen Jahr an die tschechische Regierung gesandt wurde. Der Synodalrat drückte in diesem die tiefe Unzufriedenheit darüber aus, dass in der Politik moralische Autoritäten fehlten, und niemand dem Volk sagte, dass Geflüchteten geholfen werden sollte, anstatt sie abzulehnen und abzuschieben. Die Protestanten in Deutschland schätzen, dass die tschechischen Evangelischen den Mut hatten, darauf hinzuweisen, dass in der Gesellschaft Nächstenliebe und Gerechtigkeit fehlen. Und das gelte nicht nur für die tschechische Gesellschaft, sondern auch für die deutsche. Projekte, die die Kollekte unterstützt, zielen auf ein barmherzigeres und gerechteres Europa. Der Chor Echo sorgte für eine feierliches Abrundung des Gottesdienstes.
Die Evang.-lutherische Kirche in Bayern ist eine der Partnerkirchen der EKBB. Beide Kirchen arbeiten in der Grenzregion eng zusammen. In der Vergangenheit beteiligte sich die bayerische Seite beispielsweise am Aufbau eines Kindergartens in Cheb/Eger, schon lange Zeit unterstützt sie eine Pfarrstalle im böhmischen Bäderdreieck. An der Fastenkollekte beteiligen sich drei weitere kirchliche Organisationen in Bayern: Das Diakonische Werk, der Martin-Luther-Verein sowie das Gustav-Adolf-Werk Bayern. Wir hoffen, dank dieser Kollekte und einer erfolgreichen Durchführung unserer Projekte auch etwas zu einem barmherzigen und gerechten Europa beizutragen.
Daniela Ženatá
Veränderungen in der Leitung der zentralen Kirchenkanzlei der EKBB
Der leitende Geschäftsführer der zentralen Kirchenkanzlei der EKBB Martin Kocanda beendete seine Tätigkeit in dieser Funktion am 31. 12. 2016, am 1. 1. 2017 wurde er von Jaromír Plíšek abgelöst, der sich zuvor in einem Ausschreibungsverfahren durchgesetzt hatte.
Jaromír Plíšek ist Absolvent der Tschechischen Technischen Universität in Prag, gleichzeitig studierte er an der Karlsuniversität Rumänische Sprache. Ab 1993 arbeitete er im Außenministerium und wirkte als Botschafter in Rumänien und Ungarn. In den Jahren 1991-1997 war Jaromír Plíšek Mitglied des Synodalrats der EKBB als 2. Stellvertreter des Synodalkurators.
Am 31. 12. 2016 beendete auch der stellvertretende Geschäftsführer für Personalistik und Betrieb und zugleich Leiter der Betriebsabteilung Jiří Tregler das Arbeitsverhältnis. Seine Funktion übernahm am 1. 1. 2017 ein neuer Mitarbeiter, Vladimír Podroužek.
Am 31. 3. 2017 ging der langjährige stellvertretende Leiter für Außenbeziehungen, Gerhard Frey-Reininghaus, der auch die Ökumeneabteilung leitete, in den Ruhestand. In der Funktion des Leiters der Ökumeneabteilung löste ihn Oliver Engelhardt ab, der schon früher in der Ökumeneabteilung der zentralen Kirchenkanzlei der EKBB tätig war.
Neue Websites der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder
Anfang März ging der neue Internetauftritt der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder online. Sie finden diesen unter der gleichen Adresse wie den vorherigen (www.e-cirkev.cz), neu gestaltet und auch teilweise mit neuen Inhalten. Er bietet einen kurzen Einblick über unsere reiche Geschichte, das aktuelle Geschehen, sowie zukünftige Pläne und Wünsche. Sie können aber ebenso lesen, woran wir als Christen glauben, wie das kirchliche Leben aussieht und wo Sie sich mit uns treffen können.
Rechts oben kann die Kurzversion der Website auf Englisch und Deutsch ausgewählt werden, dort finden sich Informationen über die Kirche, Kontaktdaten und der Link zum Ökumenischen Bulletin.
Gleichzeitig ist eine ganz neue Website der Zentrale der EKBB unter der Adresse http://www.uckcce.cz/ entstanden – für diejenigen, die „amtliche“ Informationen suchen: über die Kirchenbüros der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder, den Synodalrat und die Synode. Diese Website hat jedoch keine Übersetzungsoption.
DIE DIAKONIE DER EKBB
 Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Tel: (+ 420) 242 487 811 (812); Fax: (+420) 242 487 834
E-mail: info@diakonie.cz
Internet: www.diakonie.cz
Die Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) ist eine gemeinnützige christliche Organisation, die Hilfe und Unterstützung anbietet für ein würdiges und vollwertiges Leben, auch wenn es durch Alter, Krankheit, gesundheitliche Behinderungen, Isolation, schwierige soziale Situationen und andere Lebenskrisen beeinträchtigt ist. Die Dienste der Diakonie der EKBB erfolgen auf der Grundlage der Botschaft des Evangeliums von der Liebe Gottes und nach dem Vorbild des Dienstes Jesu Christi. In ihren Zentren und Spezial-Schulen bietet die Diakonie soziale, gesundheitliche, Bildungs- und Seelsorgedienste an. Unter den nicht-staatlichen Organisationen, die soziale Dienste anbieten, ist die Diakonie der EKBB die zweitgrösste Institution.
Neuer Leiter der Diakonie der EKBB
Als neuer Leiter der Diakonie der EKBB wurde Jan Soběslavský vom Synodalrat der EKBB ab dem 1. April 2017 ernannt. Die Ernennung erfolgte auf Grundlage der Ergebnisse des Auswahlverfahrens und auf Empfehlung des Aufsichtsrats der Diakonie der EKBB. Jan Soběslavský (37) studierte Jura sowie Evangelische Theologie, in der Diakonie ist er seit zwölf Jahren tätig. Er begann als Rechtsberater in der Verwaltung der Organisation, im Jahr 2007 wurde er Leiter der Diakonie Brünn, die unter seiner Führung ihr Angebot an Diensten, besonders für Senioren und Menschen mit geistigen Behinderungen, erweiterte. Seit 2010 ist Jan Soběslavský Mitglied im Verwaltungsrat der Diakonie.
Die Vertreter der Diakonie, und somit auch der EKBB, dankten dem vorherigen Leiter der Diakonie Petr Haška für seine Arbeit an der Spitze der Organisation. "In diesen paar Jahren habe ich zusammen mit Ihnen und Euch viele wunderbare Momente erlebt", ließ Petr Haška allen aus der Diakonie ausrichten. Sein Grußwort zu seiner Verabschiedung kann man im Internet auf dem Kanal youtube.com/diakoniecz. in tschechischer Sprache nachhören.
Diakonie und Kirche für Asylanten
„Diakonie eröffnet Asylanten Möglichkeiten“ – so heißt das Projekt, welches die Diakonie schon seit einem halben Jahr mithilfe seines Zentrums nationaler Programme und Dienste realisiert. Dessen Mitarbeiter haben langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Migranten und Asylanten und im Rahmen dieses Asylprojekts helfen sie auf vielfältige Weise bei der Integration in die tschechische Gesellschaft. Sie wollen damit der sozialen Ausgrenzung, der Entstehung von Ghettos und weiteren Problemen vorbeugen.
In sechs Landkreisen der Tschechischen Republik sind schon oder werden bald Mitarbeiter der jeweiligen Region der Diakonie der EKBB tätig sein, die Asylanten bei der Arbeitssuche, bei der Lösung etwaiger Probleme in der Schule oder bei Behördengängen unterstützen. Sie greifen dabei auf das Netz evangelischer Gemeinden und die Zentren der Diakonie der EKBB zurück, welche ehrenamtlich zum Beispiel Nachhilfeunterricht für Kinder und Erwachsene, gemeinsames Kochen sowie sportliche Aktivitäten anbieten. Das alles hilft den Asylanten beim Aufbau nachbarschaftlicher Beziehungen und zu einer informell-freundlichen Einbindung in die neue Umgebung.
Das Projekt zielt auf eine langfristige Förderung von dreißig Asylantenfamilien ab. Die erste Phase ist für drei Jahre geplant, also bis zum Jahresende 2019 und ihre Bestandteile sind auch öffentliche Gespräche mit Asylanten, die für die Kommunen organisiert werden, in denen die Asylanten leben.
Das Diakoniezentrum nationaler Programme und Dienste hat eine Zusammenarbeit mit der Diakonie Weiden angebahnt. Freiwillige Helfer aus der Tschechischen Republik haben im dortigen Flüchtlingsheim geholfen, hauptsächlich bei der Durchführung eines Programms für die Kinder.
Adam Šůra
Die Diakonie der EKBB bietet in der Tschechischen Republik einen einzigartigen Dienst an: Therapie für Täter von häuslicher Gewalt
Menschen sind konfliktfreudig und verletzen andere oft, weil ihnen selbst etwas weh tut. Wir wollen sie nicht entschuldigen. Wir können sie aber verstehen und ihnen helfen. Wir redeten mit Anna Stodolová, der Leiterin des Therapie-Programms „Stop der Gewalt in Beziehungen“.
PhDr. Anna Stodolová (43 Jahre) absolvierte Psychologie an der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag. Seit 1996 arbeitet sie in der Diakonie der EKBB – Zentrum christlicher Hilfe in Prag, im SOS Zentrum, wo sie sich Krisen-Intervention, Psychotherapie und Beratung widmet. Sie ist beteiligt an dem Projekt Gewalt in Beziehungen, wo sie individuelle aber auch Paar-Therapie anbietet. In ihrer privaten Praxis arbeitet sie individuell mit Erwachsenen und Jugendlichen und bietet ebenfalls Paar-Therapie an. Sie ist Lektorin für Kurse über Krisen-Intervention und über die Arbeit mit Aggression in Beziehungen. Seit 2008 bietet sie Veranstaltungen für Eltern an, in denen sie sich Themen wie Erziehung und Partnerbeziehung widmet.
Sie arbeiten mit Tätern von häuslicher Gewalt, was auf den ersten Augenblick ungewöhnlich ist. Was war der Impuls zu der Entstehung dieses Programms?
An der Wiege des Programms stand die ehemalige Leiterin unseres Prager SOS Zentrums, PhDr. Jarmila Čierná. Menschen, die Erfahrungen mit häuslicher Gewalt hatten, kontaktierten uns. Wir konnten ihnen Krisen-Intervention bieten, doch für diejenigen, die durch häusliche Gewalt bedroht waren, versuchten wir Pflege in einer dafür spezialisierten Einrichtung zu finden. Wir suchten aber auch eine Antwort auf die Frage, ob die einzige Hilfe für eine Familie, in der es zu häuslicher Gewalt kommt, die Scheidung ist. Und wir fanden keine geeigneten Dienste für Menschen, die häusliche Gewalt begangen haben. Wir ließen uns also von ausländischen und tschechischen Kollegen inspirieren und allmählich entstand ein Programm, das dem gewalttätigen Partner hilft, sein Verhalten zu kontrollieren. Damit haben wir für die betroffenen Familien das Angebot vergrößert.
Was ist die häufigste Ursache dafür, dass jemand beginnt, seinen Partner zu verletzen?
Es ist schwer, eine einzige Ursache zu finden. Hinter gewalttätigem Verhalten steht wirklich eine innere Unsicherheit; der Mensch fühlt sich durch etwas oder jemanden bedroht und reagiert unverhältnismäßig. Am Anfang des aggressiven Verhaltens steht oft ein Gefühl der Hilflosigkeit. Die meisten Gewalttäter erlebten verschiedene Formen von Gewalt selbst in ihren ursprünglichen Familien und beginnen in belastenden Situationen selbst ähnlich zu handeln. Wir beschäftigen uns mit der sogenannten „hot aggression“, also mit einer Aggression, die schnell und größtenteils situationsbedingt ist. Unsere Klienten sind oft überbelastete Menschen, die paradoxerweise nicht an sich selbst denken können und nach einer Anhäufung von Frustration gewalttätig reagieren.
Wie kann ihnen eine Therapie helfen?
Der Therapeut hilft den Klienten, die Wurzeln ihrer Aggressivität zu entdecken und einen gewaltlosen Weg zu finden. Wenn Klienten zu uns kommen, heißt das, dass sie schon auf eine gewisse Weise Verantwortung für ihre Aggression übernehmen und Hoffnung brauchen, dass sie den Weg aus dem Teufelskreis der Gewalt finden. In der Therapie ist es wichtig, den Klienten zur Einsicht zu führen, dass sein gewalttätiges Verhalten andere verletzt, und dass man es ändern muss, ihm aber gleichzeitig auch zu vermitteln, dass Aggressivität in jedem von uns präsent ist, dass man nur lernen muss, mit ihr umzugehen.
Zeigt die Therapie auch Ergebnisse? Passiert es, dass ein Mensch die gewalttätigen Tendenzen komplett ablegen kann?
Allgemein ist es schwer, diese Ergebnisse zu messen. Die Therapie ist lang, die empfohlene Dauer der individuellen, wie auch der Gruppen-Therapie ist minimal ein Jahr. Falls der Mensch in die Therapie einsteigt, sie ernst nimmt und dabeibleibt, kann er aber doch Kontrolle über seine Aggressivität erlangen.
Adam Šůra
DIE EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT DER KARLSUNIVERSITÄT IN PRAG (ETF UK)
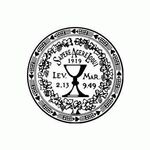 P.O. Box 529, Černá 9,
P.O. Box 529, Černá 9,
CZ 115 55 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 221 988 211; Fax: (+ 420) 221 988 215
E-Mail: intl@etf.cuni.cz
Internet: http://web.etf.cuni.cz/ETFENG-1.html
Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Karlsuniversität (ETF UK) ist die Nachfolgerin der Jan-Hus- Fakultät (1919-1950) und der Comenius-Fakultät (1950-1990). Im Jahr 1990 wurde sie in die Karlsuniversität eingegliedert. Die Verwaltung der Fakultät wird vom Dekan und dem Team der Prodekane geleitet, die auf vier Jahre in ihr Amt gewählt werden. Die Fakultät bietet Bakkalaureats- und Master-Studiengänge an – in evangelischer Theologie, Diakonie (Seelsorge und Sozialarbeit), ökumenische Studien, und verschiedene theologische Bereiche auf Doktoranden-Ebene. Die Fakultät ist ökumenisch für alle offen. Pfarrerinnen und Pfarrer der EKBB erhalten hier ihre Ausbildung.
Ein dänischer Doktorand in Prag
Morten Kock Møller studiert die theologische Anthropologie von Origenes und Augustinus an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Prag. In diesem Bericht präsentiert er das Thema seiner Forschung und seine Erfahrungen mit dem Leben in der Hauptstadt der Tschechischen Republik.
Origenes, Augustinus und Karl IV.
Auf dem wohl bekanntesten Wahrzeichen von Prag, der Karlsbrücke, also der Brücke aus dem 14. Jahrhundert, die nach dem römisch-deutschen Kaiser Karl IV. benannt wurde, steht eine beeindruckende Statue, die Augustinus von Hippo (354 – 430) zeigt. Wenn es einem gelingt, durch die Horden der Touristen zu laufen, die sich normalerweise auf der Brücke mit ihren Selfie-Sticks scharen, und zu der Statue des Augustinus zu kommen, wird man eine lateinische Inschrift finden, die sagt: „Die Sohnesverehrung errichtete (diese Statue) dem ersten unter den Lehrern, dem großen Patriarchen der Religion, dem göttlichen Vater Augustinus.“ Diese Inschrift veranschaulicht sehr gut die große Wertschätzung, in der der nordafrikanische Bischof in der westlichen Geschichte gehalten wurde. Hier in Prag, einer ehemaligen Hauptstadt des westlichen Römischen Reiches, macht sich auch der "göttliche Vater Augustinus" bemerkbar.
Christliche Anthropologie in der Herstellung
Ich bin einer von vierzehn Doktoranden, die am EU-Forschungsprogramm Horizon 2020 "Die Geschichte der menschlichen Freiheit und der Würde in der westlichen Zivilisation" teilnehmen, an dem sechs europäische Universitäten und andere Partnerorganisationen beteiligt sind. Ich habe das Privileg, die Schriften des einflussreichen christlichen Theologen Origenes von Alexandria (185-254) und insbesondere seine Gedanken über menschliche Freiheit und Würde zu studieren. Mein spezifisches Teilprojekt beschäftigt sich mit Origenes' Gedanken über diese grundlegenden Fragen in Bezug auf die Ansichten von Augustinus. Wegen der großen Autorität des Augustinus in der westlichen theologischen Tradition waren seine Ansichten über die Würde der Menschen und die Möglichkeiten des menschlichen Willens sehr einflussreich und sind es heute noch. Man könnte sogar argumentieren, dass Augustins etwas pessimistische Beschreibung des menschlichen Lebens fast die "Standard"-Position im westlichen Christentum wurde. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist es wichtig zu erkennen, dass Augustins Position in den frühen christlichen Jahrhunderten keineswegs unangefochten war. Augustins Ansichten unterscheiden sich deutlich von denen des Origenes. Die letztere präsentiert eine optimistischere Berücksichtigung des menschlichen Lebens und verteidigt konsequent die Vorstellung, dass der menschliche Wille frei ist.
Paulus - ein Verfechter der Freiheit oder ein Lehrer der Gnade?
Während ein Projekt der oben genannten Größe leicht außer Kontrolle geraten könnte, habe ich beschlossen, mich auf Origenes' und Augustins Interpretation des Paulus-Briefs an die Römer zu konzentrieren. Augustins Lesung des Briefes des Apostels hatte entscheidenden Einfluss auf diese ausgereifte Sicht auf das Verhältnis zwischen göttlicher Gnade und dem menschlichen Willen. Mehrere Gelehrte haben behauptet, dass besonders Augustins Wechselwirkung mit dem neunten Kapitel des Römerbriefs eine bedeutende Verschiebung in seinem Denken zu diesen Themen verursachte. Diese Verschiebung führte zu einer Betonung der Gnade zum Nachteil des menschlichen Willens. Davor waren Augustins Ansichten über die menschliche Freiheit (und seine Interpretation von Römer 9) denen von Origenes bemerkenswert ähnlich. Als ein Teil meiner Forschung möchte ich untersuchen, ob diese eigentümlichen Ähnlichkeiten nur ein Zufall sind, etwa durch eine gemeinsame philosophische Perspektive, oder ob der frühe Augustinus tatsächlich unmittelbar von Origenes' Kommentar zu dem Römerbrief beeinflusst wurde, und später einige der exegetischen Schlussfolgerungen von Origenes aufgab. In seinem Kommentar versteht Origenes konsequent die Aussagen des Paulus in einer Weise, die mit dem Begriff des menschlichen freien Willens vereinbar ist.
Meine "beata vita" (glückliches Leben) in Prag
Prag hat natürlich viel mehr zu bieten als Statuen von Augustinus und gut ausgestattete theologische Bibliotheken. Die Evangelisch-Theologische Fakultät, in der ich studiere, befindet sich im Stadtteil "Neustadt" (Nové Město), der im 14. Jahrhundert von Karl IV. gegründet wurde. So ist es ein sehr bequemer Ausgangspunkt für Spaziergänge im Herzen von Prag. Die Stadt hat so viele interessante und sehenswerte Orte sowie viele kulturelle Angebote wie Konzerte. Die tschechische Küche war für mich eine angenehme Überraschung mit ihren merkwürdigen Knödeln (Semmel- oder Kartoffelknödeln), Gulasch und Qualitätsbier. Es ist schwer, ein Land nicht zu mögen, wo Bier so ziemlich das gleiche kostet wie Mineralwasser in Kneipen und Restaurants!
Morten Kock Møller
Das vergessene Königreich
Prof. Israel Finkelstein von der Universität Tel Aviv besucht die ETF
Einer der bedeutendsten Besucher der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Prag (ETF) war in diesem Jahr Prof. Israel Finkelstein aus Tel Aviv. Als führender Experte für die Archäologie der alten Geschichte des Landes Israel, sowohl im Feld als auch im Studierzimmer, hat er viele internationale Preise bekommen. Finkelstein hat viele Bücher und Artikel über Israel in der Bronze- und Eisenzeit verfasst und untersucht u.a., ob die archäologischen Erkenntnisse die biblischen Erzählungen über die frühe Geschichte Israels unterstützen. Sein Besuch in Prag fand am 5.-9. Dezember 2016 im Rahmen der fortwährenden Zusammenarbeit zwischen der ETF und der Universität Tel Aviv statt. Während seines Besuchs gab Prof. Finkelstein zwei Vorträge an der ETF über archäologische Ansichten der biblischen Geschichte und besuchte auch die Einführung der tschechischen Übersetzung seines Buches "Das vergessene Königreich: Die Archäologie und Geschichte des nördlichen Israel" in der angenehmen Umgebung der Literarischen Café in der Academia-Buchhandlung.
Peter Stephens
Versteckte Kameras und arabische Lautenmusik
Ehemalige internationale Studenten der ETF treffen sich, um "Migration, Integration, Identität und christlichen Glauben" zu diskutieren
Jedes Jahr bietet die November-Sitzung des "Spolek" (Freundeskreis der Evangelisch-Theologischen Fakultät - ETF) die Möglichkeit für ehemalige internationale ETF-Studenten, nach Prag zurückzukehren, alte Freunde kennenzulernen und gemeinsam ein Thema zu diskutieren. Das Thema dieses Jahres war das Thema "Migration, Integration, Identität und christlicher Glaube". Etwa 40 aktuelle und ehemalige internationale Studenten und andere Freunde der ETF nahmen an dem Treffen am 11./13. November 2016 teil und erlangten sowohl theoretische als auch praktische Einsichten in das Thema.
Das Programm begann mit einer Vorstellung des Dokumentarfilms "Flüchtlinge", eingeleitet und kommentiert von dem Filmemacher Hassan Ezzedine. Mit dem Einsatz von versteckten Kameras zeigte er die echten Erfahrungen einiger individueller Flüchtlinge, die 2015 von der Türkei nach Griechenland übersetzen wollten. Darauf folgten Präsentationen von Michal Vašečka von der Masaryk-Universität in Brünn, der das Thema aus soziologischer Sicht untersuchte, und von Markéta Hrbková, die die Erfahrungen einer Bürgerinitiative beschreibt, die den neu angekommenen Einwanderern in der Tschechischen Republik Hilfe leistet. Am Samstagnachmittag besuchten die Teilnehmer das Integrationszentrum Prag und erfuhren etwas über seine Arbeit zur Integration von Ausländern in die tschechische Gesellschaft. Anschließend besuchten sie einen „arabischen Abend“, bei dem die in Prag lebenden Araber Aspekte ihrer Kultur vorstellten (u.a. arabische Lautenmusik und hervorragende arabische Küche).
Das Wochenende wurde mit der Jahresversammlung des Spolek und einem Gottesdienst am Sonntag beendet. Die Teilnehmer waren sich einig, dass das Wochenende sehr angenehm und lehrreich war und freuen sich darauf, im November 2017 für das nächste Spolek-Treffen nach Prag zurückzukehren.
Peter Stephens
