Bulletin 39 – Advent 2016
Editorial
Verehrte Leserinnen und Leser, liebe Freunde,
Hiermit legen wir Ihnen eine neue Ausgabe, die Adventsausgabe unseres Bulletins vor. Die Artikel widmen sich dem Zeitraum vom Sommer bis zum Ende des Kirchenjahres, thematisch nicht adventlich, doch kommen die Artikel gerade im Advent zu Ihnen. Ein neuer Anfang, mit neuer Hoffnung.
Was verdient besondere Aufmerksamkeit?
Zum Beispiel das Gespräch mit Mikuláš Vymětal, einem Pfarrer der EKBB, der auch Pfarrer für Minderheiten genannt wird. Im Artikel erfahren Sie, welch weites Aufgabenfeld er hat; neben dem üblichen pfarramtlichen Dienst wendet sich seine Hilfe an Roma und Flüchtlinge, auch an Muslime allgemein, man hört von ihm aber auch überall da, wo Unrecht geschieht.
Sich dem Unrecht entgegenstellen sollte sich jede Kirche, zwei Beispiele, die die Stellung der EKBB betreffen, eventuell auch des Ökumenischen Rat der Kirchen in der Tschechischen Republik und weiterer Vereinigungen, finden Sie auch in diesem Bulletin. Sie beschäftigen sich mit dem Roma-Holocaust und mit verfolgten chinesischen Christen.
Gerne mache ich auf einen Text aufmerksam, der den Dienst von Kaplanen betrifft. Dieser Dienst hat sich nach dem Jahr 1989, nach dem Ende des kommunistischen Regimes entwickelt; heute ist es schon eine zahlenmäßig stattliche Gruppe, die sowohl in Krankenhäusern, wie in Gefängnissen und in der Armee ihren Dienst tut. Doch dass eine Frau Militärkaplanin ist und an einer Militär-Mission in Afghanistan teilnimmt? Und dass in Tschechien auf sie der Ehemann - Pfarrer und drei noch nicht erwachsene Kinder warten?! Lesen Sie, was uns die liebenswerte Pfarrerin von dort mitteilt.
Ich bin überzeugt, dass Sie sicher auch weitere Artikel in unserem Bulletin ansprechen, die ich jetzt nicht besonders erwähnen möchte. Lesen Sie selbst.
Das Volk das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht; und über die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. 5 Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; er heißt Wunderbar, Rat, Held, Ewig-Vater Friedefürst; 6 auf daß seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Stuhl Davids und in seinem Königreich, daß er's zurichte und stärke mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. ( Jesaja Iz 9,1.5–6)
Für den Redaktionsrat grüße ich Sie herzlich und wünsche Ihnen Freude und Frieden in dieser hoffnungsvollen Zeit von Advent und Weihnachten
Jana Plíšková
DIE EVANGELISCHE KIRCHE DER BÖHMISCHEN BRÜDER
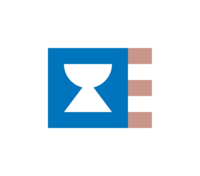 P.O. Box 466, Jungmannova 9,
P.O. Box 466, Jungmannova 9,
CZ 111 21 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 224 999 215(216); Fax: (+ 420) 224 999 219
E-Mail: ekumena@e-cirkev.cz
Internet: www.e-cirkev.cz
Entstand 1918 durch die Vereinigung der evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses und der Kirche Helvetischen Bekenntnisses. Erst nach der heftigsten Phase der Gegenreformation (1620–1781) wurden diese beiden Glaubensgemeinschaften im Land zugelassen. Die Wurzeln der EKBB liegen jedoch in der böhmischen Reformation: in der Utraquisten-Kirche (1431–1620) und der Brüderunität (1457–1620). Die EKBB hat derzeit etwa 100 000 Mitglieder, die sich auf 256 Gemeinden in der gesamten ČR verteilen. Diese gliedern sich in 14 Seniorate mit presbyterial-synodaler Organisationsstruktur. Die Kirchenleitung besteht aus dem sechsköpfigen Synodalrat, der auf sechs Jahre gewählt und durch Synodalsenior und Synodalkurator vertreten wird. In der Zentralen Kirchenkanzlei verteilt sich die Arbeit auf sechs Referate.
Wir alle sind Gottes geliebte Kinder
Von meiner Arbeit mit Minderheiten erzähle ich gern wo auch immer
Mikuláš Vymětal (*1971) studierte nach dem Abitur auf einer Industrie-Berufsfachschule Evangelische Theologie an der Karls-Universität. In Israel studierte er dann eineinhalb Jahre Jüdische Theologie und ein Jahr Judaistik und Altes Testament in Deutschland, welches auch die Themen seiner Doktorarbeit waren. Fünf Jahre war er als Pfarrer in Prag – Horní Počernice tätig, danach als Senioratspfarrer des Prager Seniorats und als Jugendpfarrer. Die letzten drei Jahre arbeitet er in Beroun, seit zwei Jahren ist er auch gesamtkirchlicher Pfarrer für humanitäre Aktivitäten, Minderheiten und sozial Ausgegrenzte. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter.
Wie und warum sind Sie Pfarrer für Minderheiten geworden?
Als Jugendpfarrer wollte ich herausfinden, was die jungen Menschen so interessiert und welchen Themen sie sich widmen. Ich entdeckte, dass sie sich mehr als für den Heidelberger Katechismus oder das Vaterunser für Themen wie „Liebe und Sex“ oder den Tod interessieren. Viele Jugendliche waren auch an sozialen Fragen interessiert. Dem wollte ich entgegenkommen. Als ich einen Diskussionsabend unter dem Motto „Christen und Squater – worin gleichen und unterscheiden wir uns“ organisierte, baten mich die Teilnehmer, mich an einem Blockade-Gottesdienst in Krupka bei Teplice zu beteiligen.
Stand dies im Zusammenhang mit den Unruhen gegen die Roma?
Es war ein Gottesdienst, der als Blockade gegen die Extremisten aus der Partei „Sociální spravedlnost“ in Krupka gedacht war. Ich hatte von einer ähnlichen Aktion gehört, die in Nový Bydžov stattfand und bei der die Polizei die Menschen auf brutalste Weise auseinander gejagt hat, es gab auch etliche Schwerverletzte. Doch während der Ereignisse in Krupka war ich am anderen Ende der Tschechischen Republik, ich habe ein Ferienlager für Kinder vorbereitet. Und ich habe erfahren, dass dort die Polizei wieder eingegriffen hat, dass es wieder Verletzte gab. Ich fühlte mich hilflos, weil ich weit weg war und nicht helfen konnte, und damit ist in mir etwas aufgebrochen. In dieser Zeit sind in Nordböhmen die Märsche gegen die Roma ausgebrochen und von da an habe ich angefangen, mit den Aktivisten, die schon länger auf der Seite der Roma standen, zusammenzuarbeiten.
Das war, glaube ich, im Jahr 2011. Damals haben wir darüber in der Kirchenzeitung Český bratr berichtet.
Ja, auch andere Pfarrer waren aktiv beteiligt und haben gute Arbeit geleistet, wie beispielsweise das Ehepaar Šimonovští in Rumburg, das die Initiative „Licht für Schluckenau“ gründete, bei der sich Roma und Nicht-Roma immer freitags in verschiedenen Kirchen trafen. Meine Aktivisten-Freunde veranstalteten solche Treffen während der Unruhen eher auf den Straßen, vor den Roma-Wohnheimen, gegen die anmarschiert wurde.
Ich kann mich erinnern, dass manche Aktionen vor allem den Kindern galten.
Ja, wir hatten das Gefühl, dass es in dem Moment, wo eine tausendköpfige Menschenmenge Hassparolen-schreiender Mitbürger auf die Roma zumarschiert, nötig ist, die Aufmerksamkeit der Kinder abzulenken, damit sie keine Angst haben. Und weil ich in der Zeit Jugendpfarrer war, überlegten wir mit den Jugendlichen, was man tun könnte, und es entstand die den Lesern gut bekannte Aktivität „Schuhkarton“.
Erzielte der „Schuhkarton“ irgendeine Reaktion?
Mir ging es um die Teilnahme der gesamten Kirche an dem Projekt. Die einzelnen Gemeinden sind wie ein Netz, das über die ganze Republik reicht. Das Evangelium hat auch ein soziales Ausmaß und es ist gut, es in die Tat umzusetzen. Und wirklich: die weihnachtliche Aktion Kinder beschenken Kinder funktioniert bis heute, viele Gemeinden haben sie übernommen.
Wie erklären Sie sich die plötzliche Beruhigung der Antiroma-Unruhen?
Ab 2013 wandte sich dieser schwer fassbare Hass der Gesellschaft gegen die Muslime und danach gegen Flüchtlinge im Allgemeinen. In Zusammenarbeit mit Roma-Freunden, aber auch Menschen aus der Kirche fingen wir dann an, in verschiedenen Städten Versammlungen für ein friedliches Miteinander zu veranstalten. Viele Muslime haben sich schnell angeschlossen. Diese Versammlungen ermöglichten es ihnen, öffentlich zur eigenen Verteidigung aufzutreten.
Wie kann man armen und von der Gesellschaft ausgeschlossenen Menschen auf andere Art helfen?
Die Gemeinden des Prager Seniorats verteilen jeden Mittwoch vor dem Hauptbahnhof Essen an Obdachlose – im Winter Suppe, im Sommer belegte Brote. Es sieht zwar aus wie Wohltätigkeit aus dem neunzehnten Jahrhundert, aber es kommen immer um die hundert Menschen.
Welche Menschengruppen würden Sie hinsichtlich der sozialen Ausgrenzung als besonders bedroht einstufen?
Es gibt viele solcher Menschengruppen in der Tschechischen Republik – es sind all die, gegen die in der Öffentlichkeit Hass geschürt wird – Muslime, Flüchtlinge, Roma, aber auch viele Gruppierungen, von denen eher selten die Rede ist – Arme, Obdachlose, Menschen, die einen Strafvollzug hinter sich haben, Suchtkranke, Mütter mit Kindern in Frauenhäusern, in Kirchen manchmal auch Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung, sogar reiche Menschen. Wenn auf dem Dorf ein reicher Fabrikbesitzer lebt, der hunderten von Menschen Arbeit gibt, ist seine soziale Position innerhalb der dortigen Gesellschaft die allerschlimmste ...
Was können Sie als Pfarrer für Minderheiten den Gemeinden anbieten?
Kontaktvermittlung und einen persönlichen Besuch. Ich besuche gerne Gemeinden oder Seniorats-Treffen unserer Kirche und rede über die aktuelle Situation verschiedener Minderheiten. Und meistens nehme ich einen Freund aus einer Minderheit mit, damit er selbst über seine Erfahrungen reden kann.
Kehren wir nochmals zu der Frage der Roma zurück. Was ist die Stärke der Roma-Kommunität?
Von den Roma können wir lernen, was stabile persönliche Beziehungen und eine funktionierende Familie bedeuten. Die Familien, die ich kenne, leben meist in Armut und haben viele Kinder (was ja auch oft ein christliches Ideal ist), aber sie halten fest zusammen und sind oftmals auch fähig, großem äußerlichen Druck und Not standzuhalten. Ich denke, dass die starke Seite vieler Roma ihre herzliche Emotionalität ist – sie können Unterstützung intensiv zum Ausdruck bringen, sie erleben auch stürmische Konflikte, aber mit einem schnellen Ende. „Der Zorn eines Roma dauert zwei Minuten,“ besagt eines ihrer Sprichworte.
Und worin sind sie hingegen verletzbar?
Ich habe zwei Hauptprobleme kennengelernt. Das erste hängt mit der hundertjährigen Diskrimination zusammen, die in der Tschechischen Republik immer noch nicht zuende ist. Es genügt, den Widerstand der Gesellschaft gegen die Schul-Inklusion von Romakindern zu beobachten. Das Ergebnis sind dann Isolation, Misstrauen gegenüber Nicht-Roma, Drogen und ähnliches, wodurch manche Romagruppen stark gezeichnet sind.
Das zweite Problem hängt mit dem Verschwinden der Roma-Sprache zusammen. Als die Roma aus der Slowakei in den fünfziger und sechziger Jahren Arbeit in Tschechien suchten, waren sie oft Analphabeten, konnten kein Tschechisch, aber dafür noch sehr gut Romani (die Sprache der Roma). Heute sind die meisten Roma, wie ich vermute, auf Facebook, dafür schwinden aber die Kenntnisse des Romani, was sehr schade ist. Es besteht die Gefahr, dass diese Sprache bei uns wirklich ausstirbt.
Was unternehmen Sie am häufigsten mit den Roma?
Ich gestalte Gottesdienste für Roma und Tschechen, und dort engagieren sich die Roma bei der Vorbereitung der Liturgie, Gebeten, Predigten (zu denen wir immer Prediger aus den Reihen der Roma einladen), und Musikaufführungen. Oft rede ich mit meinen Roma-Freunden als Pfarrer. Interessant finde ich, dass Roma immer, wenn sie herausfinden, dass ich Pfarrer bin, über ihre Träume reden wollen. Sie möchten sich über den Glauben unterhalten, darüber, dass ihnen ihre Verstorbenen erscheinen und was das für sie jetzt und in der Zukunft bedeuten wird. Andere Male versuche ich ihnen auch sozial zu helfen – beispielsweise, wenn sie intelligente Kinder haben, damit sie in eine „normale“ Schule gehen können, was für sie bedeutet, es sich gegen großen Widerstand zu erkämpfen.
Was sehen Sie künftig für eine sinnvolle Hilfe an?
Ich treffe mich regelmäßig mit Rabbi Sidon, der oft davon redet, dass Christen und Juden einen Teil des Restitutionsgeldes begabten Roma geben könnten, die dann wiederum helfen könnten, die Roma-Kultur anzuheben.
Wie sehen Roma uns Protestanten?
Die Roma vertrauen uns Pfarrern und die Kirche ist für sie ein wichtiger Platz. Aber nachdem sie aus der Slowakei gekommen waren, hörten viele von ihnen auf, in die Kirche zu gehen; die Kirche war für sie verschlossen. Aber ihr Glaube blieb erhalten. Und andererseits sehe ich in vielen Gemeinden unserer Kirche offene Türen – jemand hat ein Romakind adoptiert, an einem anderen Ort treffen sich Roma in einer evangelischen Gemeinde im Rahmen einer gemeinnützigen Organisation... So etwas begrüße ich als Pfarrer für Minderheiten natürlich.
Wieso wehte am 2. August vor den Fenstern der Kirchenleitung die Fahne der Roma?
Im zweiten Weltkrieg starben in den Konzentrationslagern auch viele Roma. Sie wurden genau wie die Juden verfolgt, aber es wird weniger darüber gesprochen. Und wenn in Lety bei Písek, an dem Ort des ehemaligen Konzentrationslagers, in dem viele Roma ermordet wurden, noch immer eine Schweinefarm steht, halte ich das für eine Missachtung des menschlichen Leidens. Damit wir also das Leiden der Roma nicht vergessen, wurde der zweite August als Tag des Roma-Holocausts ausgerufen. Darum wehte die Fahne der Roma an diesem Tag nicht nur vor dem Sitz der Kirchenleitung in der Jungmannstraße, sondern auch vor der jüdischen Gemeinde und der hussitischen Žižka-Kirche. Und es folgte ein religiös-kultureller Abend mit einem christlichen Gottesdienst, Roma-Gerichten, Roma-Tänzen und jüdischen Tänzen.
Was ist mit Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung? Welche Erfahrungen haben Sie mit ihnen?
Bei diesen Menschen geht es um eine lebenslange Einstellung, die nicht nur etwas mit der Sexualität zu tun hat, sondern mit ihrem wesentlichen Ich. Darum denken sie – oft sehr schmerzlich – über ihr Leben aus der Sicht des Glaubens nach. Selbst in der heutigen Gesellschaft ist es für sie nicht leicht, sich selbst zu akzeptieren und es den anderen einzugestehen. Manch eine Kirche aber reagiert auf so ein öffentliches Bekenntnis sehr hart und versucht Gott als jemanden zu präsentieren, der es grundsätzlich verurteilt. Dies steht aber in Gegensatz zu unserer Auffassung des Evangeliums, nach der Gott „will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“ (1Tim 2,4).
Haben Gläubige mit einer anderen sexuellen Orientierung eine Plattform?
Jahre schon funktioniert in der Tschechischen Republik der Verein Logos, der eine christlich-ökumenische Gesellschaft von „queer“-Menschen und ihren Freunde ist. Und bei dem einwöchigen Festival Prague Pride beispielsweise gibt es am Anfang und am Ende der Aktion einen Gottesdienst in der Kirche von St. Martin in der Mauer; immer sind viele Besucher da. Ich denke es ist wichtig, dass diese Menschen hören, dass Gott sie so akzeptiert, wie sie sind, und Hoffnung für ihr Leben bekommen.
Was gibt es Neues bei der Arbeit mit Flüchtlingen? Die sind bei uns auch eine Minderheit.
Bei uns gibt es wenige Flüchtlinge und sie sind in Sammelunterkünften untergebracht. Andere versuchen sich unauffällig zu integrieren – beispielsweise in der Grundschule, die meine jüngere Tochter besucht, sind auch drei Kinder aus der Gruppe irakischer Christen, die zu uns im Rahmen des Projekts 21 kamen. Ein Teil der Gesellschaft, unterstützt durch manche Politiker, zeigt sich sehr allergisch in Bezug auf Flüchtlinge. Ich denke, dass sich Christen darauf konzentrieren sollten, den paar tausend Flüchtlinge zu helfen, die wir versprochen haben aufzunehmen. Zugleich sollten sie sich bemühen, in der Gesellschaft eine freundliche Atmosphäre schaffen, damit das Leben hier überhaupt möglich ist.
Und wie gelingt der Dialog mit der muslimischen Minderheit?
Am Anfang habe ich mich ihnen sehr unsicher genähert, heute habe ich viele Freunde zwischen ihnen. In Gesprächen über den Glauben habe ich noch dazu die Erfahrung gemacht, dass sie auch einen Christen in vielerlei Dingen bereichern können. Zugleich sehe ich aber, dass es die am meisten diskriminierte Minderheit ist – aus der Perspektive nahezu der ganzen Gesellschaft, die Polizei eingeschlossen. Leider betrifft das auch die Evangelische Kirche, auch da gibt es manchmal Menschen, die mit der Diskriminierung einverstanden sind. Dabei waren wir Protestanten in der Vergangenheit auch eine verbotene, und später ungern tolerierte Minderheit.
Können Sie mir etwas über die kürzlich stattgefundene Versammlung der muslimischen Kommunität auf dem Jiří- Platz in Prag sagen, die öffentlich die terroristischen Anschläge verurteilte und die Opfer ehrte, welche Sie zusammen mit einem katholischen Pfarrer und einigen muslimischen Organisationen in der Tschechischen Republik organisieren halfen?
Terroristische Gewalt verurteilte schon Prophet Mohammed im Koran. Noch dazu haben die meisten Muslime zu Christen ein positives Verhältnis und das Ermorden eines alten Priesters beim Gottesdienst ist für sie etwas unvorstellbar Brutales. Darum besuchten Muslime in mehreren Orten Europas katholische Messen – um Solidarität zu zeigen. Der sogenannte Islamische Staat versucht mithilfe seiner brutalen Anschläge gegen Christen und alle Menschen anderer Religionen, Muslime und Nichtmuslime der ganzen Welt gegeneinander zu hetzen. Die zwei Terroristen, die Vater Jaques Hamel brutal ermordeten, erzielten aber genau das umgekehrte Ergebnis – Muslime zeigen Christen ihre Solidarität und die Christen nehmen sie an.
Was möchten sie den Lesern zum Schluß sagen?
Ich möchte allen Protestanten für die Unterstützung danken, die ich auf allen Ebenen erhalte. Ich begegne sehr unterschiedlichen Menschen, die die tschechische Gesellschaft an den Rand drückt – reichen Muslimen, armen Roma, Menschen, mit einer anderen sexuellen Orientierung und vielen mehr. Oft schäme ich mich dafür, was ich mir gedacht habe, bevor ich sie selbst kennenlernte. Für besonders grundlegend halte ich, dass ich in meiner Arbeit nicht als engagierter Einzelner auftrete, sondern als Beauftragter der Kirche, die mich schickt. So manche Abenteuer, die ich in den letzten Jahren erlebte, verwandelten meinen Glauben und lehrten mich etwas, was ich nicht erwartet hätte – seiner Kirche zu vertrauen.
Die Fragen stellte Daniela Ženatá.
Die Erklärung des Ökumenischen Rates der Kirchen in der Tschechischen Republik zur Situation verfolgter chinesischer Christen
Der Vorstand des Ökumenischen Rates der Kirchen forderte Anfang September die tschechische Regierung auf, chinesischen Christen, die sich in der Tschechischen Republik aufhalten, Asyl zu gewähren, weil sie in ihrem Heimatland wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Der Vorstand appelierte an die Regierung, schnellstens zu entscheiden. „Als Menschen, die das kommunistische Regime in der ehemaligen Tschechoslowakischen Republik, wie auch die Kontrolle kirchlicher Arbeit durch eine Partei erlebt haben, fordern wir, dass die Tschechische Republik nicht an der Unterstützung totalitärer Praktiken und Unterdrückung religiöser Gruppen und einzelner Menschen teilnimmt, sei es auch nur indirekt.“ heißt es in der Erklärung.
Die erste Gruppe von zehn chinesischen Christen kam letztes Jahr im September 2015 nach Tschechien, die nächsten sechzig in der ersten Hälfte des Jahres 2016. Bis jetzt (zum 13. 9. 2016) wurde über keinen der Asylanträge entschieden. Falls das Innenministerium den Asylbewerbern internationalen Schutz gewähren würde, würde sie damit offiziell konstatieren, dass in China Menschenrechte verletzt werden.
Der Ökumenische Rat der Kirchen in der Tschechischen Republik befasst sich schon längere Zeit mit der Beobachtung der Situation der verfolgten Christen aus aller Welt und die chinesischen Christen gehören zu dieser Gruppe. Die dortigen kommunistischen Politiker tolerieren zwar das Christentum, die Kirchen werden aber von der Geheimpolizei überwacht.
Gedenken an den Porajmos, den Völkermord der Nazis an den Roma
In der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 wurden im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau 2898 Roma ermordet – Männer, Frauen und Kinder.
An diese Geschehnisse erinnern sich jedes Jahr am 2. August Roma aus ganz Europa am Gedenktag der Vernichtung der europäischen Roma unter der nationalsozialistischen Herrschaft, dem sog. Porajmos.
Dieses Jahr entschied auch die EKBB (Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder) in Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde Prag, dem Institut Theresienstädter Initiative, und der Tschechoslowakischen hussitischen Gemeinde Žižkov- Prag sich an dem Gedenken an die Verfolgung der Roma zu beteiligen. Mit dem Hissen der Roma-Flagge am Gebäude in der Jungmannova-Straße, in dem die Zentrale Kirchenkanzlei der EKBB ihren Sitz hat, gedachte die Kirche der Opfer.
Am selben Abend fand eine kulturelle und geistliche Begegnung statt: mit einem christlichen Gottesdienst und Zeitzeugenerzählungen, bzw. den Erzählungen ihrer Nachkommen. Es traten die Roma-Tanzklasse "Gitanne" sowie die Roma-Rap-Gruppe BroKing auf und Interessierte konnten ein traditionelles Roma-Gericht kosten oder sich der Tanzgruppe anschließen.
Als Militärseelsorgerin in Afghanistan
Zur Zeit schickt die Armee der Tschechischen Republik Soldaten in mehrere Auslandseinsätze. Die meisten Soldaten (über 150) werden in das südwestliche Afghanistan ausgesandt, auf den ehemaligen russischen Luftwaffenstützpunkt Bagram Air Field.
Ihre Aufgaben sind, militärisch gesprochen, die Beteiligung an der Überwachung der Sicherheitslage im Umkreis des Stützpunktes, feindliche Tätigkeiten zu minimieren, sowie eine zivil-militärische Zusammenarbeit mit Vorstehern der lokalen Selbstverwaltung aufzubauen.
Zusammen mit den Soldaten reist jedes Mal auch ein Seelsorger oder eine Seelsorgerin mit nach Afghanistan aus.
Ich selbst bin Ende März 2016 nach Bagram ausgereist. Die Entscheidung fiel durch die oberste Führungsebene der Armee. Ehrlich gesagt hatte ich Bedenken, wie ich unter den harten Jungs zurechtkommen würde, aber während der halbjährigen Vorbereitung begann ich langsam das Vertrauen zu gewinnen, dass es gehen würde. Und auch meine Familie begann zu der Zeit, sich an die Vorstellung zu gewöhnen, dass ich ein halbes Jahr weg sein würde.
Mit ihnen sein
Die Arbeit eines Militärseelsorgers hat viele Gesichter. Den wichtigsten Zug seiner Arbeit sehe ich in einer eigentlich völlig banal erscheinenden Aufgabe: Es ist die Gegenwart, mit den Menschen dort zu sein. Den Sinn der Gegenwart unterschätzen wir häufig. Wir denken darüber nach, was war und darüber, was sein wird. Und das, was gerade ist, rinnt uns durch die Finger.
Aber schon deswegen, weil wir wissen, dass der Name Gottes gerade "ich bin" bedeutet, müssen wir wahrnehmen, dass die Gegenwart die erfüllendste Zeit ist.
Und so versuche ich mit meinen Menschen hier zu sein: bei Gottesdiensten und beim Schießen, auf der Patrouille, beim Laufen, in den Fitnessräumen, beim Waffenreinigen, in der Kantine, abends beim nichtalkoholischen Bier, beim Kaffee oder bei einer Zigarre. Ich glaube und hoffe, dass sich auf diese Weise ein gegenseitiges Vertrauen aufbauen lässt, das dann den Weg auch zu persönlichen Gesprächen eröffnet.
Kultur zur Abwechslung
Als Seelsorgerin wirke ich teilweise auch als Kulturbeauftragte. Das Leben auf dem Stützpunkt beginnt nach einer Weile sehr eintönig zu werden. Ständig aufs Neue wiederholen sich die Ausfahrten auf Patrouille, das Reinigen der Waffen, der Sport, Freizeit, Schlafen,... wieder von vorn.
Und so biete ich zusammen mit dem führenden Offizier ein Angebot an sportlichen Aktivitäten, Vorträgen und Filmvorführungen an. Auf dem Gelände kann man Fußball, Volleyball und Tischtennis spielen, es gibt Wifi-Spots und ein Kino.
Unsere Filmvorführungen und Vorträge veranstalten wir in der Kapelle, die der einzige größere Raum auf dem Bereich unserer Einheit ist. Die Kapelle dient nicht nur den Gottesdiensten und den kulturellen Aktivitäten, in ihr werden auch militärische Anweisungen erteilt, und so ist dieser Ort im Leben der Soldaten ein Dreh- und Angelpunkt. Etwa einmal im Monat fliege ich nach Kabul, wo die Leitung des tschechischen Kontingents sitzt. Ich halte dort Gottesdienste und habe die Gelegenheit, mich mit unseren Leuten aus der Befehlsführung, dem Feldkrankenhaus und mit Piloten zu treffen.
Wichtig sind Dolmetscher
Neben der geistlichen und kulturellen Arbeit sorge ich noch für afghanische Dolmetscher. Unsere Soldaten, die die Basis verlassen, sind ja häufig im Kontakt mit den Vorstehern der Gemeinden, Schulen und der örtlichen Selbstverwaltung. Meine Aufgabe ist es, jeder Patrouille Dolmetscher zuzuteilen.
Außerdem kümmere ich mich darum, neue Dolmetscher zu werben. Das ermöglicht mir, in relativ engem Kontakt zu den Afghanen zu sein und Einblick in ihre Denkweise, Kultur und Religion zu erhalten. Manchmal bringt mich die Andersartigkeit an meine Grenzen, aber auch das gehört zur Schule des Lebens.
Die Zeit eines Auslandseinsatzes ist wirklich eine spannungsreiche Zeit. Die Angehörigen haben Angst um die Soldaten, sie müssen zu Hause mit allem allein fertigwerden, mit dem Haushalt, mit der Sorge um die Kinder. Die Soldaten im Auslandseinsatz wiederum vermissen die Sicherheit eines normalen Lebens, die Unterstützung der Freunde, die Nähe ihrer Lieben. Ich selbst kann sagen, dass ich für die Unterstützung, die meine Familie von der Brünner Gemeinde erhält und die mir selbst auch zuteil wird, sehr dankbar bin.
Afghanistan ist ein Land, das seit 40 Jahren vom Krieg zerfurcht ist, der anhält, der die politische Stabilität raubt und jegliche Entwicklung unmöglich macht. Was wir bei uns als üblich annehmen, zum Beispiel ein intaktes Schulsystem, Gesundheitswesen, eine Armee und Polizei, funktioniert hier nur sehr begrenzt.
Unsere militärische Gegenwart trägt zumindest zu einem kleinen Teil dazu bei, die zerbrechliche Stabilität dieses Landes zu stützen, das unter friedlichen Bedingungen sehr attraktiv sein könnte. Besonders heute, einer Zeit, in der Fluchtgründe häufig sich verschlechternde Sicherheitsbedingungen sind, ist das Aufrechterhalten einer minimalen Sicherheit auf diesem Teil der Erde unbedingt notwendig.
Gabriela Horáková, Militärseelsorgerin (Militärkaplan) im Einsatz in Afghanistan
Christliche Begegnungstage Mittel und Osteuropas im Juli 2016
Unter dem Bibelwort „Ihr seid das Salz der Erde“ trafen sich in Budapest Christen aller Altersgruppen aus Ungarn, Deutschland, Polen, Tschechien, der Slowakei, Österreich, der Ukraine, Rumänien und weiteren Ländern. Ungarisch vermischte sich mit Deutsch und weiteren Sprachen, die Jüngeren kommunizierten ungeachtet ihrer Herkunft und mühelos auf Englisch. Es war dann nur wirklich schwer zu erkennen, wer woher stammte.
Das Hauptprogramm in der Sporthalle
In der geräumigen und angenehm klimatisierten Halle kamen alle am frühen Donnerstagabend zum Eröffnungsgottesdienst mit Abendmahl zusammen. Nach der freitäglichen Morgenandacht fanden Podiumsdiskussionen, Vorlesungen, Musik,Tanz, Film, Theater und ein Kinderprogramm statt. Die Mehrzahl der Teilnehmenden kam aus postkommunistischen Ländern, deshalb wurden im Hauptdiskussionsprogramm unter anderem folgende Fragen gestellt:Wie hat sich die Situation der Kirche nach der Wende verändert? Wohin geht die Kirche, was sind ihre Sorgen und Freuden im Jahr 2016? Was erwartet die Gesellschaft von der Kirche? Was können wir mit Ausländern und Geflüchteten anfangen? In den Ausschüssen wurden die Themenfelder Ökologie, Ethik, Familienfragen, evangelische Spiritualität, der Jahrestag der Reformation, die Bildungsarbeit mit Roma und weitere behandelt.
Für jeden der ca. 4000 Teilnehmenden war etwas dabei.
Musik und Sport
In zehn Budapester Kirchen fanden am Freitag Abend Auftritte von Vokalkünstlern und -gruppen oder Orgelkonzerte statt. Unsere Kirche war durch den Chor „Echo“ aus Zlín, Ester und Ladislav Moravetz, den Multiinstrumentalisten Tomáš Najbrt, die Gruppe Nsango malamu und das Ensemble des kirchlichen Konservatoriums Olomouc, das „Koncert Elegant Ansambl“, vertreten.
Am warmem Sonnabendnachmittag stand ein Drachenbootrennen auf dem Programm. Ein Drachenboot ist ein schmaler,langer Kahn, der durch die Kraft der zwölf Wettkämpfenden angetrieben wird, die synchron nach rhythmischen Schlägen des im Bug sitzenden Trommlers rudern. Den Wettkampf in Budapest im Altwasser der Donau bestritten Teams aus dem Gastgeberland Ungarn, aus Deutschland und ein gemischtes Team aus Tschechen und Slowaken. Nach den nötigen theoretischen Vorbereitungen, der Einübung der Technik auf dem Trockenen und einer Probe im Wasser war der einmalige Wettbewerb auf 200m an der Reihe. Den hatte das tschechisch-slowakische Team unter Kontrolle und gewann zu Wasser.
Gottesdienste in zwölf Kirchen
Die sonntäglichen Gottesdienste wurden in zwölf verschiedenen Kirchen in der ganzen Stadt gefeiert. In der reformierten Hauptkirche am Calvin-Platz waren tschechisch-ungarisch-englische Gottesdienste, an denen die Mehrzahl der Tschechen und Slowaken teilnahmen, ob von der EKBB, der Schlesischen Evangelischen Kirche, der Evangelischen Kirche in der Slowakei oder weiteren Kirchen. Synodalsenior Daniel Ženatý predigte und spendete das Abendmahl zusammen mit den örtlichen Pfarrern und Ältesten. Die Liturgie wurde vom dortigen Chor und dem Zlíner Chor „Echo“ belebt. Auch weitere Lieder erklangen in der Kirche, die von den etwa 500 Teilnehmenden zu einer Melodie, aber in vielen Sprachen, kraftvoll gesungen wurden. Danach sind wir alle gestärkt und angeregt nach Hause aufgebrochen.
Auf ein Wiedersehen in vier Jahren zu den christlichen Begegnungstagen Mittel- und Osteuropas im österreichischen Graz 2020!
Daniela Ženatá
Sommer für Jugendliche
Christen aus Europa und Asien treffen sich in Krkonoše
Ein Ausflug auf die Schneekoppe, indische Tänze, bemalte Gesichter, Debatten über den göttlichen Heilsplan– das alles und noch vieles mehr verband in der ersten Augustwoche junge Christen aus Europa und Asien. Sie trafen sich auf einem "internationalen Camp", das die evangelische Jugend der EKBB in Krkonoše veranstaltete.
Das Hauptthema des Aufenthalts war der Titel: "Discovering God's will for our lives". Zeit mit Menschen zu verbringen, die gleichgesinnt sind, und zusammen in die Bibel zu schauen, das brachte Teilnehmende aus Südkorea, Indien, Schottland, der Ukraine und der Tschechischen Republik zusammen. Es waren vornehmlich Studierende der Theologie, der Sozialen Arbeit, Lehramtsstudierende, und Studierende aus Ingenieur-Studiengängen. Der gemeinsame Glaube und das Interesse ihn zu teilen verband die Teilnehmenden über die Sprach- und Kulturgrenzen hinweg.
Jana Vondrová
Internationale Familienfreizeit
Vom 6.-13. August fand im Lager J.A. Comenius in Bělč nad Orlici eine tschechisch-schottische Familienfreizeit statt, deren Leiter Štěpán Janča und Karen Gillon waren, die etliche Andachten zum Thema "Auf dem Weg" vorbereitete. Die Freizeit gab es dieses Jahr zum ersten Mal, niemand konnte absehen, wie die Teilnehmenden mit der Zweisprachigkeit zurechtkommen würden und ob es den schottischen Schwestern und Brüdern in der einfachen Unterbringung im Ferienlager gefallen würde. Alle Sorgen in dieser Hinsicht waren aber unbegründet. Beim Programm und bei den Spielen war die fremde Sprache keine Barriere, das Programm war bunt und beinhaltete Freizeit-Dauerbrenner wie eine Olympiade und Ausflüge in die Gegend. Die schottischen Teilnehmenden bereiteten zusätzlich für alle einen schottischen Abend vor, der ein großer Erfolg war.
Eva Marková
Letohrad-Annapolis-Camp 2016 aus der Sicht einer 15-jährigen Teamerin
Vom 1. bis 5. August fand in Letohrad ein englisches Feriencamp statt. Schon seit sechs Jahren wird es von der tschechischen und der amerikanischen Kirche veranstaltet, und es ist sehr beliebt. Gastgeberin war dieses Jahr die EKBB in Letohrad. Dieses Jahr waren dort etwa 60 Teilnehmende.
Das Camp hat eine einzigartige Idee – die Kinder verbessern ihr Englisch, und zugleich lernen sie mehr über die Heilige Schrift. Das diesjährige Thema war: "Helden", was zunächst etwas vereinfacht klang und scheinbar mit der Kirche nicht besonders viel gemeinsam hat. Aber während dieser Woche haben wir dann die Wichtigkeit dieses Themas erhellt. Jeder der fünf Tage war mit einem Wort überschrieben: Frieden, Gerechtigkeit, Güte, Demut, Liebe, die vor allem mit der Bibel und ihrer Botschaft verknüpft wurde. Viele Kinder kamen aus nichtkirchlichen Familien, und so gab es für sie die Gelegenheit zu erfahren, was Kirche heißt, was es heißt, ohne Zwang zu beten, oder laut das zu sagen, was ihnen nicht ganz klar ist, und auf Verständnis zu stoßen.
Das Camp war in verschiedenen Stationen organisiert, welche alle bis zum Ende des Tages durchliefen, bestehend aus Sport, Musik, Englisch und Glauben. Ich selbst habe bei der Station "Glauben" geholfen, die bestimmt die ruhigste war. Die Kinder hatten hier die Gelegenheit, die Bedeutung des Tageswortes zu ergründen und es zu verstehen. Die Einheiten waren gefüllt von dem Gefühl der Dankbarkeit und des Respekts, während gemeinsam ergründet wurde, was das Tageswort in der Bibel bedeutet und wie es im tagtäglichen Leben zu realisieren ist. Bei der Station Glauben konnten wir verstehen, dass wir Helden sind, die die Rüstung Gottes anziehen. Während der Woche konnten die Kinder auch verschiedene Gebetsformen kennen lernen. Das war für die Kids etwas ganz Neues, denn wir haben neue und weniger traditionelle Formen des Gebets gewählt.
Die Woche wurde mit einem Auftritt für die Eltern beendet, bei dem wir alles vorstellten, was die Kinder in der Woche gelernt hatten. Es eine eindrückliche Erfahrung für mich, als ich gesehen habe, wie gut alles geklappt hat und welche fröhliche Atmosphäre das Camp erfüllt hat.
Sára Svobodová, Schülerin, 15 Jahre
Vor zwanzig Jahren Arbeitsgruppe zu den deutsch-tschechischen Beziehungen von EKD und EKBB eingesetzt
An die Kundgebung der Synode der EKD vor 20 Jahren zum Verhältnis von Tschechen und Deutschen erinnerten Oberkirchenrat Dirk Stelter (EKD) und Kirchenrat Gerhard Frey-Reininghaus (Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder – EKBB) auf der Internationalen Konferenz „Exulanten, Vertriebene und Flüchtlinge“ 14.-16. Oktober 2016 in Litomyšl (Tschechische Republik). Mit der Kundgebung hatte die Synode der EKD 1996 auf die Erklärung der Synode der EKBB zur Aussiedlung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg geantwortet.
Die EKBB wollte damals den Kreislauf gegenseitiger Schuldzuweisung aufbrechen, um einen neuen Anfang im Verhältnis von Tschechen und Deutschen zu ermöglichen. Sie stellte fest, dass es neben der deutschen Schuld bei der Zerstörung der deutsch-tschechischen Beziehungen auch auf tschechischer Seite zu Verschuldungen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gekommen ist. Die Erklärung betont: „Die radikale und scheinbar endgültige Lösung des Problems des Verhältnisses der Tschechen zu den Deutschen in den böhmischen Ländern durch ihre kollektive Aussiedlung nach dem Zweiten Weltkrieg erscheint uns, trotz alles vorangegangenen Unrechts, als moralisch verfehlter Schritt.“ Sie plädiert für eine sehr differenzierte Auseinandersetzung mit den Traumata der Vergangenheit und setzt auf „aufrichtige Reue, gegenseitiges Bemühen um Verständnis, und die Sehnsucht nach Versöhnung“.
Die EKD antwortete mit einem Dank an die EKBB für die ausgestreckte Hand zur Versöhnung und bekennt sich zur deutschen Schuld, für die sie um Vergebung bittet. In der Kundgebung der Synode der EKD heißt es: Mit Ehrfurcht und Ernst vor Gott suchen wir Vergebung dieser Schuld. Wir bitten unsere tschechischen Schwestern und Brüder um Vergebung und gewähren, soweit es uns zukommt, ebenfalls Vergebung.“
Daraufhin setzten EKD und EKBB im Dezember 1996 eine Arbeitsgruppe ein, die in der auf Deutsch und Tschechisch erschienenen Publikation „Der trennende Zaun ist abgebrochen“ 1998 die besonders schwierigen Phasen in der deutsch-tschechischen Geschichte aufarbeitete:
- 1918: die Rolle der Deutsch-Böhmen bei der Gründung der Tschechoslowakei
- 1938/39: die Annexion der Sudetengebiete und die Zerschlagung der Tschechoslowakei
- 1945/46: die Vertreibung und Aussiedlung der Sudetendeutschen
Zudem wurden tschechische und deutsche Versöhnungsinitiativen vorgestellt, wie z.B. in Lidice, einem Ort, der von den Deutschen im Rahmen der Heydrichiade 1942 zerstört worden war.
Schließlich enthält das Buch Material für tschechisch-deutsche Gottesdienste, das bis heute gerne verwendet wird.
Die internationale Konferenz „Exulanten, Vertriebene und Flüchtlinge“, für die der EKD-Ratsvorsitzende Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm die Schirmherrschaft übernommen hatte, wurde vom Verein Exulant veranstaltet. In ihm haben sich Nachfahren von Glaubensflüchtlingen aus dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik zusammengeschlossen, um das Wissen über diese Geschichte wach zu halten, das heute auch für ein tieferes Verständnis der Flüchtlinge sensibel machen kann.
So berichtete eine Gruppe von christlichen Flüchtlingen aus Burma, die seit 2008 in der Tschechischen Republik lebt, über ihre derzeitige Situation: Sie hätten in Tschechien von Christen viel Hilfe empfangen. Trotzdem sei das Leben vor allem für die Älteren sehr schwer, die Jüngeren hingegen fänden sich in der neuen Heimat wesentlich besser zurecht. OKR Dirk Stelter referierte zur aktuellen Situation der Flüchtlinge in Deutschland und dem Engagement der EKD in der Flüchtlingshilfe.
Die Konferenz schloss mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche der Auffindung des Heiligen Kreuzes, an dem Geistliche aus der EKBB, der römisch-katholischen Kirche, der Brüderkirche, der Baptisten und der Tschechoslowakischen Hussitischen Kirche teilnahmen. In seiner Predigt erinnerte Stelter daran, dass gemäß Apostelgeschichte 13 zwei Afrikaner und ein Asiat in der asiatischen Stadt Antiochia den Apostel Paulus zur Verkündigung des Evangeliums auf eine Reise sandten, die ihn schließlich auch nach Europa führte. „Interkulturalität gehört zur DNA der Kirche“, betonte er. Ohne sie hätte das Christentum gar nicht von Jerusalem nach Mitteleuropa gelangen können. Das schließe gleichzeitig die Verpflichtung ein, Christen aus anderen Ländern als Geschwistern im Glauben offen zu begegnen. Die Kollekte im Gottesdienst wurde für die Flüchtlingshilfe der EKD gesammelt.
Gerhard Frey-Reininghaus und Dirk Stelter
DIE EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT DER KARLSUNIVERSITÄT IN PRAG (ETF UK)
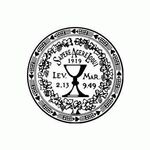 P.O. Box 529, Černá 9,
P.O. Box 529, Černá 9,
CZ 115 55 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 221 988 211; Fax: (+ 420) 221 988 215
E-Mail: intl@etf.cuni.cz
Internet: http://web.etf.cuni.cz/ETFENG-1.html
Steht in der Nachfolge der Hus-Fakultät (1920–1950, unterbrochen 1939–1945) und der Comenius-Fakultät (1953-1990). 1990 wurde sie in die Karlsuniversität integriert. Mit ihrer Leitung sind der Dekan und vier Prodekane betraut, die auf drei Jahre gewählt werden. Die Fakultät umfasst acht Lehrstühle und drei Institute, im Studienjahr 2005/2006 sind etwa 480 Studierende eingeschrieben. An der ETF UK erhalten die zukünftigen Pfarrerinnen und Pfarrer der EKBB ihre theologische Ausbildung.
Die Rolle der Prager theologischen Fakultät ändert sich ständig
Die Evangelische Theologische Fakultät der Karlsuniversität (ETF) hat viele Änderungen in ihrer Geschichte erlebt, von denen viele unerwartet und mit den politischen Veränderungen in Tschechien verbunden waren. In den letzten Jahren kann man einen allmählichen Wechsel erkennen, gegenwärtig mehr aus soziologischen Gründen, was mit einem Rückgang der Studentenzahlen von fast 25% in den letzten vier Jahren verbunden ist.
Die ETF wurde von der neu-gegründeten Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) 1919 geschaffen, um ihre Studenten der Theologie, sowie auch die aus anderen Kirchen - nach dem Zusammenbruch des Österreichisch-Ungarischen Reiches und der Gründung des freien Tschechoslowakischen Staates - zu unterrichten. In den folgenden Dekaden veränderten sich die Erfolge der Fakultät ständig. Während der dreißiger Jahre studierten hier mehr als 200 Studenten aus verschiedenen Kirchen ; in der Zeit der deutschen Besatzung (1939-1945) war die Fakultät völlig geschlossen. Und während des Kommunismus (1948-1989) hat die Fakultät unter vielen direkten und indirekten Beschränkungen gelitten mit der Zahl der Studierenden niedriger als 50 in manchen Jahren. Trotzdem hielt die Fakultät an ihrer ursprünglichen Absicht fest, primär eine Einrichtung für die künftigen evangelischen Pfarrer zu sein.
1989 kam das kommunistische Regime zum Ende, und das, zusammen mit der Inkorporierung der Fakultät in die Karlsuniversität, die 1990 geschah, war eine Wende in der Fakultätsgeschichte. Als Teil der Universität war die ETF verpflichtet, alle Studenten, die die akademischen Kriterien erfüllten zu akzeptieren, und dadurch erhielt sie eine neue Aufgabe, eine geisteswissenschaftliche Ausbildung anzubieten. Viele der Studierenden waren nun keine Mitglieder einer Kirche mehr – sie studierten Theologie einfach weil sie sie interessant oder sogar exotisch fanden. Und das theologische Diplom von der Karlsuniversität öffnete die Türvieler Arbeitsstellen, die mit der Kirche nichts zu tun hatten. Eine weitere Folge dieser Inkorporierung in die Karlsuniversität war eine wachsende Betonung der akademischen Forschung, was zum Anstieg der Zahl der Doktoranden führte. In den späten neunziger Jahren stellte die ETF neue Studienprogramme neben der traditionellen evangelischen Theologie vor. Theologie der christlichen Traditionen ist ein ökumenisch-gegründetes Programm für Personen, die nicht Pfarrer werden wollen, doch eine theologische Grundausbildung suchen. Pastorale und soziale Arbeit bietet eine Ausbildung der sozialen Arbeit mit diakonischer Betonung.
Diese Erweiterung des Geltungsbereichs führte zu einer enormen Zunahme der Zahl der Studenten. Durch die Achtziger blieb diese Zahl stabil bei rund 100-110. 1994-1995 hat dies auf 220 verdoppelt, und 2000-2001 wuchs die Zahl wieder auf ca. 450. Nachdem wuchs die Anzahl weiter, wenn auch langsamer, mit der Spitze von 809 Studenten im akademischen Jahr 2011-2012. Dieses Wachsen der Studentenanzahl nach 2000 war doch hauptsächlich durch den Anstieg der Studentenzahl im Bereich Pastoral- und Sozialarbeit verursacht. Von den 809 Studenten 2011-2012, 465 studierten Sozialarbeit.
Seitdem - zum ersten Mal seit 1989 - sank die Studentenanzahl je mehr jedes Jahr. 2015-2016 gab es nur 621 Studierende, die an der Fakultät eingeschrieben waren. Ein Rückgang von fast 25 % in vier Jahren. Dieser Verfall kann teilweise gewiss durch demographische Gründe erklärt werden - es gibt weniger 18- und 19-jährige in der Bevölkerung als es vor vier Jahren gab. Doch ein genauerer Blick auf die Statistik zeigt etwas anderes.
Hier kann man sehen, dass die Anzahl der Studenten der Sozialarbeit nur leicht gesunken ist, und die Anzahl der Studenten der Theologie ist jetzt etwa 40 % davon, was es vor vier Jahren war. Wir können nur spekulieren über die Gründe dieser Veränderung. Sie können von der wachsenden Säkularisierung der tschechischen Gesellschaft abstammen, sowie vom Rückgang der Kirchenmitgliedschaft, vom niedrigen Gehalt und Status der Pfarrer in Tschechien, oder von der ungewissen finanziellen Zukunft, die aus dem gegenwärtigen Vertrag zwischen den Kirchen und dem Staat hervorgeht, der wahrscheinlich zur Abschaffung und Verschmelzung von vielen Gemeinden führen wird.
Natürlich ist die ETF in dieser Situation nicht allein. Die Anzahl der Studenten der Theologie sinkt in vielen europäischen Ländern. Theologische Fakultäten adoptierten unterschiedliche Strategien, mit diesem Problem umzugehen - manche Fakultäten hören völlig auf, und andere verschmelzen mit anderen Institutionen. Die drei theologischen Fakultäten der Karlsuniversität haben alle neue Studienprogramme neben der Theologie geöffnet, um die Zahl der Studenten auf einem lebensfähigen Niveau halten zu können. Wir haben gesehen, dass die Mehrheit der Studenten der ETF die Sozialarbeit studiert. Ähnlich studiert die Mehrheit der Studenten der Katholisch-theologischen Fakultät Kunstgeschichte, und an der Hussitischen Fakultät gibt es eine Vielfalt von Studienprogrammen, einschließlich Religionsunterricht, Spezielle Bedürfnisse Lehre, Jüdische Studien und Sozialarbeit - neben der Theologie.
Trotzdem gibt es noch eine andere Statistik, die berücksichtigt werden muss. Die Absolventen der Theologie aus der ETF, die Pfarrer werden möchten, müssen ein weiteres Jahr praktischer Übungen - das Vikariat - abgeschlossen haben, bevor sie ordiniert werden dürfen. Und hier sind die Zahlen während der letzten zehn Jahre relativ stabil geblieben, in jedem Jahrgang gab es zwischen 5 und 8 Vikare. Das mag bedeuten, dass dieser Fall der Theologiestudenten nicht deswegen stattfindet, dass weniger Leute als vorher Pfarrer werden wollen, sondern weil es nun weniger von denen gibt, die aus anderen Gründen Theologie studieren wollen.
Niemand kann sagen, ob der Rückgang der Studentenzahlen sich noch fortsetzen wird. Aus der Sicht des Vikariats scheint es so zu sein, dass die ETF noch Zeit braucht, ihrem ursprünglichen Auftrag nachzukommen, d.h. die Theologen für ihren Dienst zu trainieren. Doch die Realität ist, dass dies nur eine ihrer Funktionen ist, und statistisch eine von kleinerer Wichtigkeit.
Peter Stephens, Internationale Abteilung, Evangelische Theologische Fakultät
Fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Prag und Tel Aviv
Die Evangelische Theologische Fakultät (ETF) der Universität Prag, in diesem Fall der Lehrstuhl für Altes Testament, arbeitet schon seit einigen Jahren mit dem Archäologischen Institut der Universität in Tel Aviv zusammen.
Der Grundstein für die Zusammenarbeit wurde im Jahr 2008 gelegt, als es gelang, einen Kontakt zum Leiter des Instituts für Archäologie, Herrn Prof. Lipschits, und dem Leiter der Ausgrabung in Ramat Rachel herzustellen. Die enge Zusammenarbeit wurde im Jahr 2011 vereinbart und seit dem Jahr 2012 reisen jedes Jahr im Sommer Lehrende der ETF zusammen mit Studierenden auf eine archäologische Ausgrabung nach Tel Azekah, ein bedeutsamer Ort des Altertums. Es handelt sich dabei um eine für ihre Zeit monumentale Festung, die spätestens seit der mittleren Bronzezeit bestand. Die Festung, die später als Grenzfestung zum Königreich Juda diente, wurde zuerst von den Assyrern im 8. Jahrhundert v. Chr., dann von den Babyloniern im 6. Jahrhundert v. Chr. zerstört.
Die Zusammenarbeit mit Tel Aviv spielt sich nicht nur auf dem Ausgrabungsgelände und nicht nur in Israel ab. Wissenschaftler aus Tel Aviv reisen auch regelmäßig an die Evangelische Fakultät in Prag und halten Vorträge, gastweise auch im Archäologischen Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (AV ČR).
Das gleiche gilt auch umgekehrt: Tschechische Vertreter beteiligen sich aktiv an dem neuen mehrjährigen Projekt mit dem Titel: Das letzte Jahrhundert in der Geschichte des Königreichs von Juda (orig.: The Last Century in the History of the Kingdom of Judah). Im Rahmen dieses Projektes finden regelmäßig Kolloquien an der ETF und am Institut für Archäologie in Tel Aviv statt. Ziel ist es, das interdisziplinäre Gespräch zwischen Archäologen und Exegeten (samt den anderen theologischen Disziplinen) zu vertiefen und das Interesse der Studierenden an der biblischen Archäologie zu wecken, z.B. im Rahmen eines Magister- oder eines Doktorat-Studiums.
Der internationalen Zusammenarbeit der ETF mit Tel Aviv widmeten sich auch die Medien in etlichen Sendungen und Vertreter der tschechischen Diplomatie in Tel Aviv, der Botschafter Ivo Schwarz und der Leiter des Tschechischen Zentrums Lukáš Přibyl, unterstützten sie mit einem Besuch auf den Ausgrabungsstätten und bei Konferenzen.
An dieser Stelle soll auf die Feierlichkeiten zur Einweihung der Übersetzung des neuen Buchs von I. Finkelstein "The forgotten Kingdom" am 8. Dezember 2016 an der ETF hingewiesen werden. Es wird öffentliche Vorträge des Märzseminars mit Prof. Y. Gadot sowie der Mai-Exkursion nach Jerusalem geben. Die Gruppe, bestehend aus Lehrenden und Studierenden der ETF, hat sich dort an der führenden archäologischen Forschung beteiligt, welche im Rahmen des Projektes Exploring Ancient Jerusalem von der Universität Tel Aviv und dem Kimmel Center for Archaeological Science durchgeführt wird.
Filip Čapek, Lehrstuhl für Altes Testament, Evangelische Theologische Fakultät der Karlsuniversität Prag
DIE DIAKONIE DER EKBB
 Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Tel: (+ 420) 242 487 811 (812); Fax: (+420) 242 487 834
E-mail: info@diakonie.cz
Internet: www.diakonie.cz
Diakonie der Evangelischen Kirche der böhmischen Brüder (DEKBB) ist eine christliche nichtstaatliche Organisation, die allen Menschen Hilfe, Unterstützung und Pflege leistet, die trotz ihres Alters, trotz Krankheiten oder Behinderung, trotz Einsamkeit oder auch in schweren sozialen Situationen Anspruch auf ein würdiges Leben haben. Der Dienst der Diakonie der
EKBB gründet sich auf der Botschaft des Evangeliums von der Liebe Gottes und orientiert sich am Beispiel von Jesus Christus. InTschechien gehören wir zu den größten Organisationen,die soziale Dienstleistungen anbieten. Täglich helfen wir tausenden Klienten in der direkten Pflege. Wir leisten Sozial-, Gesundheits-, Bildungs- und Seelsorgedienste in 33 Einrichtungen und 8 Sonderschulen.
Der Kindergarten in Cheb
Der Kindergarten der Diakonie im westtschechischen Cheb besteht seit einem Jahr und beginnt nun sein zweites. Seine Gründung wurde von einer Reihe evangelischer Gemeinden aus Deutschland unterstützt. Wie es in dem neuen Kindergarten vorangeht, fragten wir dessen Leiterin Iva Koubová.
Der Kindergarten stellt im Vergleich zum Vorjahr eine höhere Zahl an Plätzen zur Verfügung. Wieviele Kinder werden ihn in diesem Schuljahr besuchen?
Wir haben zwei Kinder mehr als im letzten Jahr, jetzt 42. Wir könnten noch zwei weitere Kinder aufnehmen, aber in Cheb bestand dazu in diesem Schuljahr keine Notwendigkeit. Gerade kommt uns das gelegen, denn wir haben in diesem Jahr im Kindergarten mehr Inklusionskinder und für sie sind kleinere Gruppen schöner.
Wie sieht die Zusammenarbeit mit der örtlichen Gemeinde der EKBB aus? Seit September hat dort ein neuer Pfarrer seinen Dienst begonnen.
Der Kindergarten ist eine kirchliche Einrichtung und wir wollen natürlich, dass sich das in der Arbeit mit den Kindern zeigt. Der Großteil unserer Kinder ist aus nicht- kirchlichen Familien. Ich schätze, dass nur zwei oder drei Familien gläubig sind. Als wir im letzten Jahr ein christliches Gruppenangebot gemacht haben, hat sich von vierzig Kindern eines dazu angemeldet. Der neue Pfarrer probiert deshalb ein anderes Angebot aus. Einmal im Monat kommt er und gestaltet eine Einheit mit einem Märchen oder einer Geschichte und singt mit uns,begleitet von der Gitarre, Lieder und das wird angenommen. Den Kindern gefällt so ein Programm.
Und wie ist es mit den Eltern?
Die nehmen dieses Programm auch an. Mit allen Eltern habe ich einzeln über die christliche Ausrichtung unseres Kindergartens gesprochen, weil ich weiß, dass es für sie ein sensibles Thema ist. Aus den Einzelgesprächen lässt sich allgemein ablesen, dass sie die Vermittlung biblischer Geschichten und christlicher Werte und Traditionen wertschätzen. Sie lehnen aber Glaubensäußerungen wie das Gebet ab.
Sie haben erzählt, dass auch Inklusionskinder den Kindergarten besuchen. Wieviele sind es und in welcher Weise sind sie beeinträchtigt?
Wir haben zwei Kinder mit Formen von Autismus und eines mit Kinderlähmung.
Und wie gestaltet sich die Inklusion?
Letztes Jahr hatten wir für unsere zwei Kinder mit Autismus einen Assistenten. Wir haben festgestellt, dass das zu wenig ist, die Arbeit ist dann sehr anstrengend. Dieses Jahr haben wir zwei Assistenten und gern hätten wir noch Antrag auf einen dritten gestellt.
Wodurch unterscheidet sich der Kindergarten noch von anderen Einrichtungen in Cheb?
Unser Gebäude ist barrierefrei. Die Kinder lernen kostenlos Deutsch und als einziger Kindergarten in Cheb fahren wir zu einem wöchentlichen Ausflug in die Natur. Und das gefällt nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern und Erziehern. Auch ist es für uns wichtig, dass wir die Kinder in einer anderen Umgebung als der des Kindergartens erleben. Also freuen sich auch die Kinder sehr auf den nächsten Ausflug.
Die Fragen stellte Adam Šůra.
Werte und diakonische Arbeit in der Schweiz und bei uns
In der heutigen Zeit, in der auch Dienste als Waren und bedürftige Menschen als Klienten betrachtet werden, in der wir auch in diesem Bereich von Konkurrenz unter den Anbietern reden, wird es für die Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder immer wichtiger, sich über den eigenen Platz zwischen anderen Anbietern sozialer Dienste klar zu werden, sich nach der eigenen Identität zu fragen, nach dem, was sie definiert und von Anderen unterscheidet.
Wie soll man in einem Land, in dem 90% der Bürger keiner Religion angehören und trotz Benachteiligung nichtstaatlicher Organisationen der Konkurrenz anderer Dienstleister standhalten? Wie soll man Seelsorge leisten, wenn mehr als 85% der Angestellten und Klienten nicht religiös sind? Wie soll man neue Mitarbeiter gewinnen, wenn es an finanziellen Mitteln mangelt, und wie die bestehenden erfahrenen und guten Mitarbeiter halten.
Vor zwei Jahren hat unsere Diakonie angefangen, sich mit diesen Fragen intensiv zu beschäftigen. Eine kleinere Gruppe aus unserer Diakonie besuchte damals eine Einrichtung der Stiftung diakonischer Arbeit in Neumünster und eine Schweizer Krankenpflegeschule in Zollikerberg bei Zürich. Hier werden ein Krankenhaus, ein Seniorenheim, ein Heim für Alzheimer-Kranke, ein Hospiz, eine Tagespflege, eine Bildungseinrichtung, ein Heim der diakonischen Schwesternschaft, und Unternehmen in angeschlossenen Bereichen wie Gastronomie, Gärtnerei und Wäscherei betrieben. Ein Bestandteil des Areals sind auch wunderschöne Gärten mit Plätzen zur Meditation. In Zollikerberg gibt es ungefähr die gleiche Anzahl von Mitarbeitern wie in der Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder. Die Institution beeindruckte unsere Gruppe nicht nur mit ihrem sichtbaren Erfolg, sondern vor allem durch ihre außergewöhnliche Atmosphäre. Dass nicht nur die tschechischen Besucher eine solche Atmosphäre wahrnahmen, zeigt auch der Fakt, dass bei einer Meinungsumfrage unter schweizer Klienten auch sie als Hauptgrund für die Wahl dieser Einrichtung und für ihre Zufriedenheit eben die Tatsache anführten, dass sie sich gut und in guten Händen fühlen.
Die Möglichkeit nach Zollikerberg zu fahren, bekam im Mai diesen Jahres eine 40 köpfige Gruppe von Leitern diakonischer Zentren der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder. Hauptthema des Besuches war das Kennenlernen des ausgearbeiteten Wertesystems, das alle Gebiete durchdringt, vor allem die Arbeit mit den Klienten, Personalistik, Fundraising und das Zusammenleben mit dem Diakonissenorden.
Der Stiftungsleiter Dr. Werner Widmer und seine Mitarbeiter sehen die Entstehung solch einer Atmosphäre und der folgenden Prosperität klar in einer konsequenten Lehre und im täglichen Respektieren des Wertesystems, in das nicht geringe Summen und Anstrengungen investiert wurden. Diese Werte und ihr Arbeitssystem wurde den Vertretern der Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder freundlicherweise in Form einer zweitägigen Schulung über Werte, Ethik, Personalistik, Bildung, Seelsorge vorgestellt.
Der Aufgabe, Werte zu formulieren, stellte man sich in Zollikenberg in dem Augenblick, in dem die Diakonissen-Schwesternschaft, die seit Jahren Zentrum und Geist der Arbeit dieser Institution waren, mit unglaublicher Demut eingestehen mußte, dass sie mit ihren alten Arbeitsmethoden weder neue Diakonissen noch die Öffentlichkeit erreicht. Sie unterstützten mit ihren Gebeten die Suche nach neuen Wegen für Mission und moderne Spiritualität in der diakonischen Tätigkeit. Die Begegnung und die Diskussion mit den Diakonissen in der wunderschönen Kapelle war für viele sicher auch ein außergewöhnliches Erlebnis.
In der Schweiz übersteigt das Angebot an Diensten im Bereich Gesundheit und Soziales und Diensten für Senioren die Nachfrage. Es gibt viel Konkurrenz und anspruchsvolle Klienten. Doch es gibt nicht genug qualifiziertes und professionelles Personal. Dank seines Rufes ist die Einrichtung des Diakonischen Werkes sehr begehrt und das auch bei Senioren in der Oberschicht der Gesellschaft, die über eine Zusatzversicherung verfügen. Dank der ausreichenden Anzahl dieser Klienten kann dann auch Klienten mit einer Grundversicherung ein Einbettzimmer angeboten werden. Das ist in der Region einzigartig. Die Institution baut im Areal ein neues notwendiges Gebäude. In Zollikerberg gibt es keine Probleme, Personal zu finden und einzustellen, obwohl der Lohn nicht höher als bei der Konkurrenz ist.
Bei der Arbeit sollen sich die Angestellten 5 grundlegende Regeln für die Arbeit mit den Klienten und Mitarbeitern zu eigen machen. Sie selbst können sich aber darauf verlassen, dass auch sie aufgrund dieser Regeln im Verhältnis Vorgesetzte – Angestellte so behandelt werden. Über diese Regeln wird mit den Bewerbern schon in der Einstellungsphase geredet.
Bei dem Formen dieser Regeln sehen wir eine tiefe Verbundenheit zwischen dem Orden der Diakonissen und der biblischen Botschaft, weil jede Regel seinen Ursprung in einem biblischen Text hat.
Diese Werte lauten:
- Gegenseitige Achtung, einander respektieren (Liebe deinen Nächsten… Mk 12,31)
- Partnerschaft (Einer trage des anderen Last… Gal 6,2)
- Verbindlichkeit (Eure Rede sei ja, ja… Mt 5,37)
- Transparenz (Was wahrhaftig ist, was ehrbar ... – darauf seid bedacht! Phil 4,8)
- Das Ganze sehen – den anderen als Ganzes sehen (Der Leib bildet ein Ganzes … 1Kor 12,12)
In Zollikerberg begegneten wir einer modernen Leitung und außergewöhnlichen Menschen. Wir schätzen zutiefst die Zeit und Aufmerksamkeit, die den Leitern unserer Zentren gewidmet wurde. Hoffentlich können wir zu der Ausbreitung der guten Nachricht beitragen, dass wir ein diakonisches Werk gesehen und erlebt haben, dass dank vorurteilsfreier Durchsetzung und Bildung in Sachen christlicher Werte hoch angesehen ist. Ich denke in diesem Zusammenhang an den biblischen Vers Mt 6,33: ,,Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt und alles andere wird Euch hinzugefügt werden.“ Bitte beten sie mit uns und für uns.
Kateřina Svobodová
