Bulletin 38 – Sommer 2016
Editorial
Verehrte Leserinnen und Leser, liebe Freunde,
die Sommernummer des Bulletins liegt vor Ihnen. Wie immer enthält sie nicht nur Artikel, die unsere Kirche betreffen, sondern auch Artikel über unsere Fakultät und Diakonie, d.h. die EKBB, ETF und die Diakonie der EKBB. Überall ist vieles geschehen, und manches davon haben wir aufgeschrieben und wir glauben, dass auch Sie einiges mit Freude lesen möchten.
Was ist vor allem zu erwähnen?
Alles ist wichtig und wertvoll, und so nur im Fluge: Nach sechs Jahren haben wir uns von unserer lieben Kollegin, Frau Karen Moritz, Pfarrerin der Amerikanischen presbyterianischen Kirche (PC USA) aus Nebraska, hier in der Zentralen Kirchenkanzlei der EKBB verabschiedet. Sie hat uns in der ökumenischen Abteilung geholfen, sie besuchte die Gemeinden der EKBB, hat viele Texte übersetzt und führte die englischen Konversationskurse. Aus dem Gespräch, das mit ihr in dieser Nummer geführt wird, können Sie mehr erfahren.
Sicherlich lesenswert ist auch das Gespräch mit Frau Rosa María Payá, einer Dissidentin aus Kuba, die in Prag im März dieses Jahres beim „Tag für Kuba“, der von der EKBB und der gemeinnützigen Organisation People in Need organisiert wurde, zu Gast war. Rosa widersteht den Schrecken des Kubanischen Regimes und folgt mutig ihrem Vater, Herrn Oswald Payá, ein Kämpfer für die Freiheit und Freund von Václav Havel.
Wir kehren auch zu Pavel Filipi zurück. Ladislav Beneš, ein Theologe und Kollege von Pavel Filipi, schreibt von der Bedeutung von Pavel Filipi für die Evangelische Theologische Fakultät sowie für die ganze EKBB.
Sie können auch über manche Aktivitäten der Diakonie der EKBB lesen; man kann kaum überschätzen, was sie für Menschen mit Behinderungen, sowie auch für Senioren, verlassene Mütter mit Kindern und so weiter und so weiter tut.
Lassen Sie uns noch auf das Thema der Flüchtlinge aufmerksam machen – dieses Thema wird immer aktueller und sicherlich werden wir zu ihm noch zurückkehren.
Was die Evangelische theologische Fakultät betrifft, können Sie diesmal etwas über das Aprilseminar, das Rückkehr aus den Grenzen hieß, erfahren. An dem Seminar haben Freiwillige gesprochen, die den Migranten dem „Balkanischen Weg“ entlang geholfen haben.
Wir glauben, dass Sie sich mindestens für manche Artikel interessieren werden, und wir wünschen Ihnen eine erholsame zweite Hälfte des Sommers und eine ruhige Heimkehr aus dem Urlaub.
Im Namen des Redaktionsrates
Jana Plíšková
DIE EVANGELISCHE KIRCHE DER BÖHMISCHEN BRÜDER
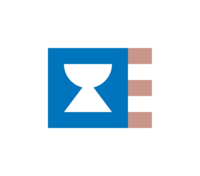 P.O. Box 466, Jungmannova 9,
P.O. Box 466, Jungmannova 9,
CZ 111 21 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 224 999 215(216); Fax: (+ 420) 224 999 219
E-Mail: ekumena@e-cirkev.cz
Internet: www.e-cirkev.cz
Die Grundlagen der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) wurzeln in der Utraquistischen Kirche (1431–1620) und in der Brüderunität ((1457–1620). Die EKBB entstand in ihrer heutigen Gestalt im Jahr 1918 durch den Zusammenschluss der bis dahin selbständigen evangelischen Kirchen Augsburger und Helvetischen Bekenntnisses. Deren Existenz wurde nach dem Ende der harten Gegenreformation, die von 1620 bis zum Erlass des Toleranzpatens durch Kaiser Joself II. im Jahr 1781 dauerte, erlaubt. Die strengen Beschränkungen mussten die Evangelischen freilich auch danach beachten, bis zum Erlass des Protestantenpatentes im Jahr 1861.
In der Zeit ihrer Entstehung hatte die EKBB 250 000 Mitglieder, im Jahre 1938 waren es dann schon 325 000 Mitglieder. Heute ist die Kirche in 14 Seniorate aufgeteilt mit einer Gesamtzahl von 250 Gemeinden und ca. 80 000 Gemeindegliedern. Die Kirche wird vom sechsköpfigen Synodalrat geleitet, der auf sechs Jahre gewählt wird. Repräsentiert wird die Kirche vom Synodalsenior und vom Synodalkurator.
Kuba-Tag 2016. Eine Demonstration mit weißen Schirmen und Ballons - schon zum sechsten Mal
Nach etwa 90 Jahren erhielt Kuba wieder Besuch vom amerikanischen Präsidenten. Nur einige Stunden vor dem Besuch Barack Obamas hielten kubanische Behörden etliche Mitglieder der Oppositionsgruppe "Damen in Weiß" zurück. Zwei Tage zuvor, am 18. März, veranstaltete die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) zusammen mit der Organisation "Mensch in Not" (Člověk v tísni) den Tag für Kuba. Als Hauptrednerin war die kubanische Aktivistin Rosa María Payá eingeladen. Sie forderte, dass die Welt nicht die Augen vor den Problemen in ihrem Land verschließe.
Der Tag für Kuba begann am frühen Abend in Prag mit einer Demonstration von etwa 60 Menschen mit weißen Schirmen und Ballons, die über die Karlsbrücke zogen. Auf der Kleinseite schloss sich dann ein Gottesdienst in der Kirche St. Tomas an, bei dem der Synodalsenior Daniel Ženatý predigte. Den Gottesdienst begleiteten tschechische und spanische Gesänge aus Taizé und Gebete für Verfolgte.
Mit Rosa María Payá und dem Europa-Abgeordneten Pavel Telička folgte dann eine Podiumsdiskussion in den Räumen des Klosters. Das Thema dieses Jahres "Kuba – ein Flirt mit der Freiheit?" ist eine Reaktion auf das aktuelle Geschehen des Inselstaats. Der Präsident der USA begann im vergangenen Jahr, seine diplomatischen Beziehungen mit Kuba wiederaufzunehmen. Amerikanische Firmen können nun auf Kuba investieren und manche Produkte aus kubanischer Herstellung werden in die USA eingeführt. Nach mehr als einem halben Jahrhundert wurde im Sommer 2015 die amerikanische Botschaft auf Kuba wiedereröffnet und es wird darüber diskutiert, ob man das Handelsembargo nicht vollständig aufhebt. Vom kubanischen Präsidenten Raúl Castro aber erwartet die Welt außer der Freilassung ein paar politischer Gefangener so gut wie nichts. Weitere Zeichen des Entgegenkommens sind nicht zu erkennen. Das Regime unterdrückt immer noch die Meinungsfreiheit und macht eine freie Opposition unmöglich. Wir wissen von etwa 27 – 30 politischen Häftlingen.
Den Tag für Kuba richtet die EKBB in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation "Mensch in Not" als Erinnerung an den 18. März 2003 aus, als auf Kuba 75 Dissidenten verhaftet und zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden. Die Freiheit erlangten sie 2010 zurück, die Mehrheit von ihnen floh unter dem Druck der Regierung ins Exil.
Die oppositionellen Gruppen auf Kuba hoffen, dass der Besuch des amerikanischen Präsidenten zur Beendigung der Repressionen gegenüber den Opponenten des Regimes beiträgt.
Gespräch mit Rosa María Payá: Betet für uns und vergesst uns nicht
Rosa María Payá ist die Tochter des bekannten kubanischen Dissidenten Oswald Payá, der auf Kuba lange Zeit für Demokratie gekämpft hat und der zu den Freunden von Václav Havel zählte. Rosa María Payá tritt nun in seine Fußstapfen. Ihr Ziel ist es, auf Kuba einen verbindlichen Volksentscheid zu erreichen, durch den die Kubaner ihr Schicksal selbst entscheiden könnten. Im März dieses Jahres besuchte Rosa María Payá die Tschechische Republik und nahm an der alljährlichen Aktion Ein Tag für Kuba teil.
Ihr Vater, Oswald Payá, führte die christliche Opposition auf Kuba. Wie stark ist der Glaube junger Kubaner?
Das kubanische Volk durchlief eine große Etappe der Entchristlichung. Nach der kommunistischen Revolution flohen viele Geistliche aus dem Land, weil sie Angst vor Repressionen hatten. Viele Menschen hörten auf in die Kirche zu gehen. Mein Vater war drei Jahre lang in einem Arbeitslager zusammen mit einigen Priestern und Seminaristen, ihre Meinungen wichen von der offiziellen Ideologie ab. Der Glaube im gesellschaftlichen Leben litt immens. Nach dem Besuch von Johannes Paul II. im Jahre 1998 gab es jedoch eine gewisse Öffnung, aber die Repression ist bis heute gegenwärtig, sie hat sich nur verändert. Die Staatssicherheit belangt uns zum Beispiel nicht mehr dafür, dass wir sonntags in die Kirche gehen. Sehr aufmerksam hören sie aber, was die Priester den Menschen sagen, und haben sie unter Beobachtung; und das vor allem, wenn sie das Regime kritisieren. Manche wurden festgenommen oder endeten im Gefängnis.
Wie war das für Sie auf Kuba aufzuwachsen, als Tochter eines Dissidenten?
Dazu lässt sich aus zwei Betrachtungsweisen etwas sagen. Die erste negative Sicht ist verbunden mit Repressionen, unter denen die ganze Familie litt, mit Problemen in der Schule; als Kind müssen Sie das irgendwie absorbieren. Je älter der Mensch aber wird, desto mehr wird ihm das Positive bewusst. Kinder wurden meistens so erzogen, dass sie nirgends das sagen, was sie zu Hause hören, und so ergibt sich eine Atmosphäre der Angst. Mein Vater aber erzog mich so, dass ich sage, was ich möchte. Er zeigte mir, wie ich frei sein kann.
Was ist aus dem Varela-Projekt geworden, das an die tschechische Charta 77 erinnert?
Dieses Projekt entstammt einer juristischen Initiative. Die kubanische Verfassung besagt, wenn eine Petition mehr als 10.000 Unterschriften erlangt, dann muss sie verhandelt werden. Dieses Projekt, das ein Referendum darüber durchsetzt, welche Form der Regierung die Kubaner wollen, erlangte mehr als 25.000 Unterschriften, viel mehr, als die Verfassung verlangt. Die Regierung hat jedoch mit neuen Repressionen geantwortet. Das Projekt ist weiterhin offiziell am Laufen, und die Regierung ist also immer noch in der Pflicht auf diese Initiative zu antworten. Wir fordern, dass das Referendum, das schon lange hätte stattfinden sollen, in die Tat umgesetzt wird.
An Ihren Vater wird auf der ganzen Welt als Oppositionsführer und Aktivist gedacht, der für den Nobelpreis nominiert war; wie haben Sie ihn in Erinnerung?
Ich nehme natürlich auch diese Ebene wahr, ich sehe ihn als einen Menschen, der für die Menschenrechte kämpfte und das lässt sich nicht komplett trennen von dem, wie ich ihn als Vater erlebte. Er war ein riesiger Optimist, auch unter den Bedingungen, unter denen wir lebten. In unserem Haus wurde immer ein Grund zum Feiern gefunden.
Im vergangenen Jahr besuchte unseren Tag für Kuba Sonia Garro, für deren Freilassung wir im Jahr zuvor gebetet hatten. Wie viele politische Gefangene gibt es derzeit auf Kuba, hat sich im vergangenen Jahr die Situation erkennbar verändert?
Ich kenne die konkreten Zahlen nicht, aber allgemein lässt sich sagen, dass die Problematik der politischen Gefangenen sich verändert hat, wie eine Trophäe des Regimes. Sie sperren einfach jemanden ein, und wenn die internationale Gesellschaft protestiert, dann lassen sie ihn frei und verweisen ihn des Landes. Das ist keine Lösung. Einen einsperren, dann ihn freilassen und einen Anderen einsperren.
Im Juli letzten Jahres wurde auf Kuba die amerikanische Botschaft festlich wiedereröffnet, wie hat die kubanische Opposition diesen Schritt empfunden?
Auf der einen Seite bedeutete dies, dass z.B. einige Kurse für unabhängige Journalisten ausgerichtet wurden. Auf der anderen offiziellen Seite ist der Unterschied minimal und eine Wirkung auf die kubanische Bevölkerung hat das im Grunde gar nicht. Weiterhin gibt es die eine Regierung, die entscheidet; mit der eröffneten Botschaft hat sich nichts verändert.
Wie funktionieren auf Kuba Kirchen? Sind sie unabhängiger nach den Veränderungen, die eingetreten sind, oder sind sie weiterhin unter der direkten Kontrolle des Staats?
Hier gibt es einen Unterschied zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche. Ich weiß, dass viele protestantische Geistliche eingesperrt wurden, der Staat will über die ev. Kirche die Kontrolle haben. Was die katholische Kirche angeht, lässt sich sagen, dass der kubanische Kardinal sie mit dem Staat in eine Friedenszeit geführt hat. Das heißt aber nicht, dass die Institution selbst und alle Gläubigen von dem Staat manipuliert sind.
Warum lieben die Kubaner ihr Land so, wenn sie doch unter solchen Bedingungen leben?
Kuba ist ein wunderschönes Land, die wirtschaftlichen und politischen Bedingungen sind schlecht, aber in einem fremden Land wird es nie wie zu Hause sein. Und niemand möchte ein Fremder sein.
Glauben Sie, dass die heutige Aktion Tag für Kuba einen Sinn auch für die Menschen bei Ihnen hat?
Selbstverständlich hat es das, Kuba braucht viele Menschen, die für sie beten und über die dortige Situation Bescheid wissen. Wir brauchen diese Solidaritätsbezeugungen und Aktionen.
Was raten sie uns tschechischen Gläubigen? Um was würden sie uns bitten?
Betet für uns, wir brauchen das.
Und was würden sie jungen Tschechen in Ihrem Alter sagen?
Dass es wichtig ist, immer im Gedächtnis zu haben, wie zerbrechlich die Demokratie ist. Und dass wir unsere Freiheiten nicht aufgeben.
vorbereitet von Šárka Schmarczová, Jana Škubalová, Jana Vondrová und Olga Blaťáková, Foto: D. Ženatá
Einladung zur Hoffnung durch Leben und Werk
Prof. Dr. theol. Pavel Filipi (26.05.1936- 28.12.2015)
Wir hatten uns darauf vorbereitet, sein bedeutendes Lebensjubiläum mit ihm zu begehen.
Zu seinem letzten Jubiläum wollte er nicht, dass wir seine Person an der Fakultät feiern, stattdessen schlug er vor, eine Fachtagung zu einem bedeutenden Thema abzuhalten. Er wählte die Frage der Verkündigung und der Wirkung der Kirche außerhalb ihres etablierten Verantwortungsbereiches, also in der Öffentlichkeit. Vor dem anstehenden Jubiläum sprachen wir darüber, dass er sich gern mit einem ökumenischen Thema beschäftigen würde. Die Einzelheiten haben wir nicht mehr besprechen können.
Predigen und Ökumene. Zwei Tätigkeiten, zwei Bereiche kirchlicher Aktivität oder besser zwei Themenbereiche christlichen Denkens, welche Filipi sehr beeinflusst hat. Mit Sicherheit ist dies ein roter Faden, der sein ganzes Leben durchzieht, dies lässt sich auch biographisch belegen. Dank seiner Familientradition und mittels seiner Lehrer, auf die er nicht aufhörte, sich zu berufen. Von ihnen seien hier der Alttestamentler S. C. Daněk und der systematische Theologe und Ökumeniker J. L. Hromádka genannt.
Zuerst also Predigen. Filipis Leidenschaft- er schrieb gern Predigten und predigte gern, auch wenn er immer behauptete, dass es ihm schwerfiele. Aber auch dabei blendete er die Ökumene nicht aus. Manchmal beklagte sich Filipi, dass er öfter auf den Kanzeln anderer Kirchen predige, als auf der eigenen. Er predigte, wann immer er konnte, zuletzt in seiner eigenen Gemeinde in Prag- Vinohrady und bei den Adventisten, welche er sehr schätzte. Er gab eine Sammlung von Predigten "Was von der Nacht übrigblieb" heraus und eine Auslegung der Psalmen "Wer hört meine Klage?".
Sprachliche Präzision und Vorstellungskraft, Auslegungungen und außergewöhnliche Formulierungen charakterisieren Filipis Predigtstil. Ja, er hatte seine Lieblingsdichter und -autoren von welchen er immer lernte. Und in der Homiletik beschäftigte er sich mit Themen, wie denen, was gerade Kreativität ist, Authentizität, Vorstellungskraft. Das gilt es für den Prediger zu entdecken. Aber nicht bei sich selbst. Sondern in der Bibel. Er soll seine eigenen Einfälle und seine eigenen Entdeckungen durch sie korrigieren lassen und sich auf die richtige Bahn bringen lassen. Dann erfüllt der Prediger die ihm ureigens zugedachte Aufgabe. Denn die Bibel lädt in diesem Sinne direkt zum Gespräch ein, zur gegenseitigen Teilhabe. Und dies geschieht auf der breitesten Basis - und der ökumenischsten.
Die Bibel ist nicht (nur) historische Literatur, die auf unsere Vergegenwärtigung wartet. Aber sie ist ein "offenes Kunstwerk", das, wenn ihm Vetrauen vergönnt ist, unerwartet aktuell zu uns und unseren Zeitgenossen spricht.
Er polemisierte vorsichtig gegen die, die behaupteten, dass dieses offene Kunstwerk erst die Predigt selbst ist. Im Gegenteil, für ihn war das die Bibel. Sie ist die "Einladung zur Hoffnung", die Filipi zum Titel seines Homiletiklehrbuchs machte.
Der Titel war weder Zufall, noch Marketingstrategie. Im Jahr 2005 fand in Prag das mitteleuropäische Treffen der Kirchen statt, welches aus ursprünglich grenzübergreifenden zu multinationalen Kontakten gedieh. Dieses Jahr wird es in Budapest stattfinden. Dies entsprach Filipis Vorstellung von ökumenischen Bemühungen, die in der Gemeinde wachsen, aufgehen in alltäglichen Lebensnöten und das Leben unterstützen. Das Losungswort des Treffens war "Einladung zur Hoffnung". Filipi meinte, dass so eine Einladung breit und ökumenisch ist und zugleich am besten das fasste, worum es bei der Verkündigung des Evangeliums geht.
Zum Thema der Ökumene wurde Filipi von seinem Lehrer J. L. Hromádka gebracht und das in Zeiten großer Spannungen (wann aber sind solche nicht?). Die Sechziger Jahre brachten ihn dazu, in globale Kontexte christlicher Existenzformen Einsicht zu gewinnen, im Angesicht nuklearer Bedrohung und Friedensbemühungen aus christlicher Position.
Das ist für ihn die große Dialogschule unterschiedlicher Gedankenströmungen, ohne dass er darein verfällt, sich in irgendeiner Ideologie zu verfangen. Die Kunst des Dialogs und der klaren Formulierung beweist Filipi später im Rahmen der europäischen und weltweiten Ökumenebewegung, deren bedeutender Vertreter er wird, er wird Mitglied der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung des Weltrats der Kirchen und gleichzeitig ein sehr aktiver Teilnehmer ökumenischer Gespräche in Europa.
Vor allem im Rahmen der "Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa" (auch bekannt als "Leuenberger Kirchengemeinschaft").
Dabei geht es nicht um eine weltumfassende Strategie, sondern um den Dialog zwischen unterschiedlichen Traditionen, die aneinander grenzen, durch die Konfessionen hindurch in einem bestimmtem, konkreten Raum. Zu Beginn der neunziger Jahre war er einer der beiden Vorsitzenden dieser Organisation. Unter anderem hatte er Anteil an der Entstehung der wichtigsten Dokumente, welche dieser Verband verabschiedet hat und welche grundlegend die Wahrnehmung von ökumenischen Möglichkeiten veränderten. "Sakramente- Amt- Ordination" (1994) stellt einen Konsens zwischen mehr als einhundert protestantischen Kirchen in diesen Fragen dar und ermöglicht die Verwirklichung umfassender Gemeinschaft. Weiterhin hatte Filipi Anteil an den Verhandlungen, welche Anfang der der neunziger Jahre begannen und in die Schrift "Kirche- Volk- Staat- Nation" (2001) mündeten, die einen charakteristischen Untertitel hat: "Ein (protestantischer) Beitrag zu einem schwierigen Verhältnis". Tatsächlich durchlebte Europa im Jahr 1989 schwere Konflikte, hervorgerufen von einem unerwarteten und dramatischen Anstieg der Nationalismen, welche vielerorts auch für Aufruhr in den Kirchen sorgten. Ähnlich ist dies bei dem Dokument "Christliches Zeugnis von der Freiheit" (1999), welches ebenfalls auf aktuelle Fragen reagiert, die in Europa durch den Fall des Kommunismus entstanden sind: Wie verhält sich die christliche Freiheit zu der, die wir neu gewonnen haben und worin bestehen ihre Gefahren? In der heimatlichen Umgebung spiegelt sich diese Arbeit in dem Gedanken der Konstitution der Synode der Leuenberger Kirche in der Tschechischen Republik wider, der er für einige Zeit vorsaß. Wenigstens die Kirchen in unserem Land, die es können, sollen miteinander wechselseitig in einen Dialog treten, sich wechselseitig aus ihren Aktivitäten Rechenschaft ablegen, sich über den weiteren Weg beratschlagen.
Nicht ohne Rücksicht, sondern mit Rücksicht aufeinander.
Die Publikationen "Christenheit" und "Kirche und Kirchen" wurden Standardlehrbücher der Ökumenischen Theologie. Für den Gebrauch in den Gemeinden hat Filipi eine hervorragende Handreichung vorbereitet "Über den ökumenischen Gehsteig". Weniger bekannt, aber sehr bedeutend ist seine Beteiligung an Dialogen, die zur Entstehung römisch-katholischer Dokumente geführt haben, welche für das Zusammenleben der Kirchen in unserem Gebiet fundamental sind. Zuerst die "Vereinbarung über die Taufe (1994) zwischen der EKBB und der römisch- katholischen Kirche, welche das Vorbild für Vereinbarungen zwischen anderen Kirchen wurde. Weiterhin der Leitfaden " Über Mischehen zwischen Katholiken und nichtkatholischen Christen" (1999) und der Leitfaden über die Gemeinschaft im Sakrament mit Christen anderer Kirchen. Im größeren oder kleineren Maße jedoch beeinflusste er auch die Diskussion bei der Vorbereitung der Dokumente zur pastoralen Arbeit in der Armee, im Gefängnis und im Krankenhaus. Er arbeitete Grundsätze für die Feier ökumenischer Gottesdienste aus und half die Anfänge für die Übertragung von Fernseh- und Rundfunkgottesdiensten zu bereiten.
Im übrigen hat er das Liturgik-Lehrbuch "Einladung zum Fest" so vorbereitet, dass obwohl es mit "Evangelische Liturgik" untertitelt ist, es die gesamte Christenheit betrifft, aus ihrem Schatz schöpft.
In dem katholischen Dokument über die Taufe lesen wir, dass die gemeinsame Taufe der Ausdruck der tiefen Einheit aller christlichen Jünger ist, der Einheit von Christus gegeben, auf deren Verwirklichung die Kirche bis jetzt wartet. Filipi hat wirklich viel getan, damit wir doch wenigstens einige Spuren der Verwirklichung sehen und, dass das Warten nicht leer war.
Die Überzeugung des lebendigen Glaubens, dass in Gottes Königreich Menschen mit unterschiedlicher Kirchenzugehörigkeit um den einen Tisch Christi feiern werden, war ihm ein Anlass dafür, dass dies viele schon heute sehen und schmecken können.
Ladislav Beneš, Kollege vom Lehrstuhl Praktische Theologie der Evangelisch- Theologischen Fakultät der Karlsuniversität Prag
Neues Landesprogramm mit dem HEKS feierlich unterzeichnet
Am Palmsonntag wurde von Vertretern von HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz) und des Synodalrates der EKBB ein neues Landesprogramm unterzeichnet. In diesem Programm für die Jahre 2016 bis 2019 werden die Bereiche beschrieben, die das HEKS unterstützen wird: Gemeindeaufbau, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die Schulungen von Freiwilligen und Projekte der Diakonie. Dieses Landesprogramm schließt an ein erstes Landesprogramm an, das die Grundlage der Zusammenarbeit zwischen dem HEKS und der EKBB in den Jahren 2012 bis 2015 war. Im Jahr 2015 wurde es gründlich ausgewertet. Die Anfänge der Zusammenarbeit zwischen HEKS und EKBB liegen schon in den ersten Jahren nach dem 2. Weltkrieg, als das HEKS der EKBB in mancherlei Weise geholfen hat. Eine besondere Bedeutung hatten für viele Pfarrfamilien die Patenschaften für die Kinder der Pfarrfamilien, die oft zu langjährigen festen Freundschaften führten. Das Landesprogramm wurde unterzeichnet von Synodalsenior Daniel Ženatý und Synodalkurator Vladimír Zikmund. HEKS wurde vertreten von seinem Stiftungsratspräsidenten Claude Ruey und vom HEKS-Referenten für Tschechien Matthias Herren.
Das Landesprogramm wurde in einem kleinen Kirchlein in Prag-Malešice unterzeichnet, das die Prager Gemeinde der Brüderunität gekauft, um hier ein neues Zuhause zu finden, nachdem die Gemeinde ihr früheres Gebäude durch die Spaltung der Brüderunität verloren hatte. Zur Zeit feiert die Gemeinde, die jetzt zum Herrnhuter Seniorat der EKBB gehört, ihre Gottesdienste im Seniorenheim Sue Ryder in Prag-Michle. Doch die Gemeinde hofft, in diesem Kirchlein ein neues Zuhause zu finden. Dazu sind umfangreiche Renovierungsarbeiten und ein Pfarrhaus-Anbau nötig. In dieser großen Aufgabe wird die Gemeinde auch vom HEKS unterstützt. So wurde der Gottesdienst, in dem das Landesprogramm unterzeichnet wurde, ein bewegendes Beispiel dafür, wie eine kleine Gemeinde durch die internationale Solidarität mitgetragen wird angesichts der großen Herausforderungen, die die Gemeinde zu bewältigen hat.
Eine besondere Überraschung wurde für die Gemeinde der neue Altar, der Tisch des Herrn, der von Zdar Šorm, dem Ehemann der Gemeindepfarrerin Eva Šormová, aus Eschenholz geschnitzt wurde - mit dem Emblem des Christus-Lammes auf der Vorderseite. Zdar Šorm ist von Beruf gelernter Holzschnitzer und hat mit diesem in vielen Tag-und Nachtstunden geschnitzten Geschenk an die Gemeinde, etwas ganz Besonderes geschaffen: Ein schönes Zeichen der Hoffnung für die Gemeinde, die sich schon darauf freut, bis sie ihre Gottesdienste regelmäßig in der neuen Kirche feiern kann.
Gerhard Frey-Reininghaus
Regionalkonferenz der EKD-Auslandsgemeinden tagte in Prag
In jedem Jahr kommen die Auslandspfarrerinnen und –pfarrer der Evangelischen Kirche in Deutschland aus den beiden Regionen Nordeuropa und Mittel/Ost/Südosteuropa zu einer gemeinsamen viertägigen Konferenz zusammen, zuletzt 2014 in Warschau und 2015 in Riga.
Eingeladen sind dabei immer auch die Familien.
Vom 30. März bis zum 2. April fand die diesjährige Konferenz in Prag statt – insgesamt 31 Pfarrerinnen, Pfarrer und Pfarrfamilien aus Gemeinden in Oslo, Göteborg, Malmö, Kopenhagen, Helsinki, Riga, St. Petersburg, Moskau, Kiew, Prag, Budapest und Belgrad, sowie die beiden Regionalreferenten und eine weitere Mitarbeiterin aus dem Kirchenamt der EKD. Die gemeinsamen Tage wurden von Andrea Pfeifer, Pfarrerin der Deutschsprachigen Evangelischen Gemeinde Prag, vorbereitet. Das Hotel Baroko im Stadtteil Malešice bot das ideale Umfeld für eine gute und konzentrierte Konferenzatmosphäre.
Überschattet wurde die Konferenz jedoch vom tragischen Tod des Kiewer Pfarrers Hans-Ulrich Schäfer, der am zweiten Konferenztag völlig unerwartet einem Herzinfarkt erlag. Mit einer bewegenden Andacht nahm die Gruppe, gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und ihren Kindern, Abschied von ihrem Kollegen; spürbar wurde in dieser schweren Situation das tiefe Vertrauen innerhalb der Regionalgruppe.
Während es für die Kinder an allen Tagen ein eigenes Programm gab – durchgeführt von einer deutschen Theologiestudentin an der Karlsuniversität -, beschäftigten sich die Erwachsenen mit zwei zuvor gemeinsam ausgewählten Themenbereichen: „Säkularisierung“ und „Arbeit mit Kindern“. Zum zweitgenannten Thema konnte Kerstin Othmer-Haake gewonnen werden, Pfarrerin für Kindergottesdienstarbeit in der Evangelischen Kirche von Westfalen und Dozentin am dortigen Pastoralkolleg.
Das Thema „Säkularisierung“ sollte aus möglichst unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden. Auf Vermittlung von Kirchenrat Gerhard Frey-Reininghaus gelang es, Prof. Dr. Tomáš Halík für einen Vortrag mit anschließender Diskussion zu gewinnen. Besondere Beachtung fand seine These, dass das Gespräch mit Atheismus bzw. Agnostizismus nicht nur zu einer spirituellen Vertiefung des christlichen Glaubens führt, sondern Atheismus und Agnostizismus mit ihren Fragen und ihrer Kritik ein notwendiger „Stachel im Fleisch“ des Christentums sind. Ohne sie sei das Christentum ärmer, und daher sollte eine (a)religiöse Situation wie in der Tschechischen Republik weniger beklagt, sondern vielmehr als geistliche Chance und Bereicherung begriffen werden. In einem weiteren Schritt beleuchtete der Prager Kirchenhistoriker Dr. Peter Morée das Thema dann aus historischer Perspektive. Dabei legte er einen besonderen Schwerpunkt auf die katholische, protestantische und säkular-historische Sichtweise, ihre jeweilige Entstehung, ihre Einsichten und Grenzen. So sei das Königreich Böhmen beispielsweise vor der Schlacht am Weißen Berg entgegen herkömmlicher evangelischer Sichtweise durchaus kein protestantisches Land gewesen, verstand sich doch die utraquistische Mehrheitskonfession als – wenngleich eigenständiger - Teil der römisch-katholischen Kirche. In einem dritten Referat stellte Jaroslav Pechar, Pfarrer der Gemeinde der EKBB in Prag-Braník, in sehr lebendiger Weise das Thema in den Horizont des pfarramtlichen Alltags.
Sicherlich ein Höhepunkt der Konferenz war zudem ein Gespräch mit Botschafter Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven in den Räumen der Deutschen Botschaft.
Auch der gegenseitige kollegiale Austausch, die Berichte aus den jeweiligen Gemeinden bzw. Kirchen sowie Informationen aus dem Kirchenamt der EKD kamen nicht zu kurz.
Im Anschluss an die Konferenz besuchte Kirchenrat Dirk Stelter, EKD-Referent für die Region Mittel/Ost/Südosteuropa, am 3. April den Sonntagsgottesdienst der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde in St. Martin in der Mauer, in dem der Belgrader Pfarrer Hans-Frieder Rabus die Predigt hielt. Zudem traf er sich mit dem Gemeindevorstand zu einem Gespräch im Blick auf die Wiederbesetzung der Pfarrstelle zum 1. September 2017.
Andrea Pfeifer, 9.5.2016
Das Evangelium in einer säkularisierten Gesellschaft miteinander teilen
Die EKBB-Presbyterianische Kirche (USA) PK USA - Partnerschafts-Konferenz, Prag und Ortsgemeinden in der Tschechischen Republik, 19.–26. April 2016
Bereits zum vierten Mal in den letzten 10 Jahren brachte eine kleine Konferenz Vertreter mehrerer Dutzend Kirchen aus der Tschechischen Republik und den USA zusammen. Dieses Mal tagte sie sowohl in Prag als auch in einigen anderen Ortsgemeinden der EKBB. Das Zentrum der Konferenz bildete das Hus Haus in der Prager Innenstadt. Dort wurden die Gäste untergebracht und die meisten Vorträge, Diskussionen und das Essen fanden dort statt. Während des Wochenendes (22.–24. April 2016) besuchten die amerikanischen Teilnehmer ihre jeweilige Partnergemeinde außerhalb von Prag. Die Konferenz wurde durch festliche Abendmahlsgottesdienste in den mittelalterlichen Kirchen St. Martin in der Mauer und St. Clement umrahmt. Zu Beginn predigte Pfr. Dan Ženatý, der Synodalsenior der EKBB, über das wertvolle Geschenk dieses Treffens und des gemeinsamen Teilens. Pfr. Ken White aus Pittsburgh machte in seiner Predigt im Abschlussgottesdienst deutlich, auf welche Weise während der gemeinsamen Woche der Begegnung, des Teilens und Lernens ein Wunder sichtbar geworden ist.
Theologische Herausforderungen
Das herausfordernde Thema der gemeinsamen Woche sollte die säkulare Gesellschaft sein, wie sie sowohl von der EKBB als auch von den protestantischen Kirchen in den USA wahrgenommen wird. Professor Mark Douglas vom Columbia Theological Seminary unterschied drei Wege, wie das Christentum in den USA mit der Säkularisierung umgeht (Die Murmler des Evangeliums, die sich auf die persönliche Veränderung konzentrieren und öffentliche Verantwortung vermeiden; Die Schreihälse, die versuchen andere Stimmen niederzuschreien und die Linientreuen, die Linien politischer Agenden verfolgen). Die Hauptsache besteht laut Douglas für Kirchen aber darin, „über die Frage nachzudenken, „wie es möglich ist, an der sie umgebenden Kultur in Zeiten des Umbruchs teilzuhaben, Gottes Arbeit in ihnen und der Kultur zu erkennen, da Gott immerwährend neue Dinge aus alten hervorbringt.“ Petr Sláma von der Karls-Universität in Prag schlug sieben Hauptpunkte vor, die der EKBB und der PK USA gemein seien (Gottes Gnade, menschliche Freiheit, Gottes Sein, das sich von unserem unterscheidet, die herausragende Stellung des göttlichen Wortes, die Kirche als eine Gemeinschaft, öffentliche Verantwortung der Kirche und das Erbe der Reformation) und die alle – um Richard Rohr hier anzuführen – in einer erlösten und unerlösten Form existieren. Die Hauptsache ist, im Hinblick auf die Hauptpunkte an der Erlösung jeweils zu arbeiten. Durchdrungen von dieser Typologie war eine Andacht zu Abraham, der Fremde aufnimmt in Kontrast zu der inzestuösen Angst der Tochter von Loth vor dem Anderen (siehe Gen 18). Pfr. Pavel Pokorný, der Stellvertreter des Synodalseniors der EKBB, teilte seinen Zukunftstraum hinsichtlich seiner Kirche. Indem er die Tendenzen und Herausforderungen, mit denen die Kirche in diesen Tagen konfrontiert ist, analysierte, fasste er zusammen: „In meinem Traum ist meine Kirche keine junge Frau, sondern eine attraktive Frau mittleren Alters, erfahren, identitätssicher, dennoch flexibel, voll von erwachsener Liebe und Humor, sie kommuniziert offen und freundlich und schreitet in Frieden weiter zur Sonne.“
Von einer Mission zur Partnerschaft
Der Hauptschwerpunkt der Konferenz lag auf Partnerschaften zwischen Gemeinden und darauf, wie diese beginnen, wie sie wachsen und wie man voneinander lernen kann, sie zu pflegen. Betty McGinnis aus Annapolis, Jan Sláma aus Brünn und Pfr. Pavel Ruml, der ehemalige Pfarrer in Letohrad, teilten ihre persönlichen Erinnerungen, die bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückreichten. Betty McGinnis von der amerikanischen Seite iniziierte eine erste Missionsgruppe der PK USA, die 1992 Menschen aus verschiedenen Kirchen in den USA nach Klobouky in der Nähe von Brünn brachte, um im dortigen diakonischen Zentrum ehrenamtlich zu helfen, was von Pfr. Pavel Smetana, dem ehemaligen Synodalsenior der EKBB und Jan Sláma von der tschechischen Seite begrüßt wurde. Danach kam es zu gegenseitigen Partnerschaften zwischen einzelnen Gemeinden. Es gab einen Block, der beidseitige Berichte darüber enthielt, wie die Partnerschaft lief und welche Vorzüge aber auch Gefahren es in den transatlantischen Beziehungen zwischen Letohrad und Annapolis, Olmütz und Athen, Vsetín und Cumberland, Ratiboř und Pittsburgh gab. Von Anfang an konnten Geschichten über erfolgreich durchgeführte Englischcamps, die in tschechischen Städten von den Lokalkirchen unter Mithilfe von amerikanischen Lektoren organisiert wurden und augenöffnenden Besuchen von Tschechen in den Partnerkirchen in den USA, verzeichnet werden. Vor allem aber herrschte eine Vielzahl an Berichten über langjährige Freundschaften vor.
Vorlesungen und Präsentationen
Weiterhin gab es eine Reihe an Vorträgen und Präsentationen. Eine davon bestand aus einer Einführung in den mannigfaltigen Dienst der Diakonie durch Kateřina Svobodová und den Direktor der Diakonie Petr Haška. Eine weitere klärte über die finanziellen Erwägung der EKBB auf und diskutierte Geheimnisse der Geldmittelbeschaffung (Ondřej Srb). Wieder eine andere lieferte einen historischen Abriss der Gemeinden der EKBB (Pfr. Martin Horák). Auch eine knappe Darstellung der Geschichte und der gegenwärtigen Statistiken der evangelisch-theologischen Fakultät der Karls-Universität wurde geliefert (Jan Roskovec von der Karls-Universität). Deutlich hörbar war eine vitale schottische Stimme durch Carol Finley, die Einsichten über die Auslandsarbeit der Kirche Schottlands bot. Schließlich gab es einen Rückblick zum Abschied von Pfrin Karen Moritz, der amerikanischen Mitarbeiterin der Ökumeneabteilung der Zentralen Kirchenkanzlei, die Prag nach knapp sechs Jahren der Arbeit wieder in die USA zurückkehrt.
Nicht nur sitzen
Neben allen ernsten Vorträgen gab es ein Zwischenprogramm, das „Alles böhmische Dörfer für mich“ hieß. Bevor die amerikanischen Gäste sich in ihre Gastgemeinden begaben, wurde das Spiel von zwei professionellen Englischlehrerinnen, Ivana Marková
und Ivana Adámková, durchgeführt und so eine lustige und praktische Lektion über die tschechische Sprache und tschechische Gewohnheiten geliefert. An einem Abend sahen wir einen Film, der sich mit der Zwangskollektivierung tschechischer Bauern in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, befasste. An einem anderen Abend zog die Konferenz ins Theater um, um sich Wolfgang A. Mozarts Don Giovanni anzusehen. Indem sie unsichtbar und doch durch Rat und Tat omnipräsent waren, wurden Pfr. Gerhard Frey-Reininghaus und sein Team der Ökumeneabteilung der EKBB zu einem sehr engagierten und hilfreichen Bestandteil der Konferenz. Im Hinblick auf ihre Ergebnisse ist Pfr. Bill Hathaway in seiner Reflexion der Woche, zu zitieren: „Wir glauben durch unsere Antwort. Da wir an Gott glauben, sind wir zu seiner Verehrung verpflichtet. Wir glauben an den Leib Christi. Die Freundschaften, die wir in diesen Partnerschaften erfahren, bieten dabei eine echte Unterstützung. Wenn ich nach dieser Zeit mit euch Heim kehre, bin ich aufgrund eures Zeugnisses fest entschlossen, ein gläubigerer Pastor und Christ zu sein.“
Děkuji („Danke“ auf Tschechisch)
Petr Sláma
Die Kirchen reformierter Tradition erfahren und diskutieren Mission
Die christlichen Kirchen werden sich zunehmend der Tatsache bewusst, dass sie über Mission als einer Form der Evangeliumsbezeugung und des Dienstes an Menschen und der Schöpfung nachdenken müssen. Dabei wird vor allem betont, dass eine solche Mission in ökumenischer Form vonstattengehen soll, um Erfahrungen auszutauschen und die gemeinsamen Ressourcen mit denen zu nutzen, die sich mit uns auf dem Weg befinden. Ein Seminar, das von 24. bis 26. Mai in Prag stattfand, war Ausdruck dieses Bewusstseins und Fortschritts. Das Seminar wurde von der Abteilung für Ökumene und Auslandsbeziehungen der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) organisiert und stand am Ende eines dreijährigen Projekts, das von drei Kirchen reformierter Tradition durchgeführt worden war – der protestantischen Kirche in den Niederlanden, der reformierten Kirche in Ungarn und der EKBB. Das Ziel dieses Projektes war es, Repräsentanten dieser drei Kirchen, die in die Mission und Missiologie der jeweiligen Kirche involviert sind, zusammenzubringen, um sich über Perspektiven eines Daseins von Missionskirchen in verschiedenen europäischen Kontexten, auszutauschen. Dazu trug maßgeblich bei, dass die jeweiligen Kirchenrepräsentanten eine Einführung in die Missionsinitiativen ihrer Kirche gaben.
Nachdem sich die Teilnehmer in der Zentralen Kirchenkanzlei der EKBB getroffen hatten, gingen sie gemeinsam in die Gemeinde in Prag Kobylisy, wo sie von Daniel Ženatý, dem Synodalsenior der EKBB, und Ondřej Kolář, dem Pfarrer der Gemeinde, der ihnen selbige und das Europäische Zentrum für Missionsstudien (www.missioncentre.eu) vorstellte, begrüßt. Die Gemeinde, welche der EKBB angehört, ist einzigartig, da sie nicht nur tschechische, sondern auch koreanische, japanische Gemeindeglieder und solche aus einigen weiteren Ländern, umfasst.
Der nächste Programmpunkt bestand aus zwei Vorträgen, die von Pavel Hošek und Pavol Bargár gehalten wurden. Beide lehren an der Karls-Universität und führten die Teilnehmer in den historischen, kulturellen und religiösen Kontext der Tschechischen Republik ein und stellten die Mission einzelner tschechischer Kirchen vor. Anschließend waren die Teilnehmer zu einem interkulturellen Gottesdienst in der Gemeinde in Kobylisy eingeladen. Gehalten wurde dieser von Pavel Pokorný, einem Mitglied des Synodalrates der EKBB. Der Gottesdienst beinhaltete ebenfalls die Feier des Heiligen Abendmahls, das die koreanische und die tschechische Gemeinde mit ihren Pfarrern Kwang Hyun Ryu und Ondřej Kolář zusammen gestalteten. Der Tag wurde sodann durch ein köstliches gemeinsames Abendessen, das von Gemeindegliedern vorbereitet worden war, abgerundet.
Das Vormittagsprogramm des nächsten Tages fand in der Gemeinde Prag Libeň statt. Roman Mazur, der Pfarrer dieser Gemeinde, der zugleich Senior des Prager Seniorats ist, begrüßte die Teilnehmer und stellte ihnen die Gemeinde Libeň vor, die es sich vorgenommen hat, eine offene missionarische Gemeinde zu sein. Das darauf folgende Referat von Radim Žárský, dem Vorsitzenden des Beratungsausschusses für Evangelisierung und Mission, veranschaulichte die Arbeit dieses Ausschusses.
Das Nachmittagsprogramm beinhaltete zuvor die Erkundung von Mission in verschiedenen Formen des Kirchendienstes. Zunächst stellte Mikuláš Vymětal, der Pfarrer der EKBB für Minderheiten, seine Arbeit mit Roma und Flüchtlingen vor. Danach sprach Michael Erdinger, Pfarrer der EKBB in Sázava, über sein Konzept des modernen Gottesdienstes in einem Musik Club und seine Erfahrungen der gottesdienstlichen Arbeit auf einem Punk Musik Festival. Danach aßen die Teilnehmer auf einem Boot, das auf der Moldau fuhr, zu Abend.
Diskussionen, Reflexionen und Auswertungen waren ein wichtiger Teil des Treffens. In Verbindung mit den vorangegangenen Seminaren, die in den Niederlanden und Ungarn stattgefunden hatten, zählten die Teilnehmer einige Themen auf, die im Verlauf aller drei Seminare aufgetaucht sind. Diese Themen stellten heraus, dass es notwendig wäre, der Frage, was es heute heißt, eine christliche Gemeinde/Kirche zu sein, weiter auf den Grund zu gehen. Weiterhin stellten sie die Herausforderung, zur gleichen Zeit der christlichen Identität treu sowie der heutigen Kultur gegenüber offen zu bleiben, dar und verdeutlichten die Relevanz, aufzuzeigen, dass Gott auch außerhalb der Kirche in der Welt wirkt. Zudem verdeutlichten sie alle die Mannigfaltigkeit der Glaubenszugänge. Die Teilnehmer lobten vor allem die Struktur des Seminars, die ihnen die Möglichkeit bot, mit konkreten Beispielen christlicher Mission in verschiedenen Kontexten in Berührung zu kommen und die Erfahrungen, Eindrücke und Ideen mit ihren Brüdern im Glauben diskutieren zu können.
Das Seminar wurde schließlich von einem letzten Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche St. Martin in der Mauer beendet. Obwohl das Projekt mit dem Treffen in Prag einen Schlusspunkt fand, hoffen die Teilnehmer, dass die reichen Einsichten überdauern werden und christlichen Kirchen helfen werden, der missio Dei noch treuer und bedeutungsvoller zu dienen.
Pavol Bargár
Die europäische Dimension der Reformation – Tagung in Wittenberg
Nicht erst Martin Luther oder Johannes Calvin haben die Reformation erfunden. Der reformatorische Funke war schon bei den Waldensern in Italien, der Armutsbewegung des 14. Jahrhunderts in vielen Teilen Europas und mit den Lollarden im England des 15. Jahrhunderts zu Hause und wurde Flamme und Feuer in der Böhmischen Reformation. So wird es auch manches Mal in der Kunst abgebildet, nur in der deutschen Kirchengeschichtsschreibung kommt dieser europäische Charakter der Reformation etwas kurz. Doch gerade um den europäischen Charakter der Reformation geht es auf einer Tagung in der Lutherstadt Wittenberg, die vom 7. bis 9. Oktober 2016 in der dortigen Evangelischen Akademie stattfinden wird. Auf der Tagung soll der europäische Zug der Reformationsgeschichte ab dem Ende des 14. Jahrhunderts wahrgenommen werden und Inspirationen liefern für den Blick auf Geschichte und damit für die europäische Zukunft. Die Evangelische Akademie veranstaltet diese Tagung in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Akademie zu Berlin und der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB). Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Nähere Informationen erhalten Sie bei den beiden Akademien und bei der Ökumene-Abteilung der Zentralen Kirchenkanzlei der EKBB.
Gerhard Frey-Reininghaus
Die Synode befasste sich mit dem Weg der Kirche in die Zukunft. Sie entschied auch über einen Brief für Papst Franziskus
Die 2. Sitzung der 34. Synode der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder fand vom 19. – 21. Mai in Prag statt. Zu der Sitzung kamen ca. 80 gewählte Vertreter (Pfarrer und Laien) zusammen, um über den Weg der Kirche in die Zukunft zu beraten. Es wurden nicht nur Fragen des Haushalts, juristische, personelle oder technische Angelegenheiten besprochen. Über allen Themen ragte der Wunsch nach einer guten Leitung der Kirche, die Jesus Christus nachfolgt.
Die Synode hat sich mit Wahlen in die kirchlichen Organe beschäftigt und verhandelte die Erfüllung der Beschlüsse der vorhergehenden Sitzungen. Es wurden Berichte zum Haushalt der Gesamtkirche erörtert. Verhandelt wurde beispielsweise über einen Erlass von Schulden gegenüber dem Personalfond und beschlossen wurde ein Plan zur Errichtung eines Stiftungsfonds der EKBB, aus dessen Mitteln Entwicklungsprojekte und diakonische Projekte von Gemeinden sowie die tschechischen evangelischen Gemeinden im Ausland nach Abschluss des Finanzausgleiches mit dem Staat mitfinanziert werden können.
Ebenfalls auf dem Programm standen Verhandlungen über die Änderungen einiger kirchlicher Verordnungen und Gesetze. Die Synode beschloss beispielsweise, dass ein Senior in besonderen Fällen mit Zustimmung des entsprechenden Senioratsausschusses einen Pfarrer aus einem anderen Seniorat mit der vorübergehenden Leitung einer Pfarrstelle beauftragen kann. Es wurde über die Aufhebung der Verkürzung der Wahlperiode von 10 auf 5 Jahre abgestimmt (die von der letzten Synode beschlossen wurde). In einer geheimen Abstimmung scheiterte der Vorschlag knapp. Die Pfarrer werden also weiterhin für eine Zeit von maximal fünf Jahren berufen.
Ein markanter Punkt war auch die ökumenische Thematik. Die Synode unterstützte das Vorhaben der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen, sich der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre anzuschließen. Die Erklärung will zeigen, dass die Lutherischen Kirchen, die sich ihr mit ihrer Unterschrift anschließen, und die Römisch-Katholische Kirche in der Lage sind, ein gemeinsames Verständnis unserer Rechtfertigung aufgrund der Gnade Gottes durch den Glauben an Christus zum Ausdruck zu bringen. Die Erklärung enthält nicht alles, was die einzelnen Kirchen über die Rechtfertigung lehren, sie bringt jedoch die Einigkeit in primären Wahrheiten der Lehre zum Ausdruck und stellt keinen Grund für gegenseitige Verurteilungen dar.
Beim Gedenken des Märtyrertodes von Johannes Hus im Jahr 2015 empfing Papst Franziskus eine Delegation aus der Tschechischen Republik, der auch Vertreter der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder angehörten. Das Treffen fand anlässlich des Gottesdienstes der Versöhnung mit Gott und zwischen den Christen mit der Bitte um Vergebung zum 600. Jahrestag des Märtyrertodes von Johannes Hus statt. Die Synode hat auf ihrer diesjährigen Sitzung den Vorschlag verabschiedet, auf diesen aktiven Schritt zur Versöhnung von Papst Franziskus zu antworten und für diese Geste zu danken.
Auf der Tagesordnung stand auch die Nutzung eines ehemaligen Gebetssaales aus der Toleranzzeit in der Tischlerstraße in Prag. Kürzlich stellte die Denkmalschützerin Marta Procházková fest, dass in der Tischlerstraße ein historisches Gebäude verfällt, das in der Toleranzzeit als Gebetssaal diente, und dass es sich lohnen würde, in Verhandlung über die Zukunft dieses Objekts zu treten, in dem eine Ausstellung über die Geschichte des Protestantismus in Tschechien entstehen könnte. Es wurde eine Kommission ins Leben gerufen, die für das Zusammentragen von Unterlagen und die Verhandlungen mit dem Eigentümer, der Hauptstadt Prag, verantwortlich ist. Die Synode unterstützte die Initiative.
Die Synodalen stimmten dem Zusammenschluss der Gemeinden Broumov und Hronov zu und befassten sich mit dem Gemeindeleben an Orten mit Förder- oder Missionsstellen. Sie verlängerten die Förderung der Pfarrstelle in der Stadt Beroun und beschlossen auch die finanzielle Förderung der Pfarrstellen in Kdyně und Šternberk.
Heftig diskutiert wurde auch bei zwei anderen Themen, bei dem neuen Gesangbuch und dem Logo der Kirche. Am Gesangbuch arbeitet eine Kommission schon 12 Jahre. Die Synode nahm einen Bericht dieser Kommission und einen Finanzplan zur Kenntnis. Der Entwurf, die Liste der Lieder und ein Überblick über die Textteile sind vorbereitet. Die Synode besteht nicht darauf, dass das Gesangbuch bis 2018 fertig sein muss, es wäre jedoch gut, es beim hundertsten Jubiläum der Gründung unserer Kirche in der Hand zu halten.
Die Frage des Kirchenlogos ist schon mehrere Jahre Thema. Die diesjährige Synode beauftragte den Synodalrat mit der Vorbereitung eines neuen Logos und dem damit verbundenen grafischen Material. Das Logo soll Bibel und Kelch enthalten. Es soll bei der nächsten Synode beschlossen werden und ab Januar 2018 von der zentralen Kirchenkanzlei und der Gesamtkirche verbindlich genutzt werden.
Detaillierte Informationen über die Zusammenkunft der Synode sind auf www.synodcce.cz zu finden. Die Sitzung im Jahr 2017 wird vom 18. – 20. 5. in Prag stattfinden, im Jahre 2018 dann vom 31. 5. – 3. 6. in Litomyšl.
Hieronymus von Prag – Europäer, Gelehrter und Aufrührer
Die EKBB gedenkt in diesem Jahr der Geschichte des Hieronymus von Prag, dem bedeutenden Aktivisten des Mittelalters, der zu Unrecht im Schatten von Jan Hus steht, mit einer Veranstaltungsreihe, deren Höhepunkt ein Festival am 28. Mai auf der Schützeninsel (Střelecký ostrov) in Prag darstellte.
Diesem Festival gingen andere Veranstaltungen voran, beispielsweise drei Filmabende mit anschließendem Gespräch in der Prager Kirche St. Martin in der Mauer. Auf dem Programm standen Ohnivý máj (Feuriger Mai) auf dem Jahre 1974, Ecce Constantia aus dem Jahre 1992 (nach dem Theaterstück von Pavel Kohout, der während des Abends persönlich anwesend war) und die Vorpremiere des vom tschechischen Fernsehen produzierten neuen Dokumentarfilms Buřič Jeroným Pražský (Der Aufrührer Hieronymus von Prag). Zudem initiierten wir einen interaktiven Test und gaben Comics und Bücher heraus, die das Leben des Hieronymus von Prag und sein Vermächtnis vorstellen.
Zum Führer durch das ganze Jahr wurde eine Handpuppe des Hieronymus von Prag, die Jan Růžička anhand einer Beschreibung in der Richental-Chronik, die den Verlauf des Konstanzer Konzils beschreibt, geschnitzt hatte und die von Pfarrer Jaroslav Pechar geführt und gesprochen wurde.
Die Hauptveranstaltung, auf die alle Aktivitäten hinzielten, war ein Ende Mai stattfindendes Festival. Die Veranstaltung begann mit einem Umzug, der zwischen dem neuen Rathaus, Ecke Karls Platz, und der Řeznická ulice begann. Dort soll Hieronymus von Prag zur Welt gekommen sein; dies ist allerdings ebenso wie sein genaues Geburtsdatum unsicher. Der Umzug beinhaltete dann weitere Orte, die in Verbindung mit diesem Weltenbummler und Magister vierer verschiedener Universitäten gebracht werden und endete auf der Schützeninsel, wo das Festival in ein vielseitiges Programm überging.
Dieses Programm wurde durch einen von dem Prager Seniorat der EKBB vorbereiteten feierlichen Gottesdienst eröffnet. Lenka Ridzoňová beschrieb in ihrer Predigt sieben bedeutende Stationen in Hieronymus’ Leben und verdeutlichte, was wir von seinem Leben für die heutige Zeit lernen können.
Die Kollekte während des Gottesdienstes ergab 12.000 Kronen, die für das Projekt Dža dureder der gemeinnützigen Organisation Slovo 21 bestimmt sind. Das Projekt befasst sich mit der Nachhilfe von Mittelschülern mit Roma-Hintergrund und ihrer Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen in die Hochschule sowie Fachoberschule. Sein Ziel ist es, dass diese Schüler erfolgreich ihre Abiturprüfungen ablegen und danach weiter studieren. Dies hätte Hieronymus von Prag, der selbst ein mittelloser Student war, der nach Bildung lechzte, bestimmt unterstützt.
Interessierten war es möglich, einen Brief an die Kirchen in Konstanz zu unterschreiben, der eine Antwort auf die Erklärung des vergangenen Jahres darstellte, in dem diese ihrem Bedauern gegenüber der Verbrennung von Jan Hus und Hieronymus von Prag Ausdruck verliehen hatten. Er enthält einen Dank für ihre Versöhnungsgeste. Überreicht wurde der Brief am Montag, den 30. Mai, von einem Vertreter der EKBB in einem Gottesdienst in Konstanz.
Auf dem Programm des Festivals standen neben dem Gottesdienst verschiedene Konzerte, ein Puppenspiel, das eigens für diese Gelegenheit geschrieben worden war, eine Podiumsdiskussion für Teilnehmer, die an einer näheren Beschäftigung mit Hieronymus von Prag interessiert waren, ein Kinderprogramm und eine vom Hussitenmuseum in Tabor vorbereitete Ausstellung. Die gute Stimmung konnte nicht einmal vom nachmittäglichen Regen gestört werden. Der reibungslose Ablauf der Veranstaltung ist nicht zuletzt den Freiwilligen zu verdanken.
Den Schlusspunkt bildete nach dem samstäglichen Festival das Glockengeläut der Salvator Kirche am 30. Mai, dem 600. Todestag von Hieronymus um 12.30 Uhr. Der Läutende läutete zunächst fünf Minuten die große Glocke, wie es bei Todesstunden üblich ist, danach läuteten weitere fünf Minuten alle vier Glocken, wie es wiederum bei besonderen Ereignissen üblich ist.
Mit dem Vorübergehen dieses Schlüsseltages des Todes von Hieronymus von Prag enden wir allerdings nicht ganz. Im November wird Prag zur einzigen Station des sog. Reformations-Trucks der EKD innerhalb der Tschechischen Republik. Dieser Truck startet Anfang November von Genf aus und wird an 68 Orten in 19 Ländern halten. Im Mai 2017 beendet er seine Reise in Wittenberg, wo Luther im Jahre 1517 seine 95 Thesen formulierte. Das Ziel des Projektes ist es, aufzuzeigen, dass die Reformation nicht nur ein deutsches Thema ist. Das Programm, das mit der Station in Prag verbunden ist, entwirft die EKBB im Geiste von Jan Hus und Hieronymus von Prag. Höhepunkt des Programms ist ein festlicher ökumenischer Abend an der deutschen Botschaft in Prag.
Hieronymus von Prag wurde um das Jahr 1378 geboren. Im Jahre 1398 beendete er sein Studium an der Prager Fakultät. Aus Oxford brachte er die wichtigsten Schriften von Wyclif nach Prag. Er unterrichtete an der Pariser Sorbonne und an Universitäten im heutigen Deutschland und Österreich. Er beteiligte sich an der Herausgabe des Kuttenberger Dekrets. Er komponierte einige Gedichte und „Protestsongs“. Als Diplomat von König Wenzel IV. kam er sogar nach Jerusalem. Im April 1415 fuhr er trotz Warnungen nach Konstanz. Nach seiner Festnahme und brutaler Folter widerrief er seine Meinungen. Nach einem inneren Kampf bekannte er sich jedoch wieder zu den Thesen von Hus und Wyclif. Er wurde am 30. Mai 1416 durch das Kirchenkonzil zum Tod verurteilt und am selben Ort wie Jan Hus verbrannt.
Jana Vondrová
Zu Gast in Prag
Eine Begegnungsreise der evangelischen Studierendengemeinde Tübingen nach Prag
Prag begegnen – und zwar nicht nur aus der Touri-Sicht, mit schönen Ansichten und kulinarischen Köstlichkeiten, sondern mit kirchlichen Einblicken und Einsichten, das war unser Ziel. So machten wir uns, eine Gruppe der evangelischen Studierendengemeinde (esg) Tübingen (aus 16 Studierenden unterschiedlicher Fachbereiche und dem Pfarrehepaar), Mitte Mai für vier Tage aus unserer Universitätsstadt auf den Weg nach Prag. Unsere Unterkunft war im Herzen Prags, in der churchpension, von dort konnten wir fußläufig zu unseren Prag-Begegnungen aufbrechen. Dank meiner im vergangenen Jahr als Erasmus-Studentin an der ev. Fakultät Prags (ETF) geknüpften Kontakte öffneten sich uns viele Türen voller Herzlichkeit: An der ETF trafen wir uns mit Studierenden an der Fakultät und aßen zusammen in der Mensa. Mit dem Dozenten für Kirchengeschichte Peter Morée entdeckten wir die Betlehemskapelle und lernten Jan Hus näher kennen. Wir waren bei der Tschechoslowakischen Hussitischen Kirche zu Gast und erfuhren von Kristýna Mlýnková ihre Ansätze in der kirchlichen Jugendarbeit. Den Abschluss bildete ein aktuell-politisches Thema, in der Caritas hörten wir, wie Flüchtlingshilfe in Tschechien aussieht und welche Schwierigkeiten die Arbeit beeinträchtigen.
Ein besonderes Highlight war für uns der gemeinsame Abend mit der evangelischen gemeindeübergreifenden Jugendgruppe, die sich an dem Abend in den Gemeinderäumen im Stadtteil Prag-Jarov traf. Nach einem deutsch-tschechischen Kennenlernen zu Beginn, bei dem die englische Sprache die Sprachbarriere aufhob, sprach Pfarrer Roman Mazur zu uns. Seine Gedanken über die Kirche und ihre Aufgaben in der heutigen Welt haben uns zum Nachdenken, Diskutieren und Vergleichen gebracht – wie ist das in Tschechien, wie in Deutschland? Nach einer Pause, in der wir Zeit zum lockeren Austausch hatten, teilten wir uns in zwei tschechisch-deutsche Gruppen auf. Beim Pantomime-Raten von Bibelversen hatten wir viel Vergnügen. Anschließend beendeten wir unseren Abend mit einem gemeinsamen Gebet, bei dem uns das zweisprachige Vaterunser bewegte. Gerade das Gebet und die Lieder, deren Melodien sowohl die Tschechen als auch wir Deutschen kennen, verbanden uns. Diese Begegnungen mit dem lebendigen Kirchenleben in Prag - sich mit (gleichaltrigen) Menschen über Glaubensfragen und Alltagsthemen auszutauschen – werden uns noch lange in guter Erinnerung bleiben.
Almut Klose, Tübingen
DIE DIAKONIE DER EKBB
 Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Tel: (+ 420) 242 487 811 (812); Fax: (+420) 242 487 834
E-mail: info@diakonie.cz
Internet: www.diakonie.cz
Die Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) ist eine gemeinnützige christliche Organisation, die Hilfe und Unterstützung anbietet für ein würdiges und vollwertiges Leben, auch wenn es durch Alter, Krankheit, gesundheitliche Behinderungen, Isolation, schwierige soziale Situationen und andere Lebenskrisen beeinträchtigt ist. Die Dienste der Diakonie der EKBB erfolgen auf der Grundlage der Botschaft des Evangeliums von der Liebe Gottes und nach dem Vorbild des Dienstes Jesu Christi. In ihren Zentren und Spezial-Schulen bietet die Diakonie soziale, gesundheitliche, Bildungs- und Seelsorgedienste an. Unter den nicht-staatlichen Organisationen, die soziale Dienste anbieten, ist die Diakonie der EKBB die zweitgrösste Institution.
Die Diakonie schloss sich dem Netzwerk Eurocarers und dem Projekt Innovage an
Die Diakonie der EKBB hat sich dem europaweiten Netzwerk Eurocarers und dem Projekt Innovage (InformCare) angeschlossen. Ziel ist es, Menschen, die ihre Verwandten pflegen, mit Hilfe einer Web-Plattform wichtige und vollständige Informationen zu bieten. Informiert werden sollen aber beispielsweise auch Arbeitgeber, für die es wichtig ist, die Situation der Pflegenden zu verstehen und ihnen entgegenkommen. Die Infos auf der Web-Plattform sind in 24 offiziellen Sprachen der Europäischen Union zugänglich. Es gibt sowohl Informationen, die für alle EU-Länder gelten, als auch spezifische nationale Inhalte. Die Diakonie der EKBB ist in der Tschechischen Republik eine der wenigen Organisationen, die sich systematisch mit der Unterstützung häuslicher Pflege auseinandersetzt. Das diakonische Projekt „Pflege Zuhause“ ist auf die praktische Unterstützung pflegender Angehöriger durch intensive Beratung und Kurse in häuslicher Pflege ausgerichtet. Das Institut für würdevolles Altern (Institut důstojného stárnutí) bietet eine Basis für die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Fachöffentlichkeit, Wissenschaft, öffentlicher und kommunaler Verwaltung, Zivilgesellschaft und einzelner Personen, die sich mit dem Thema des Alterns in Würde auseinandersetzen.
Kirchliche Restitution: Die Diakonie übernahm das Seniorenheim in Kostelec nad Černými lesy
Das Seniorenheim in Kostelec nad Černými lesy wurde von der Stadt betrieben. Die Diakonie übernahm es, weil das Gebäude im Rahmen der sogenannten kirchlichen Restitution der Diakonie bzw. der Kirche zurückgegeben wurde. Es handelt sich dabei um das Eigentum, das der Kirche in der Zeit der kommunistischen Diktatur entzogen wurde. Das Heim in Kostelec nad Černými lesy diente vor dem zweiten Weltkrieg als „Erholungsheim für tschechische und evangelische Diakonissen“. Derzeit plant die Diakonie, die Dienste des Seniorenheims zu erhalten und auszubauen.
Wie erging es der Diakonie der EKBB im Jahr 2015
Das vergangene Jahr stand innerhalb der Diakonie im Zeichen ausgedehnter Bauprojekte. Die diakonischen Dienste erhielten neue oder rekonstruierte Räumlichkeiten in Vsetín, Sobotín, Myslibořice, Klobouky bei Brünn, Nosislav und Leitmeritz. Vor allem handelt es sich hier um Seniorenheime, in kleinerem Maße um Heime und Tageszentren für Menschen mit geistiger Behinderung. Insgesamt wurden 200 Million Kronen investiert, vor allem aus verschiedenen Fonds der Europäischen Union.
Die Anzahl registrierter sozialer Dienste der Diakonie der EKBB stieg leicht an. Im Jahre 2015 hatte die Diakonie 134 registrierte soziale Dienste, im Jahre 2014 nur 129. Die Anzahl der Schüler in Sonderschulen der Diakonie stieg ebenfalls: 2015 waren es 399, und damit 49 mehr als im Jahr 2014. In Anbetracht der geringen Fähigkeit tschechischer Firmen, Menschen mit Behinderung anzustellen, begannen die Zentren der Diakonie mit dem Aufbau sozialer Unternehmen.
Durch die Verbindung kleinerer Zentren entstanden zwei große Zentren der Diakonie, die auf Bezirksebene wirken: die Mittelböhmische und die Prager Diakonie.
Auf dem Gebiet internationaler Beziehungen beteiligte sich die Diakonie an folgenden Aktionen: Besuch der Mittelschule für Pädagogik der Diakonie Neuendettelsau in Hof; Besuch aus der Diakonie der Slowakischen Reformierten Kirche und Beschluss eines Memorandums über die Zusammenarbeit; Besuch des Diakonischen Instituts in Neumünster; Hauptversammlung der Eurodiakonie und Ausrichtung zweier Seminare zum Thema Langzeitbetreuung und Gesundes Altern unter dem Dach dieser Organisation; eine Konferenz der Eurodiakonie in Krakau für die Mitglieder der Visegrád-Gruppe über neue Ansätze in der Arbeit mit Klienten mit psychischen Erkrankungen; Besuch der Diakonie Rummelsberg in Bayern.
DIE EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT DER KARLSUNIVERSITÄT IN PRAG (ETF UK)
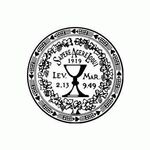 P.O. Box 529, Černá 9,
P.O. Box 529, Černá 9,
CZ 115 55 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 221 988 211; Fax: (+ 420) 221 988 215
E-Mail: intl@etf.cuni.cz
Internet: http://web.etf.cuni.cz/ETFENG-1.html
Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Karlsuniversität (ETF UK) ist die Nachfolgerin der Jan-Hus- Fakultät (1919–1950) und der Comenius-Fakultät (1950–1990). Im Jahr 1990 wurde sie in die Karlsuniversität eingegliedert. Die Verwaltung der Fakultät wird vom Dekan und dem Team der Prodekane geleitet, die auf vier Jahre in ihr Amt gewählt werden. Die Fakultät bietet Bakkalaureats- und Master-Studiengänge an – in evangelischer Theologie, Diakonie (Seelsorge und Sozialarbeit), ökumenische Studien, und verschiedene theologische Bereiche auf Doktoranden-Ebene. Die Fakultät ist ökumenisch für alle offen. Pfarrerinnen und Pfarrer der EKBB erhalten hier ihre Ausbildung.
Gemeinsame internationale Seminare – eine immer beliebtere Lehrmethode
Am 5. Mai 2016 machte sich eine kleine Gruppe Studierender und Lehrpersonen der evangelisch-theologischen Fakultät auf, um ein verlängertes Wochenende in Erlangen zu verbringen. Während des Sommersemesters lasen und diskutierten sie einmal wöchentlich über Holm Tetens Buch Gott denken. Ein Versuch über Rationale Theologie. Ebenso tat es eine Gruppe an der Erlanger Fakultät. Die Zeit war gekommen, dass die beiden Gruppen einander trafen, um die Ideen und Einsichten, die sie während der Lektüre des Buchs gesammelt hatten, miteinander zu teilen. Nach dem Wochenende in Erlangen, kehrte die tschechische Gruppe voller Begeisterung für dieses Konzept zurück. Neben dem Kennenlernen der deutschen Studierenden und ihrer Sichtweisen auf den Text, hatten sie auch die Möglichkeit einige interessante Orte in der Nähe von Erlangen zu besuchen, weshalb sie einer Weiterführung dieser Art von Austausch entgegensahen. Diese Gelegenheit brach bereits drei Wochen später an, als die TeilnehmerInnen des deutschen Seminars, das von Prof. Wolfgang Schoberth geleitet wurde, für ein Wochenende nach Prag kamen, wo eine weitere Blockseminar-Sitzung abgehalten wurde.
Im selben Semester wurde ein ähnliches Projekt realisiert, bei dem eine Studierendengruppe der ETF und eine von der technischen Universität Dresden (angeführt von Prof. Gerhard Lindemann) im Rahmen zweier Blockseminare zum Thema „Die Kirchen im kalten Krieg“– eines in Dresden im April 2016 und eines im Mai in Prag – zusammenkamen. Diesmal studierten die beiden Gruppen nicht denselben Text, befassten sich aber mit einem Thema, bei dem die eine Gruppe sich auf die tschechoslowakischen Kirchen im kalten Krieg konzentrierte und die andere Gruppe ihren Schwerpunkt auf die Kirchen in Ost-Deutschland des genannten Zeitraums, setzte. Hierbei war es faszinierend, etwas über die Voraussetzungen, die in den beiden Ländern vor 40 oder 50 Jahren herrschten, und darüber, wie die Kirchen diesen Voraussetzungen gegenübertraten, zu lernen. Die beiden Wochenendseminare boten zudem die Möglichkeit Menschen, die die Zeit des kalten Kriegs miterlebt haben, zu treffen und aus erster Hand über die Situation der Kirchen während dieser Zeit unterrichtet zu werden. Erneut waren die Unterschiede zwischen der deutschen und der tschechischen Situation sehr erleuchtend.
Ein etwas anderes Konzept wurde für ein Seminar für „Theologie im Alten Testament. Aktuelle Konzepte, Themen und Methoden“ angewendet. In diesem Falle fand am 5.-6. Mai 2016 nur ein Blockseminar in Prag statt, ohne spezielle Vorbereitungen während des Semesters. Die Idee ähnelte den anderen jedoch darin, dass Prof. Manfred Oeming, der den Einführungsvortrag hielt, einige Studierende aus Heidelberg mit nach Prag nahm, um am Seminar teilzunehmen und mit den tschechischen Kommilitonen ins Gespräch zu kommen während sie verschiedene Konzepte einer Theologie des Alten Testaments und verschiedene Ansätze führender Theologen des 20. und 21. Jahrhunderts entdeckten. Prof. Oemings Pragbesuch fiel mit der Herausgabe einer neuen Auflage der tschechischen Übersetzung seines Buchs Einführung in die biblische Hermeneutik zusammen.
Das Konzept der gemeinsamen Seminare wurde an der ETF in der Vergangenheit bereits mehrere Male durchgeführt. Die Tatsache allerdings, dass nicht weniger als drei dieser Art im Sommersemester 2016 stattfanden, zeigt, dass dieser Lehransatz zunehmend an Zuspruch gewinnt. Die drei genannten Beispiele unterschieden sich voneinander hinsichtlich ihrer Organisation und Vorbereitung, ihres Themas und sogar der Sprache, die für die Diskussionen genutzt wurde – während das Erlangen-Prag-Seminar auf Deutsch gehalten wurde, fanden das Dresden-Prag- und Heidelberg-Prag-Seminar auf Englisch statt. Jedes einzelne bot den Teilnehmern die Gelegenheit in Kontakt mit verschiedenen theologischen Ansätzen und einem anderen kulturellen und akademischen Umfeld zu kommen. In der Vergangenheit gab es mehrere Fälle, in denen TeilnehmerInnen eines solchen gemeinsamen Seminars das andere Land und die dortige Universität so attraktiv fanden, dass sie später dort anfingen zu studieren, beispielsweise als Austauschstudierende des Erasmus-Programms.
Alles in allem hat sich das Konzept dieser gemeinsamen Seminare sehr erfolgreich bewährt und die ETF intendiert mit Sicherheit, es auch in Zukunft weiterzuführen, da es die internationalen Kontakte fördert und den theologischen Horizont ihrer Studierenden erweitert. Und, wer weiß, vielleicht können wir uns darauf freuen, bald mehr internationale Studierende aus Erlangen, Dresden oder Heidelberg oder von wo auch immer begrüßen zu dürfen.
Peter Stephens,
Auslandsabteilung der ETF
zurück von den Grenzen
Seminar an der evangelischen Fakultät mit Menschen, die Flüchtlingen entlang der Balkan-Route halfen
Da kam eins zum anderen: Von mehreren Seiten erfuhren wir, dass sich tschechische Bürger zu den entlegenen Grenzen entlang der Balkanroute aufmachen, um den nach Europa kommenden Flüchtlingen zu helfen. Sie kehren dann in eine Gesellschaft zurück, die solchen Einsatz nicht besonders schätzt oder nur mit Bedenken wertschätzt, in einen Staat, dessen Vorsteher sich laut von Migration und Unterstützung distanzieren.
"Was können wir machen, wodurch können wir etwas Positives beitragen?", fragten wir uns vom psychosozialen Interventionsteam, dessen Arbeit sich mit der des Diakonischen Fachbereichs der Evangelischen Theologischen Fakultät überschneidet.
Wir entschieden uns, ein eintägiges Seminar zum Thema "zurück von den Grenzen" auszurichten. Es fand am 11. April 2016 an der Evangelischen Fakultät in Prag statt.
Wir befassten uns mit Erfahrungen, die die Mitarbeitenden der großen Organisationen Charitas Tschechien und Adra (karitative Organisation der Adventisten), Freiwillige der Organisation "Wir helfen Menschen auf der Flucht" (Pomáháme lidem na útěku, kurz: PLNU) und Menschen, ganz ohne institutionelle oder organisierte Anbindung, gesammelt haben – die alle auf die Situation reagierten, denn nicht zu reagieren war für sie keine Option.
Wir wollten von diesen Erfahrungen lernen und gemeinsam darüber nachdenken, wie man die Mitmenschlichkeit fördern könnte.
Die Erfahrungen der Helfenden
Unabhängige Freiwillige sind außergewöhnlich aktiv, sie sind fähig sich über die sozialen Netzwerke im Internet zu koordinieren und ohne große finanzielle Mittel zu helfen. Bis größere Organisationen reagieren können, dauert das einige Tage. Wenn Freiwillige aber nach Tschechien meldeten, dass sie z.B. Lebensmittel benötigten, antworteten gleich mehrere Spender – auch die Politiker inbegriffen, aber ohne Bekanntgabe in den Medien, auf der privaten Ebene.
Das wichtigste war, Informationszentren einzurichten und die Menschenmassen unter Einbindung der Flüchtlinge selbst zu regulieren. Und sich dann darum zu kümmern, wer was braucht, und das so schnell wie möglich, auszuhändigen.
Das Erlebnis, wie sinnvoll solches Handeln ist, machte die Rückkehr schwer. "Was fangen die Menschen dort jetzt ohne mich an?", fragen sich die, die zurückgekehrt sind. Eineinhalb Monate dauert es, bis die aufgewühlten Gefühle wieder auf die tschechische Realität eingestellt sind, in der Wichtiges als unwichtig tituliert wird, und andersrum. Meistens hilft es, sich jemandem mitteilen zu können, am besten jemandem, der die gleichen Erfahrungen gemacht hat.
Das Thema spaltet die Gemüter in Familie, Organisationen und Welt: "Ich sah, dass uns das in der Familie trennt, es kam mir komisch vor, dass in unserem Umfeld niemand konkret Menschen helfen will, das rief einen Konflikt hervor.", erzählt ein Freiwilliger der Organisation PLNU. Die Ärzte ohne Grenzen kämpfen mit der EU um die Genfer Konvention, eine der Bastionen der europäischen Humanität, die im Kontext der politischen Ratlosigkeit erschüttert wird.
Fragezeichen
Die Erfahrung allein ist schon prägend: "Jeder einzelne Mensch war notwendig und es gab unglaublich viel zu tun." Natürlich nicht immer. Wenn ein Mitarbeiter nur etwas verteilte (Lebensmittel, Trinken, Kleidung), hatte er angesichts der anonymen Menschenmasse nicht "das Gefühl, dass ich menschliches Leben retten würde. Ich kam mir vor wie eine Maschine."
Flüchtende Menschen gehen irgendwo hin. Wenn sie ankommen, werden sie dann hier Zuhause sein? Werden wir sie dann wie unsere Nachbarn behandeln, oder weiterhin dem "Nächsten in Not" helfen? (Ein Nachbar will aber nicht sein Leben lang ein "Mensch in Not" sein.) "Es sind unglaubliche Mengen. Ich war hin- und hergerissen zwischen Angst und Hilfe. Wenn sie irgendwo angekommen sind, beginnen sie ihre Umgebung zu verändern, und schon wird es nicht mehr die Welt sein, die ich gewöhnt war."
Angst haben wir schon, wenn wir überlegen, wie es weitergehen wird. Reale Gefahren beim Helfen bergen besonders die Umstände: die ersten Wochen gab es keine Toiletten, obwohl an dem Ort 100.000 Menschen aufgenommen wurden.
Eine weitere Gefahr ergibt sich aus der Sicherheitspolitik, aus dem Prozess der Abschottung, durch den Stacheldraht und bewaffnete Grenzwächter. "Wenn Machtmittel im Spiel sind, droht eine Katastrophe, und niemand kann nachvollziehen, wo sie begann."
Wir sagen, dass wir den Islam in Tschechien nicht wollen (Anmerk.: "Islám v ČR nechceme", "Islam in Tschechien wollen wir nicht" ist eine Kampagne in Tschechien.) – und was wollen wir denn?
Was können wir machen?
Menschen, die an die entlegenen Grenzen gefahren sind, helfen uns, die wir hier blieben, auch wenn weiter Ratlosigkeit herrscht. In Zusammenarbeit mit ihnen lässt sich die Realität, dass auf die Flüchtlingsfrage niemand eine globale Lösung weiß, besser ertragen.
Was können wir machen? "Auf einmal fiel mir ein, dass genauso wichtig wie die eigentliche Hilfe vor Ort, die Information über sie ist." sagte ein Freiwilliger der Organisation PLNU: "Wir sprechen Mittelschulen an, wir wollen mit den Schülern debattieren, von der Position der Menschen aus, die dort waren, und können so darüber öffentlich reden."
Und was ist mit uns, die wir nicht dort waren? Wir können auch etwas tun: Z.B. das Thema der Migration nicht auf die bedrohte Sicherheitslage verengen, und formulieren, wofür und hinter was wir stehen.
"Wir hoffen auf eine Welt, in der Menschen sich gegenseitig helfen." erklang auf dem Seminar. Weil "Menschen auf der Welt zu Hause sind." Und auch dass Verschiedenheit eine Inspiration sein kann. Menschen von woanders können das Leben interessanter machen. "Wir sind so homogen, dass wir daran noch verblöden."
Bohumila Baštecká, Fachbereich Diakonie, Evang. Fakultät Prag
Noch einmal studieren
Nach dreißig Jahren als Gemeindepfarrer studiere ich wieder, diesmal an der Evangelischen Theologischen Fakultät der Karls-Universität Prag. Meine Landeskirche (Evangelische Landeskirche in Württemberg) stellt mich für die Vorlesungszeit des Sommersemesters frei. Die Fakultät bietet viele englischsprachige Veranstaltungen, wie auch ein Seminar in deutscher Sprache.
Die Sorge wegen meiner nicht ganz frischen Englischkenntnisse war glücklicherweise unbegründet. Das „International Department“ der Fakultät organisierte hilfreiche Einführungstage und weist immer wieder auf interessante Veranstaltungen und Exkursionen hin. Auch im Kreis der jüngeren Mitstudierenden wurde ich freundlich aufgenommen.
Nun beschäftige ich mich unter anderem mit Zugängen zu Menschen mit Demenz. Meine Heimatstadt Winnenden bezeichnet sich gerne als „Gesundheitsstadt“. Da ist das Seminar „Gesundheit, Kultur und Gesellschaft“ nahezu verpflichtend. – Wie gut für mich, dass sich an der Fakultät auch Diakonie studieren lässt!
Schön auch, dass ich Zeit habe, die Hauptstadt im Herzen Europas zu durchstreifen. Wie viele Tschechen habe ich gerne ein Buch bei mir, das sich in der Straßenbahn oder auf einer Parkbank lesen lässt. Gemeinsam mit anderen Studierenden suche ich nach den Wurzeln des Christentums in der europäischen Literatur und entdecke dabei sowohl tschechische Erzählungen als auch neue Zugänge zu englischen Schriftstellern.
Natürlich denkt ein Theologe auch über Gott nach. Das kann ich hier sogar in meiner Muttersprache mit anderen gemeinsam, im Seminar „Gott denken“. Nebenbei lese und höre ich über die „Kirche im Kalten Krieg“ und die Böhmische Reformation.
In Prag lassen sich die verschiedensten Gottesdienstangebote finden. Dem deutschen Gottesdienst in der Kirche St. Martin in der Mauer kann ich natürlich am besten folgen. Im Gottesdienst der „Evangelischen Kirche der böhmischen Brüder“ in Vinohrady spricht mich die schlichte evangelische Liturgie an. - Ein bescheidener Ehrgeiz ist da, die tschechische Sprache zu lernen. Einstweilen freue ich mich schon, wenn es mir gelingt, im Supermarkt die Kassiererin zu verstehen und selbst verstanden zu werden.
In Summe: Das Kontaktsemester ist eine großartige Einrichtung meiner Kirche: Wenn ich im Sommer wieder in der Gemeinde sein werde, dann mit einem erweiterten Horizont und mit neuer Lust und Kraft!
Reimar Krauß, Pfarrer
Die ETF UK hat eine internationale Konferenz zu den Grenzen der aramäischen Staaten in der Eisenzeit ausgetragen
In der Zeit von 22.–24. April 2016 fand an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Karls-Universität Prag eine internationale Konferenz zum Thema „Aramaean Borders. Defining Aramaean Territories in the 10th-8th Centuries BCE“ (http://cbs.etf.cuni.cz/en/historie-a-interpretace-bible/konference1.html) statt. Diese Konferenz war Teil des Projektes des Exzellenzzentrums „Die Geschichte und Interpretation der Bibel („Dějiny a interpretace Bible“) (GAČR P401/12/G168), das von der Zuschuss-Agentur der Tschechischen Republik finanziert wurde, zu deren Empfängern sich unsere Fakultät zählen darf.
Die Konferenz hatte zum Ziel, der Frage auf den Grund zu gehen, auf welcher Grundlage wir heute die Grenzen einzelner aramäischer Staaten in Syrien während der Eisenzeit beschreiben können, welche Quellen uns hierzu zur Verfügung stehen, welche Auskunft uns diese Quellen überhaupt hinsichtlich der Grenzfrage geben können und wie die Grenzen dieser Staaten definiert waren. 17 Teilnehmer aus acht Ländern nahmen die Einladung zur Konferenz an, darunter weltweit führende Fachmänner im Bereich der Archäologie Syriens und Palästinas, der historischen Geographie der Levante, neuassyrischer Texte, zudem Spezialisten für luwische, aramäische und fönizische Epigraphik. Die Konferenz wurde thematisch in vier Blöcke unterteilt. Der erste Block beinhaltete Vorlesungen zu Grenzen zwischen dem neuassyrischen Reich und den aramäischen Staaten. Der zweite setzte sich aus zwei Vorlesungen zusammen, die sich mit den politischen, kulturellen und religiösen Grenzen zwischen der luwischen und der aramäischen Bevölkerung der nördlichen Levante befassten. Der dritte Block beschäftigte sich mit den Grenzen der aramäischen Staaten in der nördlichen Levante. Den vierten Block prägten Beiträge zu den Grenzen der aramäischen Staaten in der südlichen Levante (namentlich die Königreiche Aram und Damaskus), im Westjordanland (Israel) und im Ostjordanland (Ammon).
Die Konferenz war v.a. aus dem Grund ertragreich, dass sie eine Interaktion und Diskussion zwischen den Spezialisten der oben aufgeführten Forschungsbereiche ermöglichte. Die Ergebnisse der Konferenz werden im Verlag Brill in Leiden veröffentlicht.
Dr. Jan Dušek
